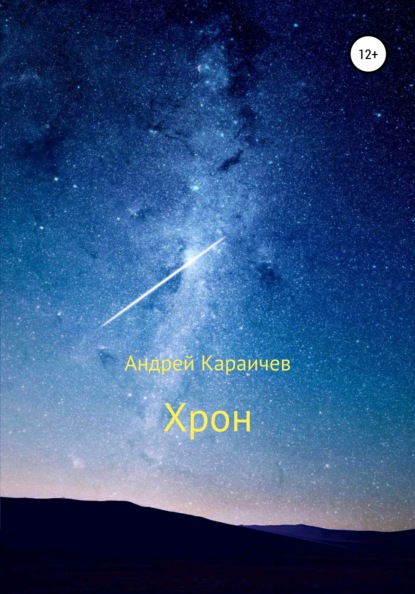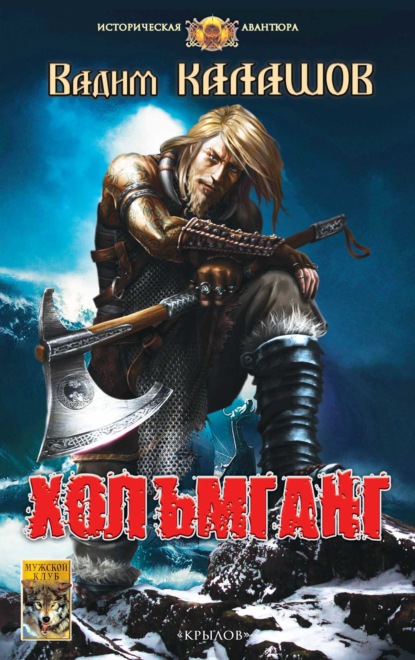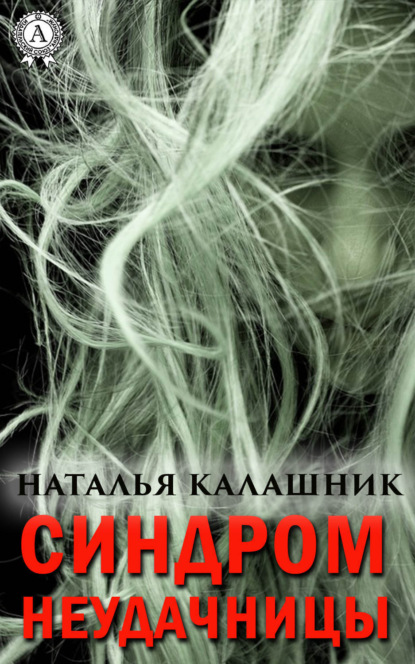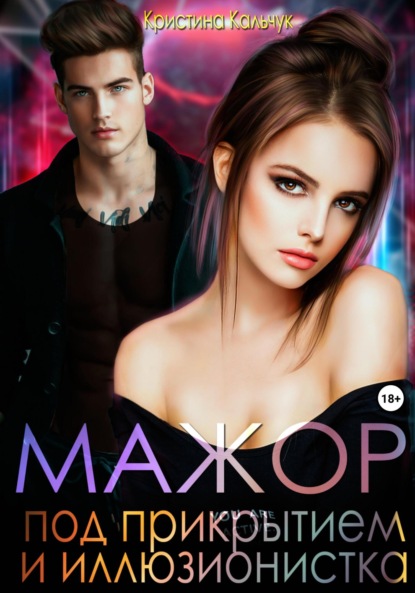Komplexe Dynamische Evaluation (KDE): Ein Instrument zur Optimierung des universitären Fremdsprachenunterrichts
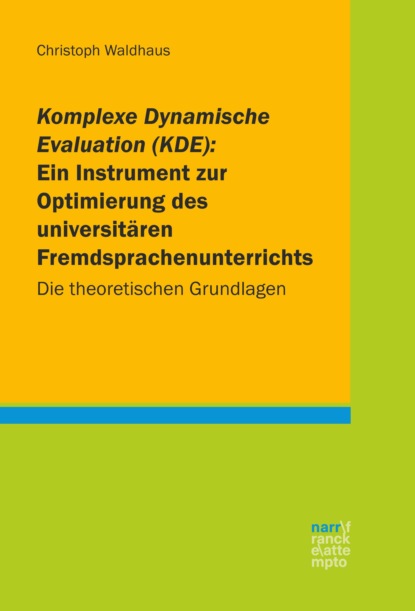
- -
- 100%
- +
2.3.1.1.6 Lernumgebung
Eine besonders wichtige Leitlinie dieses Standards wird wie folgt definiert:
»Die Bedürfnisse einer heterogenen Studierendenschaft (u.a. ältere, ausländische, berufstätige oder in Teilzeit Studierende sowie Studierende mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen) und die Ausrichtung auf studierendenzentriertes Lernen sowie flexible Lern- und Lehrmethoden werden bei der Zuteilung, Planung und Bereitstellung des Lernmittel- und Betreuungsangebots berücksichtigt« (HRK 2015:24).
Dies kann in Hinblick auf Qualitätssicherung so interpretiert werden, dass die Voraussetzungen der Studierenden bereits zu Beginn des Kurses in Erfahrung gebracht werden sollten, damit man diese als LehrendeR von Anfang an gezielt bei der Planung bzw. eventuell nötigen Adaption des Kurses berücksichtigen kann. Wer seine Gruppe kennt, kann einen für sie passenden Unterricht konzipieren.
2.3.1.1.7 Informationsmanagement
Zentraler Punkt dieses Standards ist, dass Universitäten relevante Daten erheben, analysieren und nutzen (vgl. HRK 2015:25). Evaluationsinstrumente können dabei eine wesentliche, vielleicht – wenn richtig konzipiert – die entscheidende Rolle spielen. Für mich ist an dieser Stelle zentral, dass relevante Daten erhoben und diese nach deren Analyse auch genutzt werden, um Optimierungen zu erzielen, oder wie in den Leitlinien formuliert, um »fundierte Entscheidungen treffen zu können und zu erkennen, was gut funktioniert und was verändert werden sollte (ibid.)«. Hierbei spielt natürlich auch der Erhebungszeitpunkt eine wesentliche Rolle, denn wenn die relevanten Daten zu spät erhoben werden, können sie für eine Optimierung nicht mehr genutzt werden.
Darüber hinaus wird bei diesem Punkt Wert auf die Verwendung »effektiver Verfahren (ibid.)« zur Informationsgenerierung gelegt, was mitunter bedeutet, dass nicht nur möglichst viele für die Qualitätsoptimierung relevante Informationen gefördert werden, sondern auch in einer Weise, die möglichst wenig Ressourcen benötigt.
Daten, die unter anderen als relevant angesehen werden können, sind laut ESG (siehe HRK 2015:25):
»Leistungsindikatoren (KPI);
das Profil der Studierendenschaft;
Studienverläufe, Erfolgs- und Abbruchquoten;
die Zufriedenheit der Studierenden mit den Studiengängen;
die verfügbare Ausstattung und Betreuung;
Berufswege der Absolventinnen und Absolventen«.
Die Daten können laut ESG auf unterschiedliche Weise erhoben werden, jedoch spielt das Miteinbeziehen aller am Lehr- und Lernprozess Beteiligten eine wesentliche Rolle – nicht nur beim Generieren der Daten, sondern auch bei deren Auswertung und bei sämtlichen Folgeaktivitäten (vgl. ibid.).
2.3.1.1.8 Fortlaufende Beobachtung und Überprüfung der Studiengänge
Zentral bei diesem Standard ist (siehe HRK 2015:26), dass Universitäten ihre Studiengänge kontinuierlich beobachten und sie – unter Einbeziehung der Studierenden – regelmäßig überprüfen und überarbeiten, damit gewährleistet werden kann, dass »sie die gesteckten Ziele erreichen und die Bedürfnisse der Studierenden und der Gesellschaft erfüllen«. Dies führt zu einer »kontinuierlichen Verbesserung der Studiengänge«. Ein besonders wichtiger Aspekt, der hier angeführt wird, ist, dass »die Erwartungen und Bedürfnisse sowie die Zufriedenheit der Studierenden mit den Studiengängen« berücksichtigt werden.
2.3.1.2 Fazit
Vergleicht man die ursprünglichen ESG mit jenen aus dem Jahr 2015, kann festgestellt werden, dass sich diese inhaltlich kaum verändert haben, dass sie jedoch an manchen Stellen detaillierter und mit stärkerem Nachdruck formuliert wurden. In beiden Fällen können sie zweifellos einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätsoptimierung liefern und sollten daher auch in Modellen zur Qualitätsverbesserung berücksichtigt werden.
Hinsichtlich ihres Umfangs wurden bei den ESG 2015 jene Veränderungen berücksichtigt, die im Europäischen Hochschulraum in den Jahren 2005 bis 2015 stattgefunden haben. Damit einhergehend und besonders wichtig im Hinblick auf die vorliegende Arbeit ist, dass in den ESG 2015 der studierendenfokussierte Lernansatz stärker als davor im Vordergrund steht. Darüber hinaus sollen flexible Bildungswege vermehrt berücksichtigt werden und Kompetenzen stärkere Anerkennung finden, die außerhalb formaler Bildung erworben werden. Zudem wird neben dem bisherigen Fokus auf Qualitätssicherung beim Lehren und Lernen ein Bezug zur Lernumgebung sowie zur Forschung und Innovation hergestellt (vgl. BFUG 2015).
Neben zahlreichen weiteren und eher kleineren Veränderungen sind folgende Grundsätze der ESG 20151 für Qualitätssicherung von immenser Wichtigkeit: die Forderung, dass Qualitätssicherung keine Formsache sein darf, sondern eine Qualitätskultur fördern soll und, dass Qualitätssicherung die Bedürfnisse und Erwartungen der Studierenden, der übrigen Interessengruppen und der Gesellschaft berücksichtigt. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang auch die Feststellung, dass Studierende zu den institutionellen Akteuren zählen und eine Verantwortung bei der Qualitätssicherung haben und diese auch wahrnehmen müssen, dass sie vielmehr noch, in den Qualitätssicherungsprozess aktiv miteinbezogen werden müssen. Eine weitere Schlüsselpassage ist die Forderung, dass Qualitätssicherung kontinuierlich und nicht punktuell erfolgen soll.
Sämtliche dieser Forderungen decken sich auch mit Ansätzen aus dem Qualitätsmanagement, der Evaluationsforschung und der Fremdsprachendidaktik, wie in den folgenden Kapiteln noch ausgeführt wird.
2.3.2 Methoden aus dem Qualitätsmanagement
In den vergangenen 15 Jahren wurden von der ENQA drei1 umfangreiche Erhebungen zum Thema qualitätssichernde Maßnahmen an europäischen Hochschulen durchgeführt. Die erste aus dem Jahr 2003 (siehe The Danish Evaluation Institute 2003) untersuchte die einzelnen Verfahren, die diesbezüglich an den Universitäten der 23 partizipierenden Länder zum Einsatz kamen und versuchte neben den Ebenen und dem Umfang auch Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede bei diesen Verfahren festzustellen. Die primären Ergebnisse dieser Befragung waren u.a., dass die unterschiedlichen Maßnahmen sowohl im Umfang als auch vom Typus seit den späten 1990er Jahren komplexer wurden, dass eine Zunahme von Qualitätssicherungsagenturen in Europa zu verzeichnen war und dass die Maßnahmen der einzelnen Länder im Wesentlichen auf den gleichen methodologischen Prinzipien aufbauen. Gleichzeitig wurde auch festgestellt, dass es mitunter nach wie vor erhebliche Unterschiede bei der Implementierung der einzelnen Methoden in den verschiedenen Ländern gab, wenngleich im Allgemeinen den Empfehlungen des Rates der Europäischen Union (Vier-Phasen-Modell) aus dem Jahr 1998 (siehe Amtsblatt L 270/59 vom 7.10.1998) Folge geleistet wird.
Die Untersuchung zeigte zudem, dass an den europäischen Hochschulen hauptsächlich vier – zumeist mehrstufige – Methoden der Qualitätssicherung eingesetzt werden. Diese sind – geordnet nach Häufigkeit des Einsatzes – in aufsteigender Reihenfolge: (1) Benchmarking, (2) Audit, (3) Akkreditierung und als wichtigstes Verfahren (4) Evaluation (siehe The Danish Evaluation Institute 2003:17ff). Da die ersten drei nicht direkte Bestandteile dieses Buches sind, werden sie nur in aller Kürze behandelt. Auf Evaluation soll jedoch in weiterer Folge – vor allem in Kapitel 3 – im Detail eingegangen werden.
2.3.2.1 Benchmarking
Im Qualitätsmanagement versteht man unter Benchmarking, wie Kamiske/Brauer (2008:10ff) ausführen, den »Prozess des Vergleichens und Messens der eigenen Produkte und Prozesse mit den besten Wettbewerbern oder mit den anerkannten Marktführern«. Dabei werden jene Unternehmen bzw. Organisationen, die einen zu untersuchenden Prozess, ein Produkt oder eine Dienstleistung hervorragend beherrschen, als sogenannte Klassenbeste (Best in Class) bezeichnet, und im Vergleich zu diesen sollen Unterschiede zum eigenen Unternehmen erkannt und Möglichkeiten zur Verbesserung aufgezeigt werden. Das bedeutet: Primäres Ziel eines Benchmarkings im herkömmlichen Sinn ist, aus dem Vergleich mit den Besten zu lernen, die wirkungsvollsten Methoden (Best Practice) herauszufinden, zu adaptieren und dadurch die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern, um selbst die Spitzenposition (Best of the Best) zu erreichen (vgl. ibid.). Als Orientierungspunkte hierfür dienen sogenannte Benchmarks, also Normen bzw. Referenzgrößen, die als Bezugspunkte herangezogen werden.
Auch im Hochschulkontext wird diese Methode in den unterschiedlichsten Bereichen – von der Forschung bis zur Lehre – eingesetzt und funktioniert im Prinzip ähnlich wie im Qualitätsmanagement in der Wirtschaft: Eine Universität sucht bei anderen Hochschulen nach Vorbildern in bestimmten Bereichen, die dann übernommen werden können, orientiert sich somit an dieser Hochschule, oder es wird gemeinsam nach Lösungen für ähnliche Probleme gesucht. Das zentrale Anliegen ist in jedem Fall, durch Vergleiche voneinander zu lernen (vgl. HRK 2007:21).
Während Benchmarking im Jahr 2003 von keiner, an der ENQA-Befragung teilnehmenden Hochschulen als primäre Methode der Qualitätssicherung angeführt wurde und im Wesentlichen nur im Bereich der Bewertung von Studiengängen (programme benchmarking) bzw. Fachgebieten (subject benchmarking) einen kleinen Prozentsatz ausmachte, aber im Allgemeinen bei der überwiegenden Mehrheit der Universitäten überhaupt nicht als qualitätssichernde Maßnahme angeführt wurde1 (vgl. The Danish Evaluation Institute 2003:21), schien diese Methode in den letzten Jahren an Bedeutung zu gewinnen.
So wurden zahlreiche Projekte und Workshops zum Thema Benchmarking an europäischen Hochschulen ins Leben gerufen (siehe z.B. European Centre for Strategic Management of Universities, esmu und ENQA) und 2010 ein Handbuch zu diesem Thema publiziert (siehe van Vught et al. 2010). Zudem entstanden sogenannte Benchmarking-Clubs, denen zahlreiche Universitäten angehören und die gemeinsam an neuen Projekten arbeiten bzw. als Orientierung für andere Universitäten fungieren.
Trotz all dieser Initiativen und Prozesse ist in diesem Bereich im Hochschulkontext noch erheblicher Handlungsspielraum gegeben und die Zahl der Publikationen bzw. die Zahl der dokumentierten Verfahren in diesem Bereich ist überschaubar, wie auch Schröder/Sehl (vgl. 2010:1) festhalten. Dies zeigt auch die ENQA-Umfrage aus dem Jahr 2012 (vgl. 2012:18), aus welcher hervorgeht, dass ein Großteil der befragten Qualitätssicherungsagenturen auf den noch erheblichen Bedarf an Weiterentwicklung der aktuellen internationalen Benchmarks für Qualitätssicherung hinweist.
2.3.2.2 Audit
Die DIN ISO 9000:2005 (3.9.1) definiert Audit als einen systematischen, unabhängigen und dokumentierten Prozess1 zur Erlangung von Auditnachweisen2 und zu deren objektiver Auswertung, um zu ermitteln, inwieweit Auditkriterien3 erfüllt sind«. Dem Prinzip nach ist ein Audit somit »eine besondere Form einer Prüfung, bei der festgestellt wird, inwieweit eine betrachtete Einheit die Forderungen erfüllt, die an sie gestellt werden« (Herrmann 2007:332). Geiger (1994:79) weist diesbezüglich darauf hin, dass man ein Audit nicht mit einer herkömmlichen Qualitätsprüfung verwechseln darf, da es sich bei einem Audit ausdrücklich um »Tätigkeiten und nur auf die damit zusammenhängenden Ergebnisse« handelt, es somit »um das QM4-System und um das ›ob‹ geht« und nicht »um das ›inwieweit‹ und um beliebige Einheiten«, wie dies bei einer »Qualitätsprüfung« der Fall ist. Demgemäß sollen mit einem Audit »Schwachstellen aufgezeigt, Verbesserungsmaßnahmen angeregt und deren Wirkung überwacht werden. Damit ist das Audit auch als Führungsinstrument zu sehen, das zur Vorgabe von Zielen und zur Information des Managements über die Zielerreichung eingesetzt werden kann« (Kamiske/Brauer 2008:5).
Audits werden von unabhängigen AuditorInnen durchgeführt und können unterschieden werden hinsichtlich der zu untersuchenden Einheit (Produkt, Verfahren, System) oder hinsichtlich der Durchführungsart (intern oder extern). Demgemäß spricht man von »Produktaudit«, »Verfahrensaudit« und »Systemaudit«, bzw. deren Hyperonym, dem »Qualitätsaudit«, oder von einem internen bzw. externen Audit. Die Informationen, die man mit Hilfe eines Audits gewinnt, zeigen z.B. der Leitung eines Unternehmens den Verbesserungsbedarf auf und weisen auf jene Bereiche der Organisation hin, in denen sich noch nicht ausgeschöpfte Potentiale befinden. Die Ergebnisse dienen somit als Ausgangspunkt eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (vgl. Herrmann 2007:332).
An europäischen Universitäten wurden Audits in Großbritannien in den 1990er Jahren eingeführt (vgl. Mittag 2006:5) und zählen daher, vergleicht man sie beispielsweise mit Evaluationen, eher zu jüngeren Verfahren der Qualitätssicherung. Das Audit richtet sich an die Hochschule als Ganzes (vgl. HRK 2007:14) und ist »ein partnerschaftlicher Prozess, an dem sich die Hochschule und kompetente Gutachter/innen beteiligen« (AQ 2013:3). Die AQ definiert Audit als »ein periodisch wiederkehrendes Peer-Verfahren, in dem Organisation und Umsetzung des internen Qualitätsmanagementsystems einer Hochschule durch externe Gutachter/innen beurteilt werden« (ibid.). Es handelt sich um eine Art »kollegiales Feedback« (ibid.) bei welchem man sich an Auditstandards orientiert und zwei primäre Ziele verfolgt: Erstens bestätigt das Audit, »dass eine Hochschule ihr Qualitätsmanagementsystem gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eingerichtet hat« und zweitens fördert es die Hochschule »bei der Weiterentwicklung ihres internen Qualitätsmanagementsystems« (ibid.). Infolge kann die Universität, wenn sie die nötigen Standards erfüllt, zertifiziert werden (siehe unten).
Laut The Danish Evaluation Institute (vgl. 2003:8) sind Audits die drittmeist verwendete Methode der Qualitätssicherung an europäischen Universitäten und erfreuen sich besonders im englischsprachigen Raum großer Beliebtheit. Auch im deutschsprachigen Raum, in welchem sie sich anfangs vergleichsweise weniger durchsetzten (vgl. Mittag 2006:5), finden Audits zusehends Eingang. In Österreich beispielsweise wurden Audits mit dem Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz 2011 zum fixen Bestandteil der externen Qualitätssicherung.
2.3.2.3 Akkreditierung und Zertifizierung
Im Qualitätsmanagement werden die beiden Begriffe Zertifizierung und Akkreditierung sehr oft in Verbindung miteinander verwendet.
Bei der Zertifizierung handelt es sich laut Wirtschaftslexikon24.com um die »Prüfung eines Unternehmens durch einen unabhängigen Dritten zum Erhalt eines Zertifikats, das die Übereinstimmung (Konformität) der Leistungserstellung […] mit bestimmten Anforderungen und Normen ausdrückt«. Die Zertifizierung stellt somit eine Bewertung und Bestätigung des Qualitätsmanagementsystems durch eine kompetente und unabhängige Stelle dar, und das Zertifikat dient als Nachweis der Qualitätsfähigkeit der Organisation (vgl. Drechsel 2007:344), wobei als Prüfungsgrundlage für die Zertifizierung Normen (z.B. ISO 9000) oder Standards (z.B. ESG) herangezogen werden.
Laut ISO/IEC 17011:2004 (zit. nach Drechsel 2007:345) versteht man unter Akkreditierung »die Bestätigung durch eine dritte Stelle, die formal darlegt, dass eine Konformitätsbewertungsstelle1 die Kompetenz besitzt, bestimmte Konformitätsbewertungsaufgaben durchzuführen«. Mit anderen Worten: Eine allgemein anerkannte Instanz (Akkreditierungsstelle) bescheinigt einer anderen (Zertifizierungsstelle), dass sie gemäß nationaler oder internationaler Normen bestimmte Anforderungen2 in einem bestimmten Bereich erfüllt.
Bei einem Akkreditierungsverfahren handelt es sich somit um eine »Prüfung der Prüfer«, (Drechsel 2007:345) wobei die Zertifizierungsstelle nachweisen muss, »dass sie die einschlägigen Regeln befolgt und über kompetentes Personal verfügt«. Das wird von der Akkreditierungsstelle überprüft, »die Audits beim Zertifizierer durchführt und ihn bei ausgewählten Audits begleitet, um sich von dessen Kompetenz zu überzeugen« (ibid.). Vereinfacht gesagt bedeutet dies, dass die Zertifizierungsstelle ein Unternehmen oder eine Organisation prüft und selbst wiederum von einer Akkreditierungsstelle geprüft wird. Die Zertifizierung bestätigt z.B., dass die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens qualitativ hochwertig sind, und die Akkreditierung der Zertifizierungsstelle ist dabei wichtig für die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz dieses Zertifikats.
Obwohl der Terminus »Akkreditierung« im Kontext der Universitäten nicht immer eindeutig definiert wurde und oftmals doppeldeutig verwendet wird (vgl. The Danish Evaluation Institute 2003:19), gewinnt diese Methode im Rahmen der Qualitätssicherung an Hochschulen auch durch die Schaffung des europäischen Hochschulraums an Bedeutung. Sie dient vor allem der Sicherung von Mindeststandards, der Herstellung von Transparenz, der Förderung der Studierendenmobilität und der internationalen Vergleichbarkeit und Anerkennung der Studienabschlüsse (vgl. Mittag 2006:3). Die AQ definiert Akkreditierung als »ein formales und transparentes Qualitätsprüfverfahren anhand definierter Kriterien und Standards, das zu einer staatlichen Anerkennung einer hochschulischen Bildungseinrichtung und/oder Studien führt« (AQ 2014:3). Demnach handelt es sich bei Akkreditierung um eine summative Betrachtung von Qualität (vgl. HRK 2007:11).
Die erste ENQA-Erhebung (vgl. The Danish Evaluation Institute 2003:19) ergab, dass Akkreditierung vor allem im Zusammenhang mit Studiengängen (accreditation of programme) Anwendung findet. Demgemäß wurde sie 2003 an über 50 % der befragten Institutionen durchgeführt, allen voran an Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Auch im Bereich der Institute wurde Akkreditierung von über 20 % der Beteiligten angewandt. Um die oben angesprochene Diffusität des Begriffs »Akkreditierung« zu klären, wurde der Terminus in der ENQA-Erhebung (The Danish Evaluation Institute 2003:20) durch folgende Charakteristika definiert:
1 Akkreditierung erkennt an (oder nicht), dass ein universitärer Kurs, ein Studium oder eine Institution einen gewissen Standard (Minimalstandard oder Exzellenzstandard) erfüllt.
2 Akkreditierung beinhaltet daher immer ein Benchmarking.
3 Die Ergebnisse einer Akkreditierung werden immer auf Basis von Qualitätskriterien und niemals aufgrund politischer Überlegungen getroffen.
4 Akkreditierung beinhaltet ein binäres Element, welches entweder positiv oder negativ ist.
Ganz wesentlich bei der Unterscheidung zwischen Akkreditierung und anderen qualitätssichernden Maßnahmen ist der vierte Punkt, denn am Ende jeder Akkreditierung wird von der durchführenden Agentur ein Zertifikat (Qualitätssiegel) ausgestellt (oder nicht), das darlegt, ob die untersuchte Institution die jeweiligen Standards erfüllt oder nicht, wobei theoretisch die Möglichkeit besteht, dass dies auch mit Auflagen erfolgt und die betreffende Institution die geforderten Nachbesserungen innerhalb einer bestimmten Zeit durchzuführen hat (vgl. HRK 2007:11).
2.3.2.4 Evaluation
Neben den drei bereits genannten Maßnahmen zur Qualitätsoptimierung setzte sich an europäischen Hochschulen seit den 1980er Jahren vor allem eine weitere Methode durch: die Evaluation. Der Terminus Evaluation wird in der Literatur, wie u.a. Gollwitzer/Jäger (vgl. 2009:XI) und Stockmann (vgl. 2010:9) feststellen, geradezu »inflationär« verwendet, und es ist daher in jedem Fall ratsam, darauf zu achten, in welchem Kontext er jeweils wie verwendet wird, bzw. explizit darzulegen, was man selbst meint, wenn man von Evaluation spricht (siehe Kapitel 3).
Im Kontext der universitären Qualitätsverbesserung und -sicherung spricht man verwirrenderweise in zumindest zweierlei Hinsicht von Evaluation: Einerseits als Hyperonym für sämtliche qualitätssichernden Maßnahmen wie Audit, Akkreditierung und Benchmarking, die alle unterschiedliche Evaluationsverfahren sind. Zum anderen wird Evaluation selbst auch als spezielle Methode dieser Verfahren gesehen, was die exakte Unterscheidung oft erschwert. Bei letzterem handelt es sich im Wesentlichen um die Evaluation von Studium, Lehre, Forschung, Verwaltung und Dienstleistungen (vgl. Mittag 2006:2), und man spricht beispielsweise von der Evaluation eines (Studien-)Faches (evaluation of a subject), eines Studienganges/Programms (programme evaluation) oder eines Institutes (institutional evaluation) etc.
Obwohl es in der Evaluationsforschung unterschiedlichste Evaluationstheorien, -ansätze und Modelle gibt (einen Überblick bieten Balzer 2005: Kapitel 4 bzw. Rindermann 2009:12ff), spricht man im Zusammenhang mit Evaluationsverfahren an Hochschulen zumeist von einem sogenannten mehrstufigen Verfahren, welches aus einer internen und einer externen Evaluation, der Veröffentlichung eines Evaluationsberichts und dem sogenannten Follow-up besteht, welches als die Phase der Umsetzung der Evaluationsergebnisse betrachtet werden kann.
Die interne Evaluation ist ihrem Wesen nach eine Selbstevaluation, eine »kritische Bestandsaufnahme durch ein Fach/einen Fachbereich bezüglich des Geleisteten« und in der »externen Evaluation wird dies durch Gutachter (Peers) überprüft« (HRK 2007:7). Die interne Evaluation wird mit einem Bericht (Selbstreport) abgeschlossen, welcher den externen EvaluatorInnen als Basis für ihre Untersuchung dient. Nach einer – üblicherweise zweitägigen – Vor-Ort-Begehung fassen die Peers ihre Empfehlungen und Anregungen in einem schriftlichen Gutachten zusammen (vgl. HRK 2007:7f), welches in der Regel veröffentlicht wird und den eigentlichen Evaluationsprozess beendet. Im Anschluss daran folgt das Follow-up, welches, wie Mittag (vgl. 2006:9) festhält, in den Händen der evaluierten Hochschule liegt und bis dato wenig untersucht wurde (vgl. ibid.:24).
Wie oben bereits kurz angeführt, kann Evaluation als Methode der Qualitätsverbesserung und Qualitätssicherung nicht nur in den verschiedensten Bereichen der Hochschule eingesetzt, sondern auch auf unterschiedliche Weise durchgeführt werden. So kann sie beispielsweise summativ, zur Bewertung von Ergebnissen oder formativ, zur Begleitung und Beratung Verwendung finden. Je nachdem, welche Ziele mit einer Evaluation verfolgt werden, sind unterschiedliche Evaluationstypen und Abläufe zu nennen.
Evaluiert kann grundsätzlich alles werden, von einzelnen Lehrveranstaltungen, Studienrichtungen, über Lehrgänge bis hin zur Universität als Ganzes. Ergebnisse sind dann neben Evaluationsberichten und eventuellen Veränderungen z.B. auch Universitätsrankings, wie etwa die oben genannten vom Magazin Times Higher Education. Die Bandbreite, wie, was und wann evaluiert wird, ist dabei sehr unterschiedlich, ebenso wie potenzielle Schritte und Entscheidungen, die nach der Evaluation getroffen werden.
Nachdem die Institution Universität primär der Gewinnung und Bewahrung von Erkenntnis und der akademischen Bildung und Ausbildung von Studierenden dient (vgl. Rindermann 2009:24), wird neben der Forschung in erster Linie auch die Qualität der Lehre evaluiert. Obwohl allein die Nennung von Evaluation, Qualität und Lehre in einem Atemzug an sich bereits oftmals für explosiven Diskussionsstoff sorgt, der mehrere Bände füllen könnte, so haben sich dennoch Methoden etabliert, die darauf abzielen, die Qualität der Lehre zu messen bzw. zu optimieren. Als eines der wichtigsten (vgl. Alphei 2006:7) aber zugleich auch eines der umstrittensten Verfahren (vgl. z.B. McKeachie 1997), welches hierzu eingesetzt wird, gilt die Evaluation von Lehrveranstaltungen durch Studierende (student ratings), die das Herzstück dieses Buches darstellt. Dass bei der Messung von Lehrqualität auch immer wieder Fallstricke zu finden sind, darauf weist Wolbring (2013) im Detail hin.