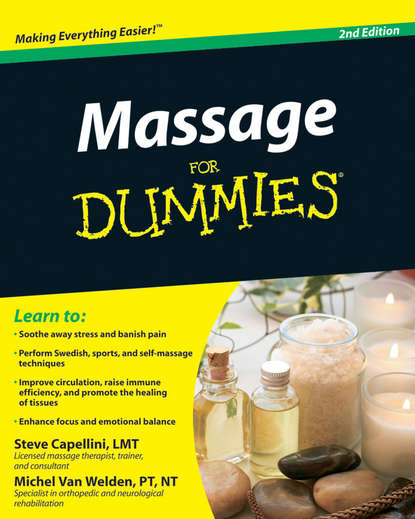- -
- 100%
- +
Randi hatte einen Spitznamen bekommen. Sie nannten sie »Strickbündel«. Beschuldigten sie, dass sie sich für belesen und klug hielt …
Sie war ihre ganze Kindheit in der Stadt in die Schule gegangen und hatte ansonsten rein gar nichts ausgerichtet, dann hatte sie Gunnar geheiratet und schlechte Nerven bekommen, weil er zur See fuhr. Eine Frau mit schlechten Nerven war schlimmer als alles andere. Sie war doch eigentlich unerträglich.
Die Dame sei so sonderbar, wie man nur sein könne, hatten sie mehr als einmal in Ottars Laden gesagt.
Tora kümmerte sich nicht um das Geschwätz. Sie hatte gemerkt, dass die Leute über alles redeten. Was die Leute sagten, war nicht so gefährlich, das hatte sie gelernt. Was die Leute taten, war viel schlimmer.
Tora spürte die Geborgenheit in diesem Raum. Verschlang gierig und hungrig die belegten Brote, den Geruch und den Anblick des Raumes. Sie ließ Randi reden und nickte nur und hörte mit weit offenen Augen zu. Das Gesicht Randi zugewandt – die ganze Zeit. Als ob sie Angst hätte, dass alles verschwinden könnte, wenn sie sich nur einen Augenblick umdrehte.
»Denk dir, ich bekomm eine ganz große Küche für mich allein, wenn wir da raufziehn. Sie ist so groß. Das kannste dir nicht vorstellen. Die Strickmaschine hat Platz unterm Fenster. Oh, es wird schön! Du musst kommen. Du musst oft zu uns kommen, Tora!« Sie schwieg einen Augenblick. Dann sagte sie traurig: »Der Frits glaubt, dass du wegen irgendetwas auf ihn böse bist … weil du nicht mehr gekommen bist. Aber ich hab ihm gesagt, dass das wegen dem Brand ist. Ja, ich sag’s dir gradheraus, Tora. Ich hab ja verstanden, dass du genug mit dir selbst zu tun hattest. Das war ja eine furchtbare Aufregung. Es hätt dir erspart bleiben sollen. Kinder sollten vor so was bewahrt bleiben.«
Tora saß wie gelähmt. Ihre untere Gesichtshälfte arbeitete nicht. War zu nichts zu gebrauchen. War erstarrt. Und Randi sah ihr in die Augen, und Tora wagte nicht auszuweichen. Konnte nicht ausweichen. Sie sahen einander an. Tora fühlte, dass ihr Gesicht alle Farbe verlor. Sie erstickte fast.
Randi hatte in eine Eiterbeule gestochen. Und die lief aus. All das Ekelhafte. Denn Randi hatte von dem Brand gesprochen, als ob er ein alltägliches, bedauerliches Ereignis wäre, das man schon am nächsten Tag in Ordnung bringen könnte. Und sie redete immer weiter darüber. Sagte, dass Henrik nicht der Erste sei, der im Gefängnis gelandet sei. Tora solle es sich nicht zu Herzen nehmen. Sie solle sich sagen, dass sie nur für sich selbst verantwortlich sei und dass sie nichts mit dem Brand zu tun habe. Randi kam Tora wie ein echter Engel vor, sie spürte es so deutlich, dass ihre Augen glänzten und sie nicht mehr schlucken konnte. Dann aber war das alles ganz plötzlich vorbei, denn Randi sagte: »Aber an etwas musste denken! Du musst ihn gut aufnehmen, wenn er wieder heimkommt. Er muss von neuem anfangen. Alle müssen neu anfangen, wenn sie ein Unrecht begangen haben. Es war natürlich sehr schlimm. Aber wir haben alle Verantwortung füreinander. Es gibt so vieles in der Welt, was wir einfach nicht verstehen können.«
Tora saß nur da.
Es war schön warm im Raum, die Brote schmeckten gut und Randi war eine Freundin. Trotzdem war Tora bei einer Fremden, die nichts wusste und nicht wissen durfte. Randi und Mama! Simon und Rakel!
Die ganze Welt würde sie – Tora – verdammen.
»Du sollst ihn gut aufnehmen. Du sollst niemanden in Verruf bringen. Du sollst denen Gutes tun, die … du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren … du sollst nicht lügen … Du sollst ihn gut aufnehmen!«
Die Mutter sagte nie etwas. Man konnte es ihr nur vom Gesicht ablesen. Randi sagte es. Geradeheraus. Direkt und fromm wie alle anderen Bibelworte, die sie in der Schule oder bei Elisif gelernt hatte. Aber konnte man mit ihnen leben, ohne zu lügen oder zu verschweigen? Tora wusste nicht ein noch aus. War das alles von Leuten erfunden worden, denen so etwas nicht passieren konnte? Die nichts begriffen? Wussten die Menschen, die Gesetze und Vorschriften machten, wie grauenhaft das alles war? Machten sie nur Gesetze für Dinge, von denen sie selbst nicht berührt wurden? War es so einfach?
Sie fühlte einen kleinen Trotz in sich. Aber sie konnte ihn nicht groß genug werden lassen – nicht richtig. Denn Randi war beinahe ein Engel. Und Tora saß hier doch vor Randis Augen.
So war es immer. Die Mutter war schweigsam und traurig. Sie war so müde und ernst. Sie hatte gegen so vieles anzukämpfen. Sie musste geschont werden.
Mussten alle geschont werden? Gab es keinen Menschen, der …?
»Ich hab noch was, das muss ich dir zeigen, Tora!«, sagte Randi plötzlich und schlug die Hände zusammen. Die dichten, hellen Wimpern flatterten und warfen Schatten auf ihre Wangen. »Du meine Güte! Wie konnt ich das vergessen! Ich bin doch so stolz darauf.«
»Was ist es denn?« Tora war gespannt und froh – dass von etwas anderem die Rede war.
»Nun kannste raten. Das rätste nie!«
»Ich will’s versuchen.«
Tora gab sich dem neuen munteren Spiel hin. Nur mit Randi konnte sie solche Wortspiele und solchen Unsinn machen, ohne daran denken zu müssen, dass sie erwachsen war. Nicht einmal mit Tante Rakel konnte sie so gut spielen und Unsinn treiben. Randi war eine erwachsene Frau, aber das vergaßen sie alle beide. Vergaßen es immer wieder. Es sah so aus, als ob Randi sich für ein kleines Mädchen hielt.
»Ha – wenn du das rätst, dann biste gut!« Randi zwinkerte verschmitzt. »Aber ich werd dir helfen. Es ist etwas, was sich alle wünschen. Ich hab’s bekommen.«
»Alle wünschen es sich …«, wiederholte Tora und schaute gleichsam in sich hinein.
»Na ja, nicht alle. Nicht die Männer, die kommen auch ohne das aus, denn sie haben ja uns«, lachte Randi.
Tora wurde noch verwirrter. »Dann muss es was sein, was du anziehen kannst oder womit du dich schön machst?«
»Nee, du.«
»Ist es dann vielleicht was, was du für die Strickmaschine brauchen kannst?«
»Wünschen sich alle etwas für die Strickmaschine, du Dummerchen?«
»Neee, dann muss es … lass mich mal überlegen … Du hast mir den elektrischen Herd gezeigt …«
»Heiß, heiß!«, schrie Randi entzückt. Aber Tora gab auf. Und Randi zog sie mit sich hinunter in den feuchten Keller, wo sie einen Raum neben der Köderstube hatten. Es stank nach Fischabfällen und Schimmel, obwohl der Raum abgespritzt und aufgeräumt war. In der einen Ecke stand eine Art Tonne. Sie stand auf zwei soliden Klötzen. Dickbauchig und breit. Sie ähnelte einer Wassertonne – so wie Almar eine besaß und die er immer noch aus der Quelle hinter dem Haus auffüllte, weil er im Haus keine Wasserleitung hatte. Obenauf lag die gleiche Art Deckel.
Tora ging näher und schaute sich die Tonne an. Nun sah sie ein Kabel mit einem Stecker und einem Schlauch, der ganz unten befestigt war. »Was ist das denn?«
Randi lächelte. Dann sagte sie mit Stolz in der Stimme: »Das ist der Gunnar … Er ist ein Genie mit Maschinen und Schrauben und so was. Er hat mir eine Waschmaschine gemacht.«
»Eine Waschmaschine!«
Tora staunte. Randi hob den Deckel hoch und zeigte ihr eine Art Schaufelrad – oder Propeller unten am Boden. Es war alles deutlich selbst geschweißt. Aber blankgeputzt und schön, ohne eine Spur von harten, scharfen Kanten.
»Der Gunnar ist ein Genie! Der Dahl kann sich glücklich preisen, dass er einen solchen Chef für die Maschinen hat.«
Tora vergaß zu antworten. Sie steckte den Kopf tief in die Tonne hinein und sah sich alles genau an. So was! Randi hatte eine Waschmaschine bekommen! Tora kannte keine in Været oder jenseits der Moore, die eine besaß. Sie hatte natürlich schon davon gehört. Wusste, dass man Waschmaschinen kaufen konnte. Aber sie waren fürchterlich teuer und gänzlich unnötig und unterstützten nur das Schlaraffenleben der reichen Leute. Und die Frau Pastor – hatte ja die Kopftuch-Johanna – die brauchte also auch keine. Und jetzt hatte Gunnar eine für Randi gemacht!
»Du musst mir zeigen, wie das geht«, sagte Tora schnell. Und Randi steckte den Stecker ein. Dann schraubte sie den Schlauch an dem Wasserkran fest und drehte ihn auf. Nicht viel – aber so, dass das Wasser bis über die Schaufel stieg. Randi knipste einen schwarzen Schalter an, den Tora vorher nicht bemerkt hatte, und setzte ein Spritzen und Poltern sondergleichen in Gang. Schnell warf sie den Deckel auf die Tonne und ließ die Maschine eine Weile laufen und dröhnen. Tora war überwältigt. »Toll! Hat Gunnar das wirklich gemacht?«
Randi nickte strahlend.
»Aber die Mama sagt, dass das mit den Waschmaschinen Unsinn ist, denn sie machen die ganze Wäsche kaputt und waschen nicht sauber. Ist das wahr?«
»Nein, gar nicht. Jedenfalls nicht die, die Gunnar gemacht hat. Die Bettbezüge und die Laken … die werden wie Neuschnee. Sie kann auch kochen. Unten drin sitzt ein Heizelement.«
»Heizelement?«
Tora musste den Deckel noch einmal hochheben und hineingucken. Ein Spritzer traf sie auf der Nase, aber sie merkte es kaum. Randi konnte wirklich froh sein, dass sie so etwas hatte. Sie brauchte nicht in der feuchten Waschküche vom Tausendheim zu stehen, die nur dort einen Betonboden hatte, wo die Waschzuber standen und wo der Ausguss war. Das Übrige war Lehmboden, und es war feucht und kalt in dem Keller.
Im Winter war es schrecklich dort. Ingrid kochte die Wäsche dann oben in der Wohnung. Und Tora spülte sie unten im Keller aus. Sie fror schon, wenn sie nur daran dachte, wie eiskalt solche Nachmittage waren. Man wurde erst am nächsten Tag wieder richtig warm.
Im Sommer war es nicht so schlimm. Da nahmen sie Kaffee und Brote mit und zogen zum Fluss, die große Wäsche in einem Schubkarren oder auf dem Gepäckträger vom Fahrrad. Dann machten sie Feuer in den selbstgemauerten Feuerstellen und setzten die Waschkessel darauf. Wer zuerst kam, hatte die beste Feuerstelle. So war es üblich. Und darüber machten sie nur Witze. Es waren immer viele zusammen, und es war gemütlich. Sie gingen auch nur an Schönwettertagen dorthin. Die Kinder wateten in der Flussmündung, bis die Wäsche kochte. Sie bekamen Kuchen und Brote aus fremden Proviantbüchsen und hörten zu, wie die Frauen sich unterhielten. Später halfen sie beim Spülen der Wäsche und wurden ausgeschimpft, wenn sie schluderten.
Aber das hier… das musste ja der Himmel auf Erden sein! Ach, wenn die Mutter und sie auch so eine Waschmaschine hätten! Da würden die Frauen im Tausendheim aber Stielaugen machen.
Als ob Randi ihre Gedanken lesen könnte, sagte sie mit einem verlegenen Lächeln: »Du darfst niemand etwas davon sagen …«
»Warum nicht?«
»Ich will nicht, dass die Leute sagen, ich sei faul und eingebildet … Sie reden schon genug.«
Tora nickte. Sie verstand. »Darf ich’s der Mama sagen?«
»Ja, sie gehört wohl nicht zu denen, die mit Klatsch von Haus zu Haus ziehen, wie ich mir denken kann.«
Randi sagte es lächelnd. Aber es gab Tora einen Stich. Wussten alle, dass die Mutter seit dem Brand beinahe menschenscheu geworden war? Redeten die Leute so viel, dass es sogar Randi erfahren hatte?
Tora brach dann doch ihr Versprechen und erzählte abends am Küchentisch Rakel alles. Sowie sie die ersten Wörter gesagt hatte, schämte sie sich schrecklich. Trotzdem musste sie weitererzählen.
Rakel hörte mit großen Augen zu, und Tora erklärte und zeichnete hinten in ihrer Kladde, um Rakel das Ganze deutlich zu machen.
Der Abend war so schön. Es war, als ob er sich auf sie, Tora, konzentrierte – sie nach vorne schob und sie zu etwas Großem machte. Rakel lauschte und lauschte. Tora erzählte. So lange, bis es Zeit war, schlafen zu gehen.
Da schämte sie sich wieder. Weil sie es nicht geschafft hatte, den Mund zu halten. Weil die Mutter zu Besuch in einem Gefängnis war.
Am nächsten Morgen platzte sie damit heraus, dass Rakel niemandem etwas über die Waschmaschine sagen sollte.
Und Rakel lächelte nicht einmal. Todernst gelobte sie hoch und heilig, dass es ein Geheimnis bleiben würde, warum die Bettbezüge bei den Monsens so weiß wie Schnee waren.
10
Tora bekam nicht viele Briefe.
Insgesamt waren es überhaupt nicht viele Briefe, die ins Tausendheim gebracht wurden. Es gab dort auch nicht viele Menschen, die sich die Mühe machten, Briefe zur Post zu tragen. Die Wörter waren einfach, und man sprach miteinander – oder man schwieg, und das sagte genug.
Wenn die Leute ruhig und nicht erregt waren, sagten sie gerade so viel, wie sie verantworten konnten – nicht mehr und nicht weniger. Der Rest wurde verschwiegen, bis die Gedanken ihn verdrängt hatten – oder der Mensch sich durch die Worte hindurchgekämpft hatte – schweigend. Und immer allein.
Eines Tages fand Tora einen weißen Briefumschlag auf dem Küchenschrank.
Die Mutter war zur Nachmittagsschicht gegangen. Das Haus lag träge in der Mittagsruhe, weil Tora auf dem Schulweg getrödelt hatte. War bei Jenny im Kiosk gewesen und hatte die neuen Illustrierten durchgeblättert. Jenny schimpfte nie mit Tora, weil sie die Zeitschriften nicht kaufte, die sie angesehen hatte. Alle anderen aber warf sie raus. Tora hatte lange gebraucht, bis sie sich Einlass in dem kleinen Kiosk an der Wegkreuzung verschafft hatte. Sie holte für Jenny Waren vom Hafen ab. Zog sowohl die Packen mit den Illustrierten als auch Jennys Kind im Handwagen die Hügel hinauf. Eigentlich konnte Tora den kleinen Rotzbengel nicht leiden. Aber sie ließ es sich nicht anmerken. Sie behandelte das Kind mit der gleichen freundlichen Vorsicht wie die Illustriertenbündel. Tora wusste nicht, ob sie vor dem Umschlag Angst haben sollte. Sie hatte das Gefühl, dass da etwas nicht stimmte. Name und Adresse standen feierlich auf dem weißen Papier. Einmal hatte sie einen Brieffreund gehabt. Einen, den Randi von ihrem Heimatort her kannte. Aber Ingrid hatte das viele Porto für eine unnötige Ausgabe gehalten. Sie wurde so trübsinnig – selbst wegen der kleinsten Ausgabe. Tora hatte immer seltener geschrieben. Dies hier war eine fremde Schrift. Aber doch bekannt. Der Stempel war unleserlich. Der Brief hatte eine norwegische Briefmarke. Das war das Erste gewesen, was sie festgestellt hatte. Manchmal war sie ganz sicher, dass ihr die Großmutter eines schönen Tages schreiben würde.
Sie sah sie vor sich, mit dem geraden Rücken und dem großen, grauen Knoten im Nacken. Knöpfschuhe. Wie die feinen Damen sie in den Märchen oder auf den Bildern in den Illustrierten trugen. Die Haut an den Wangen war ganz glatt. Aber dieser Brief kam nicht aus Berlin.
Er verursachte trotzdem ein wohliges Kribbeln unter der Haut. Es fing irgendwo am Hals an. Zog sich über den ganzen Körper, so dass sie lächeln musste, obwohl sie mutterseelenallein war. Stand auf einem Fuß und rieb den anderen an der Ofenkante, weil sie ein Loch in dem einen Stiefel hatte und der Fuß nass geworden war. Aber sie empfand es als nichts Besonderes. Sie rieb einfach, weil sie es immer tat, wenn sie nasse oder kalte Füße hatte.
Der Brief war von Frits!
Sie ging damit zum Fenster.
Frits erzählte von der Schule und den Lehrern. Dass er an den ersten Abenden dort geweint hatte.
Tora hörte beim Lesen Randis Stimme.
Und Frits wuchs aus dem Brief heraus. Vor ihren Augen. Sie dichtete ihn um zu einem unglücklichen Helden, sie bildete sich ein, dass sie alles verstand, was er ihr zu übermitteln versuchte, mit seiner eckigen Schreibschrift und den knappen, nüchternen Sätzen. Sie ahnte vage, was ein solcher Brief einen Jungen wie Frits kostete.
Unten in der Ecke war ein großer Tintenklecks, und Tora konnte sehen, dass er dort ein Herz zu zeichnen versucht hatte. Gott segne ihn …
Sie nahm den großen roten Buntstift, den sie benutzte, wenn sie für den »Konfirmanden« Karten zeichnen musste, und zog das Herz nach. Der Tintenfleck floss in seiner getrockneten Unförmigkeit darüber, das war allerdings schon passiert, lange bevor sie etwas geahnt hatte. Aber nun war da eine kräftige rote Linie, die durch den blauen Tintenfleck hindurch ganz deutlich anzeigte, wie das Herz hätte sein sollen. Tora war so froh. Ganz ausgelassen. Es war ein unbekanntes Gefühl, das sie nicht zügeln konnte. Alles – die ganze Welt bekam eine schöne Farbe. Sie lag grauschimmernd und närrisch dort draußen. Das Meer und der Mond strahlten, und Været lachte über das ganze Elend. Warm und vage und weich. Große Wolkenballen wälzten sich heran. Der Nachmittag begann seine Geräusche herauszuschleudern. Die Rufe vom Hof und später von dem Gelände rund um das Haus. Aber sie setzten sich nicht in ihr fest, zogen sie nicht hinaus auf die Straße wie sonst.
Tora war in Gedanken versunken. Die anderen, die so einfältig und klein waren, taten ihr direkt ein bisschen leid. Mit einem Mal war alles dort draußen ein überwundenes Stadium – über das sie sich hoch erhaben fühlte. Nein, sie hatte wichtigere Dinge zu tun. Einen Brief zu schreiben.
Nas-Eldar fuhr die letzten Kohlen für den Winterbrand ringsum in die weißen und blauen und roten Häuser. Es gab viele Bestellungen und viel Arbeit. Und es gab nur einen Lastwagen, den ausgenommen, den Dahl für seine Fischfabrik und die Frosterei besaß. Eldar hatte keinen Konkurrenten und nahm sich Zeit.
Die Leute fluchten nicht wenig, wenn er nicht einmal seinen Priem von der einen Seite auf die andere schob, um Bescheid zu sagen, dass er keine Zeit habe, sondern nur die rechte Autotür wieder zuknallte und hinüberrutschte auf den linken Sitz, weil man die Tür zum Fahrersitz von außen nicht öffnen konnte. »Das ist die Gicht«, grinste er mit seinem Gesicht voll bläulicher, einen Tag alter Bartstoppeln. »Im Herbst und in der Winterkälte ist er immer so!«
Er – war der Lastwagen, der nach der Meinung des Alten die feinsten Empfindungen auf der ganzen Insel hatte.
Nas-Eldar kam, wenn er kam – darauf konnte man sich verlassen. Eldars Auto fuhr Leichen und Brautleute. Er schmückte die Seitenteile mit Kreppstreifen und norwegischen Fähnchen und Laub, falls er Zeit dafür fand. Wenn er schlechte Laune hatte, dann stieß er zwischen den Zähnen hervor: »Könnt selber schmücken!« Er fuhr geschlachtete Schafe, Kohlen, Trockenfisch und Dung – ohne Schmuck. Er fuhr arme Leute – und feine Leute im Mantel. Eldars Auto war überall und nirgends aufzutreiben. Da half kein Betteln oder Drohen.
Aber Tora hatte keinen Bedarf an Lastwagen. Merkte nicht, dass die Kohle im Ofen ausbrannte. Trotzdem hörte sie den Krach da draußen und verstand mit einem kleinen, unwesentlichen und irdischen Teil ihrer selbst, was da los war.
Lange schaute sie angestrengt auf ihre eigenen Buchstaben. Dann entdeckte sie die Schatten. Die Dämmerung kroch aus allen Ecken. Stand schon im Küchenfenster. Tora schaltete die Deckenlampe ein. Das Licht flutete heftig und hell auf sie herab und warf ihren Schatten an die Wand. Aber sie sah jetzt.
Sie erzählte und dichtete. Viele Dinge brachen aus ihr heraus, die sie ihm nie hatte begreiflich machen können, während sie einander nahe waren und zusammen spielten oder auf dem Bett mit der Strickdecke saßen. Sie deutete an, dass sie den ganzen Sommer über mit allen möglichen Dingen sehr beschäftigt gewesen sei … Und während sie schrieb, begann ihr Körper zu schweben. Das Leben wurde so leicht.
Toras magere Hand suchte drinnen in der Stube in Ingrids Schublade, bis sie fand, was sie suchte: die kleine graue Schachtel mit dem Kleingeld für unvorhergesehene Fälle. Sie zählte das Geld für das Porto genau ab und tilgte alle Spuren.
Sie empfand keinerlei Reue. Zog nur den schwarzen Regenmantel über und sprang in die nicht mehr wasserdichten Stiefel. Sie hatte die Strümpfe nicht gewechselt, und das war gut. Es schwappte noch dort unten im linken Stiefel.
Turid am Postschalter hielt den Brief einen Augenblick in der Hand. Wog ihn gedankenvoll hin und her. Dann legte sie ihn energisch auf die abgegriffene Holzplatte auf Toras Seite von der Schranke zurück und sagte: »Zu schwer. Zu wenig Porto.«
Tora war ein nasser und geprügelter Hund, als sie zur Tür hinausschlich.
Aber auf der Treppe richtete sie sich auf, eilte über die Hügel und an den Mooren entlang zum Tausendheim.
Sie zögerte nicht. Sondern wiederholte die Aktion mit der Geldschachtel. Diesmal nahm sie so viel, dass es auf jeden Fall reichen musste. Dann raste sie die Treppen hinunter, die Wege entlang, die Hügel hinunter und hinein zu Turid am Schalter.
Wie ein Esel. Sie hatte Runzeln zwischen den Augenbrauen. Der Kopf war auf eine seltsam störrische Weise gebeugt, das Maul dicht an der Halsgrube – als ob sie versuchte, sich selbst voranzutreiben. Turid leckte an der Briefmarke und stempelte sie dann ab. Tora ging hinaus in den Regen.
Sie blieb einen Augenblick auf der Treppe stehen und wartete, bis der Schweiß an ihrem Rückgrat sich beruhigte. Fischerboote kamen herein. Sie tuckerten wie Herzen. Wie ihr Herz. Es gab keinen Unterschied. Tuck-tuck-tuck. Im Takt. Ganz selbstverständlich. Lebendig. Trieb sich selbst voran mit seinem eigenen Motor.
11
Eines Tages schnappte Sol in Ottars Laden große Neuigkeiten auf. Nach Neujahr sollte ein Handelsschulkurs beginnen. Da wollte sie hingegen! Mit der Mutter wollte sie nicht darüber sprechen. Sondern einfach hingehen.
Sol hatte die Erfahrung gemacht, dass man sehr schnell Geld verdienen konnte. Sie hatte es unter der Matratze. Dort lag es sicher. Denn Elisif gehörte nicht zu denen, die die Matratzen zu unpassender Zeit herausrissen, um sie zu lüften. Sol wusste, dass sie die Summe noch beträchtlich vermehren könnte. Alles Geld, das sie fürs Putzen bei Ottar und fürs Packen in der Fischfabrik bekam, gab sie zu Hause ab. Sie sortierte jeden Monat die dringendsten Rechnungen aus. Dann traf sie eine Auswahl, und zusammen mit Vaters Geld reichte es für das Allernotwendigste. Aber immer wieder gab es irgendwelche Löcher. Torstein quetschte sich ein paar Tränen heraus, weil sie Geld beisteuerte, und nannte sie ein prima Mädchen. Er hätte sagen können, dass bald bessere Zeiten kommen würden und dass sie dann etwas von ihrem nächsten Verdienst behalten dürfe. Aber das sagte er nicht. Torstein sagte nichts, woran er nicht glaubte. Deshalb war er ein so wortkarger Mann.
Es fing an einem ganz gewöhnlichen Tag nach Ladenschluss an. Sol war draußen im Lager auf die Leiter gestiegen, um ein paar Kartons an ihren Platz zu schieben, weil sie Angst hatte, dass sie ihr auf den Kopf fallen könnten. Sie sah Ottar neben der Leiter stehen, aber nahm keine Notiz von ihm. Bis sie seine Hand an ihrer Wade spürte. Sie erstarrte. Mehr aus Erstaunen als aus Abscheu. Er war bestimmt schon über dreißig. Fasste es als eine Ermutigung auf, dass sie stehen blieb. Die Hand bewegte sich erst zögernd. Dann hatte sie ihr Knie erreicht, kam aber nicht weiter, weil die Hand einfach nicht weiter reichte. Es war keineswegs unangenehm. Sol begriff. Da gab es vage Dinge, an die sie sich erinnerte. Dinge, die aus den Treppenaufgängen bis zu ihr gedrungen waren. Dinge über Ottar. Dinge über Männer.
Sol stieg vorsichtig eine Stufe tiefer. Aus Neugierde. Es war aber auch nicht unangenehm. Sie sah ihn nicht und spürte auch nicht seinen Atem. Spürte nur seine Hand. Sie verschaffte ihm mehr Platz, indem sie das eine Bein eine Stufe höher stellte. Hörte, wie er keuchte, trotzdem ging der Mann sie nichts an. Sie fühlte sich nicht bedroht. Sie hätte von der Leiter heruntersteigen, sich umdrehen und ihn auslachen können. Sie hätte ihm sogar drohen können. Ja! Denn davor hatte er Angst. Er hatte Todesangst. Und Sol stieg mehrmals in der Woche nach Ladenschluss in dem dunklen Lager auf die Leiter. Manchmal wünschte sie sich, er würde schnell fertig damit, was er da machte, denn sie wusste, dass zu Hause die Wäsche auf sie wartete.
Aber manchmal stand sie auch auf der Leiter und fand es sehr schön, dass jemand sie mit so behutsamen Händen anfasste. Dann war sie beinahe enttäuscht, wenn sie an seinem Atem hörte, dass das Ganze vorüber war und sie herunterklettern konnte.
Er sah sie nicht an, wenn er ihr das Geld gab. Er reichte ihr alles zusammen in einem Umschlag. Mehr als doppelt so viel, als ihr eigentlich zustand. Ottar war nett … Sie ging über die Hügel bis hinauf auf die Anhöhe und wieder hinunter zum Tausendheim, mit einem neu entbrannten, aber unklaren Willen in sich – während sie an das Geld dachte und daran, wie nett Ottar war. Sie hatte nicht geknickst, als sie das Geld entgegennahm. Sie war ja jetzt erwachsen. War sich bewusst, dass sie Selbstvertrauen haben konnte. Sie wusste etwas über Ottar. Das machte sie älter als ihn. Davon kam er niemals los. Und Ottar wusste das. Er brachte seine Haare in Ordnung und begab sich nach Ladenschluss in das dunkle Lager. Er war ein Mann, der seine einsamen, verborgenen Wege ging, und er hatte genügend Geld, um seine Spuren zu verwischen.