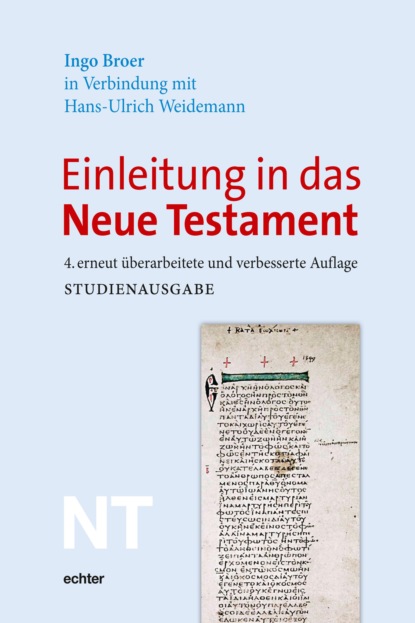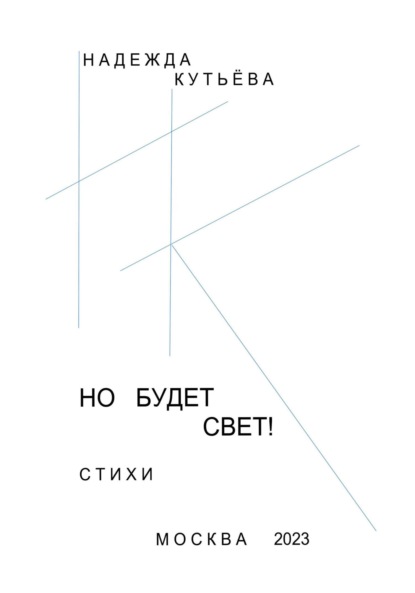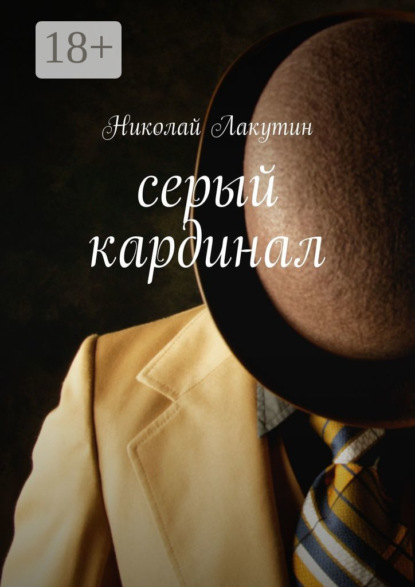- -
- 100%
- +
In dieser Hinsicht berühmt ist z. B. die Stelle Mk 7,31, die wirklich eine auffällige Zickzacklinie beschreibt, die man für die deutsche Geographie mit der Übersetzung verdeutlicht hat: „von Darmstadt über Frankfurt nach Mannheim mitten durchs Neckartal“ bzw., wenn man es lieber in europäischem Maßstab will: „von Madrid über Paris und Wien nach Rom“. Oder man hat auf Mk 5,1 hingewiesen, wonach Gerasa direkt am See Genesareth gelegen haben soll, was aber mitnichten der Fall war. Führen so eine Reihe von Angaben im Evangelium dazu, dem Verfasser eine gute Kenntnis der Geographie Galiläas abzusprechen, so traut man ihm aufgrund der falschen Reihenfolge in 11,1 – auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem kommt man erst nach Bethanien und dann nach Bethphage – trotz der zutreffenden Angabe von dem dem Ölberg gegenüberliegenden Tempel in 13,2 – auch keine Kenntnis der Geographie Jerusalems zu, so dass von daher gewichtige Argumente gegen den aus Jerusalem stammenden Johannes Markus als Verfasser unseres Evangeliums angeführt werden können.
Aber so eindeutig sind die aus diesen Stellen sich ergebenden Konsequenzen durchaus nicht, da wir kaum davon ausgehen können, dass auch die gebildetsten Menschen – und dass der Autor des zweiten Evangeliums zu diesen gerechnet werden muss, unterliegt keinem Zweifel! Es war nicht der schon in der Alten Kirche hochgeschätzte Matthäus, der die Literaturgattung Evangelium geschaffen hat, sondern Markus – damals alle zureichende geographische Kenntnisse hatten. Ein Einwohner Jerusalems muss nicht notwendig exakte Kenntnisse der Örtlichkeiten Galiläas gehabt haben, und aus der angeblich falschen Reihenfolge in Mk 11,1 kann man m. E. nicht einfach auf eine Unkenntnis der Örtlichkeiten Jerusalems schließen, da diese Stelle auch als bloße Aufzählung und nicht als exakte Reihenfolge gemeint sein kann. Wenn es noch eines weiteren Beweises bedarf, so kann darauf hingewiesen werden, dass sich ähnliche Rundstrecken wie in 7,31 auch sonst in der antiken Literatur finden, obwohl die Verfasser häufig weitgereist waren, um sich kundig zu machen und die genaue Kenntnis der Örtlichkeiten und Traditionen als wichtige Voraussetzung für ihre Arbeit nennen.
3.2.3 Die Beschreibung jüdischer Bräuche im Markusevangelium und der Autor des zweiten Evangeliums
Intime Kenntnis des Judentums?
Ob das gleiche Urteil auch für den Hinweis gelten kann, Markus lasse ein gewisses Unverständnis für jüdische Bräuche erkennen, z. B. wenn er in 7,3 alle Juden nur mit rituell gewaschenen Händen zum Essen gehen lässt, ist schwierig, weil sich hier zugleich die Frage nach dem Verhältnis des Markus zu seinem Material stellt. Fühlte der Verfasser des zweiten Evangeliums sich verpflichtet, alle Unschärfen, die seine Quellen enthielten, zu verbessern, wenn er sie erkannte? Steht hinter einer solchen Ansicht nicht eher das moderne, vor allem auf historische Exaktheit bedachte, der Antike bzw. zumindest den Evangelisten so aber gar nicht geläufige Denken? Anders wäre die Stelle freilich zu beurteilen, wenn Markus an dieser Stelle die erläuternden Bemerkungen selbst eingefügt hätte. Eine solche Unschärfe wäre einem Jerusalemer Judenchristen in seinen erläuternden Bemerkungen wohl kaum unterlaufen.
Ähnliches gilt m. E. für 10,12, wo Markus Jesus eine Scheidungsmöglichkeit auch für die Frau in den Mund legt, was damals im palästinischen Judentum nach unserer gegenwärtigen Kenntnis kaum möglich gewesen ist. Jedenfalls hat Josephus entsprechende Fälle deutlich als unjüdisch charakterisiert, und die in der Literatur angeführten Gegenbeispiele sind entweder spät oder von sehr begrenzter Aussagekraft. Auch im Blick hierauf wird man freilich nicht ohne weiteres die Verfasserschaft eines palästinischen Judenchristen ausschließen können, weil der Verfasser einfach die Praxis seiner Gemeinde wiedergeben kann, ohne auf ein historisches Wort Jesu und dessen jüdischen Kontext zu reflektieren. Der Verfasser hätte sich dann in dieser Hinsicht nicht anders verhalten als Matthäus, der in dieselbe Perikope eine Ausnahmeklausel einfügt, die sicher nicht von Jesus stammt.
Aber kann man sich in allen Fällen mit der Rückführung der Unschärfe auf die Tradition, die den Verfasser nicht besonders interessiert haben soll, helfen? Hätte ein jüdischer Autor z. B. Mk 14,12 schreiben können, wo der erste Tag (= 15. ► Nisan) des Festes der ungesäuerten Brote, das auch Juden mit dem Pascha gleichsetzen konnten, mit dem Rüsttag auf Pascha gleichgesetzt wird, zumal durch eine kleine Korrektur die Sache hätte richtig gestellt werden können? So sehr man für das einzelne Versehen gute Entschuldigungsgründe anführen kann, so sehr spricht deren Menge doch entschieden gegen einen palästinischen Judenchristen, wenn man nicht zu Konstruktionen greifen will, die etwa lauten: die große zeitliche und räumliche Distanz des Markus zum Judentum im Jahre 70 n. Chr. mache diese Ungenauigkeiten erklärbar.
3.2.4 Übersetzungen und ► Semitismen im Markusevangelium
Ermöglichen es so die geographischen Angaben und die Schilderung jüdischer Bräuche nicht, die Verfasserschaft des Markusevangeliums durch einen palästinischen Judenchristen definitiv zu kontrollieren und zu einer völlig eindeutigen Entscheidung zu gelangen, so sprechen alle Merkmale zusammen genommen doch eher gegen als für die Verfasserschaft eines palästinischen Judenchristen. Eine Kontrollmöglichkeit dieses Befundes könnte evtl. in den Semitismen (9,5;11,21;14,45: Rabbi; 10,51: Rabbuni; 11,9.10: Hosanna) und den Übersetzungen (3,17;5,41;7,11.34;15,22.34, vgl. auch die Erklärung des Rüsttages in 15,42) liegen – wenn diese, wie häufig angenommen wird, vom Evangelisten stammen, dann war er des Hebräischen und Aramäischen mächtig, dürfte also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus Palästina stammen. Aber auch hier ist vor voreiligen Schlüssen zu warnen. Besagt der in der Tat beobachtbare Rückgang der Semitismen vom Markus- zum Matthäusevangelium etwas über die Sprachkenntnisse des ersten und zweiten Evangelisten, oder geht dieser Rückgang einfach auf das Fortschreiten der Tradition und die zurückgehende Bedeutung des palästinischen Raumes für die Urchristenheit zurück?
Semitismen
Das Vorkommen der Semitismen stellt vor allem ein Problem dar, wenn man für die mündliche Phase der Überlieferung „die Vorstellung einer festen Ausdrucksebene“ nicht annehmen will. Dann muss man nämlich die Frage stellen, warum Markus, der offensichtlich damit rechnet, dass ein zumindest wesentlicher Teil seiner Leser / Hörer das entsprechende Wort nicht versteht, dieses Wort überhaupt bringt und es anschließend übersetzt, wenn er die ihm mündlich überlieferten Traditionen in der Regel so frei wiedergibt, dass man seine Vorlagen nicht mehr erkennen kann. So sehr man Letzteres (vielleicht schon angesichts der Divergenz der Urteile über die zugrundeliegenden Quellen) zugeben muss, so wenig lässt sich das Problem der Semitismen mit der Annahme eines sehr freien Wortlauts der Quellen lösen.
Man wird mit dem Hinweis auf die Semitismen umso vorsichtiger umgehen, als wir unglücklicherweise fast nichts über den Wechsel des Traditionsstoffes vom ursprünglich Aramäischen zum Griechischen wissen und diese Frage unberechtigterweise in der Forschung auch keine größere Rolle spielt. Der deutlich feststellbare Rückgang der semitischen Wendungen vom Markusevangelium über das des Matthäus und des Johannes zu dem des Lukas, welch letzterer solche überhaupt nicht mehr kennt, ist auch als Zeichen der Entfernung von der ursprünglich aramäischen Tradition zu verstehen, so dass die Tatsache, dass das älteste Evangelium sowohl absolut als auch im Verhältnis zu seiner Länge die meisten Semitismen enthält, in keiner Weise überraschen und keineswegs als Hinweis für eine semitische Muttersprache des Autors dieses Werkes interpretiert werden kann.
Übersetzungen
So bleiben allein noch die Übersetzungen – können sie Johannes Markus oder einen anderen Markus aus Palästina als Verfasser des Evangeliums retten? Aufgrund der gleichartigen Form ihrer Einleitung (3,17;7,11.34;15,42, vgl. auch 5,41 und 15,34), die auffälligerweise bei dem aus Palästina stammenden Juden Josephus nur ein einziges Mal begegnet und auch dort noch textlich unsicher ist (Ant. VII 3,2 § 67), kann man zu der Annahme neigen, diese müssten vom Endredaktor des Evangeliums stammen – aber eine über viele Zweifel erhabene Annahme haben wir damit nicht erreicht, da die Notwendigkeit, die in den zugrundeliegenden Traditionsstücken gebrauchten semitischen Termini den Zuhörern zu erläutern, auch schon vor der Integration dieser Stücke in das Evangelium bestand. Markus erhielt diese Traditionen bereits in griechischer Sprache und es spricht auch nichts dafür, dass er sie erstmalig aus einer judenchristlichen Umgebung in eine heidenchristliche übertrug. Angesichts der Tatsache, dass die Texte mit Sicherheit nicht erst von Markus ins Griechische übertragen, sondern schon längere Zeit in Griechisch überliefert wurden, ist es in keiner Weise einzusehen, wieso erst Markus die Notwendigkeit einer solchen Übersetzung empfunden haben soll, während in der Überlieferung vorher diese fremdsprachigen Termini unübersetzt geblieben sein sollen. Genau die gegenteilige Annahme ist wahrscheinlich. Die gleiche sprachliche Einleitung dieser Übersetzungen im Werk des Markus mag dann durchaus auf Markus zurückgehen, die eigentliche Übersetzung des Textes wird aber nicht von ihm stammen.
Das Ergebnis unserer Überlegungen ist nicht zwingend. Die Gesamtheit der vorgetragenen Argumente weist aber in dieselbe Richtung: Der Verfasser des zweiten Evangeliums ist kein aus Palästina gebürtiger Judenchrist gewesen. Deshalb kommt der gelegentlich als Verfasser in Aussicht genommene Johannes Markus der Apostelgeschichte nicht in Frage.
3.3 Die Bedeutung einer evtl. Augenzeugenschaft des Verfassers für das Verständnis des Markusevangeliums
Augenzeugenschaft und die li terarische Eigenheit der Evangelien
So schön es im übrigen wäre, wenn wir den Verfasser des Markusevangeliums genauer bestimmen könnten, so sehr muss doch auch darauf hingewiesen werden, dass selbst dann, wenn der Jerusalemer Zeuge der ersten Stunde, Johannes Markus, mit Sicherheit als Verfasser erwiesen werden könnte, damit unsere Erkenntnisse über die Evangelien und die Einsicht in ihren literarischen Charakter nicht verändert würden.
Wir hätten auch dann weiterhin davon auszugehen, dass unsere Evangelien, also auch das des Markus, auf Tradition beruhen, die lange Zeit mündlich überliefert wurde und an den Gesetzmäßigkeiten solcher Überlieferung teilhatte, und dass das Ziel der Evangelien nicht historische Belehrung, sondern Stärkung und sekundär auch Weckung des Glaubens war.
Die historische Glaubwürdigkeit des zweiten Evangeliums würde durch eine Zuweisung an den aus Jerusalem stammenden Johannes Markus keineswegs verstärkt.
3.4 Ein unbekannter Markus als Verfasser des zweiten Evangeliums?
Gründe für die Entstehung des Papiaszeugnisses
So überzeugend die Hinweise aus dem zweiten Evangelium gegen die Verfasserschaft des Johannes Markus aus Jerusalem insgesamt sind, so sehr leiden diese Einwände daran, dass sie die Entstehung der Zuweisung dieses Evangeliums an Markus, den Dolmetscher des Petrus, in der Alten Kirche nicht erklären können. Diese Tradition muss ja ihren Grund haben. Angesichts dieses Mangels muss die Frage gestellt werden, ob sich nicht wenigstens noch ansatzweise Gründe finden lassen, die zum Zeugnis des von Papias überlieferten ► Presbyters Johannes geführt haben und die dessen Entstehung verständlich machen können.
Petrus und Markus (zu IPetr 5,13)
Wir können diese Frage nicht im Detail beantworten, aber wir stehen auch nicht völlig ratlos vor ihr. Denn Petrus, Rom und Markus werden auch schon in dem zweifellos nicht von Petrus stammenden Ersten Petrusbrief zusammengebracht. Da dieser Brief ► pseudepigraphisch (d. h. unter falschen Namen) geschrieben ist, der Verfasser sich also die Autorität des Petrus leiht, um seinem Schreiben größere Durchsetzungskraft zu verleihen, muss hinter der Erwähnung in 1 Petr 5,13 die Kenntnis eines engen Verhältnisses zwischen Petrus und seinem „Sohn“ Markus stehen. Dieser Markus muss der Gemeinde des anonymen Verfassers des Ersten Petrusbriefes und den Gemeinden der Empfänger dieses Briefes nicht notwendig bekannt gewesen sein, aber dass Petrus einen „Sohn“ – in welchem Sinne auch immer – mit Namen Markus gehabt hat, setzt dieser Text als weithin verbreitete Tatsache voraus. Alles andere würde dem gewählten pseudepigraphischen Charakter des Schreibens widersprechen und wäre insofern kontraproduktiv.
Wenn dieser Markus mit dem Johannes Markus der Apostelgeschichte und insoweit mit dem Markus der paulinischen Tradition identisch ist, wissen wir nicht, wann dessen Wechsel von Paulus zu Petrus erfolgt ist. In jedem Falle aber haben wir in 1 Petr 5,13 ein Zeugnis der Verbundenheit von Petrus und einem Markus, das entweder das Zeugnis des Presbyters veranlasst haben könnte oder aber mit diesem auf einer gemeinsamen Tradition beruht.
1 Petr 5,13 bezeugt, dass die Verbindung zwischen (einem) Markus und Petrus schon vor Papias bekannt war. Das relativiert die Bedeutung des Papiaszeugnisses für die Verfasserfrage des Markusevangeliums erheblich.
Woher der Presbyter seine über 1 Petr 5,13 hinausgehenden Kenntnisse hat, lässt sich nicht mehr erkennen. Der dargestellte apologetische Charakter der Nachricht des Presbyters jedenfalls spricht nicht gerade dafür, dass wir es hier – was die Behauptung des Papias, Markus sei der „Dolmetscher“ des Petrus gewesen, angeht – mit einer historisch zutreffenden Überlieferung zu tun haben.
Der Autor des Markus Evangeliums ist unbekannt. Er trägt nach der altkirchlichen Tradition den Namen Markus. Dieser Name wird auch in der Neuzeit weiterhin für den anonymen Verfasser gebraucht.
Die Frage, ob der Verfasser ein Heiden- oder Judenchrist war, werden wir zusammen mit dem Problem der Zusammensetzung seiner Gemeinde erörtern (s. u. Nr. 5).
4. Die Abfassungszeit des Markusevangeliums
4.1 Die Nachrichten aus der Alten Kirche
Man kann auch die Erörterung dieses Problems mit Hilfe der Nachrichten aus der Alten Kirche zu lösen versuchen, da es einige Nachrichten aus dieser Zeit gibt, nach denen das Evangelium entweder noch zu Lebzeiten des Petrus oder nach dessen Tod verfasst worden sein soll. Es besteht aber Einmütigkeit unter den Exegeten, dass mit Hilfe dieser Nachrichten, die im übrigen weitgehend von dem oben angeführten Papiastext abhängig sein dürften, zu keiner weiteren Klarheit über die Abfassungszeit des Evangeliums zu gelangen ist.
4.2 Die fortgeschrittene Entwicklung des Materials
Markus und Q
Einige allgemeine Beobachtungen führen zu einer nicht zu frühen, aber auch nicht zu späten Ansetzung. So weist die in dem Markus-Stoff erkennbare Weiterentwicklung gegenüber dem Stoff der Logienquelle Q (z. B. die Reflexion der Bedeutung des Leidens Jesu) auf eine spätere Abfassung als Q, die gegenüber den Evangelien des Matthäus und Lukas erkennbare, noch nicht so weit fortgeschrittene Entwicklung, dass z. B. von Kirchenordnung und Hierarchie noch nichts zu erkennen ist, auf einen zeitlichen Abstand zu diesen.
Der Trennungsprozess zwischen „Kirche und Synagoge“
Allerdings muss man mit solchen Parallelisierungen vorsichtig umgehen, da hierbei in der Regel eine ähnliche und gleichzeitige Entwicklung an allen Orten vorausgesetzt wird. Diese Annahme, die nicht einmal für die katholische Kirche des 19. Jahrhunderts passt, widerspricht aber den noch in den Evangelien erkennbaren Tatbeständen. Denn trotz eines in der Regel nicht als unerheblich angesehenen zeitlichen Abstandes zwischen der Abfassung des Matthäus- und des Johannesevangeliums haben beide die Trennung vom Judentum hinter sich und das Johannesevangelium erweckt den Eindruck, als säßen die Wunden dieser Trennung noch tief und wären noch nicht vernarbt. Die Trennung vom Judentum dürften die Gemeinden des Matthäus und des Johannes also durchaus zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt vollzogen haben, so dass der in den Evangelien sich jeweils spiegelnde Entwicklungsstand der Gemeinden nicht einfach nach dem Schema: „weiterentwickelt, also später“ gedeutet werden darf. Es ist vielmehr mit unterschiedlichen Entwicklungen in einzelnen Orten zu rechnen. Von daher sind die angeführten Vergleichsargumente mit Q und den ► Seitenreferenten des Markus nur mit Vorsicht zu verwenden.
Frühdatierung des Markusevangeliums?
Auf eine nicht allzu frühe Entstehungszeit weist Mk 10,35 ff. hin: die beiden Zebedäussöhne Jakobus und Johannes dürften zur Zeit der Abfassung des Evangeliums bereits gestorben sein. Da Johannes beim Apostelkonzil eine wichtige Rolle innehatte (vgl. Gal 2,9), scheiden die auch in jüngster Zeit wieder vertretenen Frühansetzungen des Evangeliums in den 30er oder 40er Jahren aus. Auch der Umstand, dass die Verkündigung des Evangeliums von Jesus bereits weltweit geschieht (Mk 13,10;14,9), dass das jüdische Gesetz kein grundsätzliches Problem mehr darstellt (Mk 7) und die Parusieverzögerung ebenfalls bereits ihre Spuren im Evangelium hinterlassen hat, wenn auch das Problem im zweiten Evangelium keineswegs so groß ist wie etwa im Matthäusevangelium (vgl. Mk 13,30;9,1;13,32 mit Mt 25,1–13), spricht gegen eine Frühansetzung. Gleichwohl lassen alle diese Hinweise einen weiten Spielraum für die Abfassungszeit des Markusevangeliums.
4.3 Die Endzeitrede Mk 13 und die Datierung des Markusevangeliums
Hier vermag nach einer auffälligen Übereinstimmung unter den Exegeten nur die sogenannte synoptische Apokalypse (Mk 13) zu weiterer Konkretisierung zu verhelfen und diese verweist auf eine Abfassungszeit des Evangeliums um die Zeit des Jüdischen Krieges. Konkret geht es um die Frage, ob der Text Mk 13 bereits auf das Ende des Jüdischen Krieges und damit auf die Zerstörung Jerusalems zurückschaut oder ob der Text Signale enthält, dass dieser Krieg noch Gegenwart ist.
Mk 13 und der jüdische Krieg
Über diese Frage dauern die Kontroversen seit Generationen an. Während die einen sich sicher sind, dass Mk 13,2 nur als vaticinium ex eventu, d. h. als eine fiktive Prophezeiung, die bereits auf das vorhergesagte Ereignis zurückblickt, zu verstehen ist, und der Verfasser des Markusevangeliums so bereits die Zerstörung Jerusalems kennt und voraussetzt, halten die anderen den Zeitpunkt der Zerstörung Jerusalems in Mk 13 noch für zukünftig, den Krieg aber für bereits in vollem Gange. Vergleicht man die Berichte des Flavius Josephus und des Dio Cassius über die Einnahme des Tempels und die Zerstörung Jerusalems, so legt sich die Annahme eines vaticinium ex eventu in der Tat nicht nahe, und es dürfte auch nicht von ungefähr kommen, dass Lukas das Motiv von Mk 13,2 erweitert und auf die ganze Stadt Jerusalem bezogen hat. Für die Bewertung dieses Tempelwortes spielt auch eine Rolle, dass entsprechende Weissagungen im Alten Testament und im Judentum zahlreich vorhanden sind (vgl. 1 Kön 9,7 f.;Jer 7,14;26,6.9.18;Mich 3,12;äHen 90,28). Vor nicht geringere Schwierigkeiten stellt die zweite zur Datierung des Markusevangeliums immer wieder herangezogene Stelle, Mk 13,14. Hier bereitet schon die Deutung erhebliche Probleme, weswegen auch hier nicht eindeutig ein vaticinium ex eventu zu identifizieren ist.
Krieg und Endzeit
Nimmt man aber den Bezug des Gesamttextes auf den Jüdischen Krieg wirklich ernst, d. h. führt seine Entstehung auf die Zeit des Krieges (66–70) zurück und beachtet die Unterscheidung zwischen Krieg und Endzeit, dann kommt es dem Text gerade darauf an, den Krieg noch nicht als das Ende, sprich die Wiederkunft Christi, anzusehen.
Ein vormarkinisches „Flugblatt“ in Mk 13?
Ist diese Deutung von Mk 13 zutreffend, so wird die Aufnahme dieser Rede bzw. ihrer traditionellen Teile – die einschlägigen Autoren rechnen in Mk 13 mit der Übernahme einer Vorlage, z. B. eines Flugblattes, durch den Evangelisten, wobei in diese Vorlage evtl. auch schon weiteres Traditionsmaterial, etwa aus der Zeit der Krise um die Aufrichtung der Statue Caligulas im Tempel von Jerusalem, eingegangen sein soll – in das Evangelium gut verständlich und diese setzt den Jüdischen Krieg voraus, wobei offen bleiben kann, wie weit der Krieg bei der Abfassung der Vorlage des Markus bereits gediehen war. Insofern Abfassung des Stückes und Abfassung des Evangeliums nicht dasselbe sind, wird zwischen beiden durchaus eine gewisse Zeitspanne liegen – die Vorlage musste von Jerusalem bzw. dessen Umgebung noch zu Markus gelangen! –, und bei der Abfassung des Evangeliums dürfte der Krieg dann in der Tat zu Ende gewesen sein, was den Nachvollzug der Aussage, der Krieg sei noch nicht das Ende der Welt, sicher erleichtert hat.
Es ist am einleuchtendsten, auch wenn eindeutige Hinweise in Mk 13 wie z. B. vaticinia ex eventu fehlen, mit einer Abfassung des Markustextes nach der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 zu rechnen. Diese Datierung wird gerade in letzter Zeit häufiger vertreten.
5. Der Abfassungsort des Markusevangeliums
5.1 Hinweise aus der Alten Kirche
Clemens und Irenäus als Zeugen für Rom
Die Abfassung des Markusevangeliums wird häufig nach Rom verlegt. Diese Annahme basiert wie die Zuschreibung des Evangeliums an Markus auf einer Nachricht aus der Alten Kirche, die direkt erstmals bei Clemens von Alexandrien (t vor 215) begegnet:
„Beim Evangelium nach Markus waltete folgende Fügung. Nachdem Petrus in Rom öffentlich das Wort gepredigt und im Geiste das Evangelium verkündet hatte, sollen seine zahlreichen Zuhörer Markus gebeten haben, er möge, da er schon seit langem Petrus begleitet und seine Worte im Gedächtnis habe, seine Predigten niederschreiben. Markus habe willfahrt und ihnen der Bitte entsprechend das Evangelium gegeben. Als Petrus davon erfuhr, habe er ihn durch ein mahnend Wort weder davon abgehalten noch dazu ermuntert.“ (Eusebius, Kirchengeschichte VI 14,6)
Da auch schon Irenäus von Lyon († um 200) die Petrus-Rom-Tradition kennt und Markus wie Papias als Schüler und Interpreten des Petrus bezeichnet (vgl. Haer. III 1,2, gr. überliefert bei Eusebius, Kirchengeschichte V. 8,2 f.), könnte auch er evtl. die Abfassung des Markusevangeliums in Rom voraussetzen. Zum Ausdruck bringt er dies direkt allerdings nicht. Auch im sog. anti-marcionitischen Prolog, der zwischen 160/180 und der Mitte des 3. Jahrhunderts entstanden sein dürfte, werden Petrus, Markus und Italien zusammen genannt. Die Romfrage ist auch deswegen von Bedeutung, weil es neuerdings einen gewissen Trend gibt, das Markusevangelium auf dem Hintergrund des römischen ► Kaiserkultes sozusagen als dessen Antityp zu lesen, was bei einer Abfassung in Rom natürlich wesentlich leichter wahrscheinlich zu machen wäre als bei einer Abfassung in Syrien.
5.2 Hinweise mit Hilfe der Sprache des Markusevangeliums
In der neueren Diskussion hat man diese Nachricht dadurch abzusichern versucht, dass man das Markusevangelium nach Latinismen durchforscht hat, und man ist dabei durchaus auch fündig geworden.
Die Latinismen als Hinweis auf Rom?
Worte wie Caesar, census (12,14 Vermögensschätzung, Volkszählung), centurio (15,39.44 f. Führer einer Zenturie), flagellare (15,15 auspeitschen), legio (5,9.15 Legion) und praetorium (15,16 Amtswohnung des Statthalters) begegnen bei Markus insgesamt auffällig häufig, sind aber wohl dennoch kein Beweis für die Abfassung des Markusevangeliums in Rom, da nicht nur die Latinismen, sondern auch die Prägung der markinischen Sprache durch das Hebräische und Aramäische deutlich sind und die Herkunft der Latinismen durch die Anwesenheit der Römer im Osten genügend erklärbar ist. Dafür, dass die Anwesenheit der Römer als Erklärung genügt, spricht, dass die meisten der genannten Worte auch als Lehnworte Eingang in die Sprache der Rabbinen gefunden haben. So fehlt bei den o. g. Worten in Bauer / Alands Wörterbuch zum griechischen Neuen Testament nur zu praetorium der Hinweis auf die Übernahme in die rabbinische Sprache.
Die Ambivalenz der Argumente wird im übrigen schön deutlich, wenn man sieht, wie Ebner in seiner Einleitung (171) in Mk 12,42 mit der Erwähnung der kleinsten römischen Münze, des Quadrans, das entscheidende Argument für eine Abfassung in Rom findet, während Theissen (Entstehung 79) gerade unter Verweis auf diese Stelle gegen Rom plädiert.
Massiv gegen Rom spricht m. E. aber der Umstand, dass Markus der erste ist, der in großem Umfang das mündlich in den Gemeinden umlaufende Material sammelt (was kleinere Vorgänger-Sammlungen nicht ausschließt, s. u. Nr. 7 und oben § 4 zur Logienquelle Q) und in den Zusammenhang eines Lebens Jesu bringt. Dafür war er auf eine gewisse Nähe zum Ursprung und zum Zentrum der Jesusbewegung angewiesen.