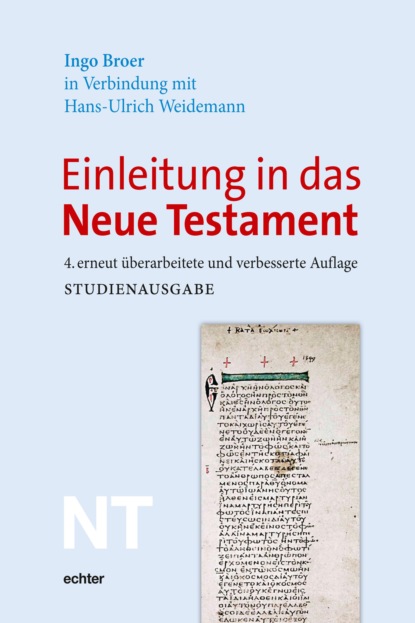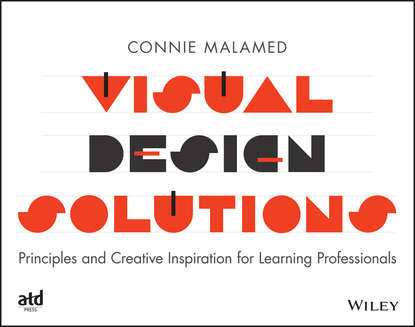- -
- 100%
- +
Nähe zum Ursprung der Jesusbewegung
Es ist kaum denkbar, dass die Traditionen, die in das Markusevangelium Eingang gefunden haben, allesamt schon um das Jahr 70 auch in Rom bekannt gewesen sind. Schon Paulus dürfte sie ja trotz mehrmaligen Aufenthaltes in Jerusalem nicht oder jedenfalls nicht viele davon gekannt haben, sonst hätten sich sicher mehr Spuren davon in den Paulusbriefen erhalten als die drei Herrenworte, auf die Paulus ausdrücklich Bezug nimmt (1 Kor 7,10 f.;9,14;11,23 ff.;[1 Thess 4,13 ff.]).
Auch eine deutlich noch vorhandene Nähe zum Judentum – jüdische Fragen spielen durchaus noch eine Rolle im Markusevangelium, vgl. z. B. 7,1–15 oder die Auseinandersetzungen mit den jüdischen Gruppen in den Streitgesprächen sowie die Nähe zum Jüdischen Krieg in Mk 13 – lassen es nicht geraten sein, das Markusevangelium zu weit vom jüdischen Mutterland entfernt entstanden zu denken, wenngleich die an der Erläuterung jüdischer Sitten erkennbare Ausrichtung zumindest auch auf Heidenchristen eine Entstehung in Judäa oder Galiläa ausschließt.
Das Markusevangelium erfordert die Annahme einer gewissen Distanz, aber zugleich einer gewissen Nähe zu Palästina. Diese beiden Bedingungen erfüllt am ehesten der syrische Raum, so unbefriedigend diese allgemeine Zuweisung ist. Das Markusevangelium dürfte also am ehesten in Syrien entstanden sein.
6. Die markinische Gemeinde
Gemeinde aus Juden- und Heidenchristen
Die gleichzeitige Distanz und Nähe zum Judentum – einerseits interessieren Fragen des Gesetzes noch so, dass die darum kreisenden Perikopen in das Evangelium aufgenommen werden, andererseits kommt aber eine gesetzestreue Haltung offensichtlich nicht mehr in Frage und Gesetzesbräuche müssen sogar erläutert werden – ist am ehesten als Hinweis auf eine aus Heiden-und Judenchristen gemischte Gemeinde zu verstehen, weil man andernfalls annehmen müsste, Markus habe die jüdische Gesetzesfragen behandelnden Perikopen allein aus historischem Interesse in sein Werk übernommen.
Zwar ist solches Interesse gerade bei Markus nicht von vornherein auszuschließen, weil zum einen die Sorge um den Verlust und das Zerredetwerden der Tradition ein wichtiges Motiv für die Abfassung seines Werkes gewesen sein könnte, und zum anderen keineswegs alle Züge in seinem Werk bzw. in den Einzelperikopen auf ein aktuelles Interesse zurückgeführt werden können, obwohl diese Behauptung dem gegenwärtigen Trend der Forschung eher zuwiderläuft. Aber die Übernahme einer Vielzahl von entsprechenden Traditionen spricht doch dafür, dass an ihnen auch ein Interesse in der Gemeinde des Markus bestand und dieses wird am ehesten in einer zumindest auch judenchristlich beeinflussten Gemeinde verständlich.
Der Vielzahl der im Einzelnen erörterten Ungenauigkeiten in palästinischer Geographie und jüdischen Bräuchen bei gleichzeitigem Interesse an diesen wird vielleicht am ehesten die Annahme gerecht, im Verfasser des zweiten Evangeliums einen heidnischen Frommen aus dem Umkreis der Synagoge, also einen früheren sog. Gottesfürchtigen, zu sehen, der für eine aus Juden- und Heidenchristen gemischte Gemeinde schreibt.
Der Evangelist und seine Gemeinde
Die Gemeinde des Markus hat sowohl die Traditionen, die er in seinem Evangelium verarbeitet, als auch den theologischen Standpunkt des Markus mit Sicherheit in erheblichem Maße beeinflusst, allerdings wird dies aller Wahrscheinlichkeit nach auch ein Vorgang auf Gegenseitigkeit gewesen sein. Inwieweit er bei seiner Arbeit vor allem seine eigene Gemeinde im Blick hatte, wissen wir nicht. Dass er auch für sie geschrieben hat, ist von vornherein wahrscheinlich, dass er ausschließlich für sie geschrieben hat, ist angesichts der literarischen Eigenart seines Werkes weniger naheliegend, was nun wiederum nicht meint, dass er sein Erzählwerk von vornherein als bevorzugtes Instrument der weltweiten Verkündigung des Evangeliums, von der er ja selbst zweimal spricht, angesehen hat.
Die angezielte Leserschaft
Da Markus sich entschieden hat, keinen Brief, sondern ein Evangelium zu schreiben, und dies mit Hilfe der in seiner Gemeinde umlaufenden und auch sonst erreichbaren Traditionen zu tun, kann er durchaus von Anfang an eine Leserschaft angezielt haben, die weit über den Rahmen seiner Heimatgemeinde hinausging, ja, angesichts der Tatsache, dass er der Erste war, der die Traditionen umfassend zu sammeln versuchte, kann die Absicht, ein Werk für die ganze Kirche zu schreiben, jedenfalls nicht von vornherein völlig ausgeschlossen werden. Denn das, was Markus für die Einzelperikope akzeptiert (Mk 14,9), könnte er durchaus auch auf sein Werk übertragen haben (Mk 13,10).
Die Perspektive des Markusevangeliums geht über die Gemeinde des Verfassers hinaus und schließt möglicherweise die ganze Kirche ein.
7. Der Markusschluss
Fortsetzung hinter Mk 16,8?
Die Bibelausgaben und-Übersetzungen bieten zwar hinter Markus 16,8 noch weiteren Text, es wird aber immer darauf hingewiesen, dass es sich dabei nach Ausweis der ► Handschriften um eine spätere Hinzufügung handelt, die im zweiten Jahrhundert entstanden sein dürfte, wenn auch ihre älteste textliche Bezeugung wesentlich jünger ist.
Dass auf die Flucht der Frauen vom Grabe Jesu keine Fortsetzung mehr erfolgt sein soll, ist nicht nur angesichts der Fortsetzungsberichte der ► Seitenreferenten, sondern auch innerhalb der Erzählung des Markus überraschend. Denn der Engel erteilt den Frauen im Grabe ausdrücklich den Befehl, die Jünger von der bevorstehenden Erscheinung des Auferstandenen in Galiläa in Kenntnis zu setzen, und auch der irdische Jesus hat in 14,28 auf ein Treffen nach der Auferstehung in Galiläa verwiesen.
Deswegen wurde im Laufe der Forschung immer wieder eine ursprüngliche Fortsetzung postuliert, die im Laufe des Überlieferungsprozesses verloren gegangen sein sollte, und es wurden auch immer wieder Rekonstruktionen dieses angeblich verlorenen Markusschlusses vorgelegt. Jedoch ist der Verlust eines Blattes in den ältesten ► Handschriften genau an dieser Stelle, wo ja die Perikope von der Auffindung des leeren Grabes mindestens zu einem gewissen Abschluss gekommen ist, sehr schwer zu erklären, zumal dieser Verlust schon sehr früh, zumindest vor der Abfassung des Matthäus- und Lukas Evangeliums, erfolgt sein müsste, da die Seitenreferenten hinter Mk 16,8 erkennbar eigene Wege gehen und offensichtlich in ihrer Mk-Quelle für diese Fortsetzung keinen Stoff mehr gefunden haben. Der an sich überraschende Schluss mit dem Ungehorsam der Frauen gegenüber dem Engelbefehl ist dann weniger überraschend, wenn man darauf achtet, wie sehr der Evangelist innerhalb seines Werkes Widersprüche zwischen Schweigen und Reden schafft (vgl. dazu unten 11.1.1)
Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass der ursprüngliche Text des Markusevangeliums mit 16,8 endete und dass der Ungehorsam der Frauen gegenüber dem Befehl des Engels vom Evangelisten bewusst gestaltet wurde. Ohne die auf die Erzählung von der Auffindung des leeren Grabes bei Matthäus und Lukas folgenden Erscheinungserzählungen hätte wohl niemand eine Fortsetzung des Markusevangeliums hinter 16,8 erwartet.
8. Die Quellen des Markusevangeliums
Welche Quellen dem Verfasser des Markusevangeliums schriftlich vorgelegen haben, ist nach wie vor umstritten, aber hinsichtlich einiger Kapitel gibt es doch weit verbreitete Zustimmung, dass Markus hier auf eine vormarkinische Sammlung zurückgreifen konnte.
Das gilt vor allem für die Sammlung der Streitgespräche in 2,1–3,6, für die Gleichnisse in Kap. 4, natürlich mit Ausnahme von 4,11 f., für das Spruchmaterial in 10,1–12.17–27.35–45 und Teile der Passionsgeschichte, wobei man sich in der Regel auf 14–16 beschränkt und der von R. Pesch u. a. in seinem Markus-Kommentar vertretenen Ansicht, Markus benutze bereits ab 8,27 ff. weitestgehend eine ihm vorliegende, sehr alte und aus der Jerusalemer Urgemeinde stammende Passionsgeschichte, nicht folgt. Darüber hinaus kommen auch die Wundergeschichten in 4,35 ff. und Teile der synoptischen Apokalypse (s. o. Nr. 4.3) als Teile vormarkinischer Sammlungen in Frage.
Selbst neuere Arbeiten, die die Einheitlichkeit des Stiles des zweiten Evangeliums und die daraus resultierende Schwierigkeit, die dem Evangelium zugrunde liegenden Quellen noch erheben zu können, betonen, gehen nicht davon aus, dass der Evangelist sein Werk ohne Quellen verfasst hat.
9. Das Problem des Urmarkus
Ur- oder Deuteromarkus
Auch heute noch wird in der Forschung, wie beim Problem der synoptischen Frage kurz erwähnt, gelegentlich die Annahme vertreten, nicht der Verfasser des uns heute vorliegenden Markusevangeliums habe als erster die Gattung Evangelium geschaffen, sondern er habe bereits einen Vorgänger gehabt.
Für diese Annahme stützt man sich vor allem auf die Übereinstimmungen zwischen den Evangelien des Matthäus und Lukas gegen Markus im mit dem Markusevangelium gemeinsamen Stoff (also auf die sog. „kleineren Übereinstimmungen“) und auf die sog. „große“ oder „lukanische“ Lücke im Lukasevangelium, in der Mk 6,45–8,26 ausgelassen sind und die Lukas in seiner Markusvorlage deswegen nicht gefunden haben soll.
Da jedoch auch die Urmarkus-Hypothese nicht in der Lage ist, diese kleineren Übereinstimmungen zwischen Matthäus und Lukas gegen Markus im mit Markus gemeinsamen Stoff, zu erklären und zudem das Urmarkus-Exemplar des Lukas von dem des Matthäus noch abgewichen sein muss, wenn die Urmarkushypothese das Fehlen von Mk 6,45–8,26 nur bei Lukas erklären soll, verzichtet man besser auf die Annahme dieser weiteren Unbekannten.
Dasselbe gilt, wenn man statt eines Urmarkus als Vorlage für die ► Seitenreferenten einen sog. Deuteromarkus, also eine veränderte Neuausgabe des Markusevangeliums, annimmt. Auch dessen Annahme hat sich, obwohl sie immer wieder und aufgrund des vehementen Eintretens von A. Fuchs vertreten wird, bislang nur gelegentlich durchsetzen können (s. dazu § 3 Nr. 6.2).
10. Die Sprache des Markusevangeliums
Der Zuschreibung des Werkes an einen gottesfürchtigen Frommen aus der Umgebung einer Synagoge widerspricht auch die Sprache des Evangeliums nicht. Wie schwierig das Griechisch des zweiten Evangeliums zu beurteilen ist, kann man an der unterschiedlichen Beurteilung seiner Sprachfertigkeit erkennen.
Unterschiedliche Beurteilungen der Sprache des Mk
Auf der einen Seite kann der Autor aufgrund seiner aus den Übersetzungen erschlossenen Hebräisch-/Aramäisch-Kenntnisse und mancher Eigenarten seines Sprachgebrauchs als in Palästina geborener Jude deklariert werden, andererseits kann er aber auch wegen seines im übrigen doch einigermaßen flüssigen, wenn auch gelegentlich als barbarisch bezeichneten und doch wiederum der Übersetzung der ► Septuaginta überlegenen Griechisch als schon lange in der griechisch sprechenden Diaspora lebend angesehen werden.
Nun finden sich aber eine ganze Reihe von Eigenarten des markinischen Griechisch durchaus auch in nicht semitisch beeinflusster Volksliteratur, und als semitisch beeinflusst geltende Sprach-Merkmale des zweiten Evangeliums lassen sich in nicht geringer Zahl ebenfalls in dieser Literatur nachweisen. Sprache, Komposition und inhaltliche Bearbeitung des Evangelien-Stoffes durch Markus sind im Verhältnis zum sicher nicht semitisch beeinflussten ► Alexanderroman sogar als feinfühliger und geschickter bezeichnet worden. Von daher ist die Zuschreibung des Markusevangeliums an einen Autor semitischer Muttersprache keineswegs mehr so sicher wie einige Zeit angenommen. Dies gilt umso mehr, als andere Autoren der Meinung sind, ein längerer Aufenthalt des Markus in Palästina genüge, um die Übersetzungen und Anklänge an ► Semitismen zu erklären, zumal wir auf die Notwendigkeit solcher Übersetzungen auch schon in der vormarkinischen Tradition hingewiesen haben.
Die Sprache des Evangelisten wird in der neueren Literatur als einheitlicher angesehen als früher, wo man noch die Zuversicht hatte, zwischen der Hand des Evangelisten und seinen Quellen unterscheiden und sauber zwischen Redaktion und Tradition trennen zu können.
Der Evangelist und seine Quellen
Diese Zuversicht kommt der Forschung aus mehreren Gründen immer mehr abhanden. Das hängt zum einen mit den großen Differenzen der Ergebnisse solcher Scheidungsversuche, zum anderen mit der Hoffnung zusammen, die synchronische Betrachtung des Textes werde einhelligere Ergebnisse liefern als die diachronische. In letzterer Hinsicht darf man sehr gespannt sein. Aber auch das Verhältnis des Autors zur mündlichen Tradition wird in der neueren Literatur anders beurteilt als zu Zeiten der klassischen Formgeschichte. Die mündlichen Erzählungen werden bei weitem nicht mehr als so fest in ihrer Form angesehen wie damals und dementsprechend die sprachliche Formung durch den Evangelisten weit höher angesetzt. Ob dem nicht unsere Überlegungen über das Mitschleifen der Übersetzungen hebräisch-aramäischer Termini widersprechen, wird weiter zu prüfen sein.
Die Sprache des Evangelisten spiegelt zwar einen gewissen semitischen Einfluss, aber dieser geht nicht so weit, dass man daraus mit Sicherheit auf einen Judenchristen als Autor schließen könnte.
11. Die theologische Absicht des Evangelisten Markus
Hauptintention: die Christologie
Die primäre Aussageabsicht des markinischen Werkes ist christologisch, so dass die Abschreiber, die schon früh dem Initium „Anfang des Evangeliums von Jesus Christus“ (1,1) die Ergänzung „dem Sohne Gottes“ anfügten, durchaus in der Linie der markinischen Absichten blieben, wenn der Titel im Initium nicht ursprünglich sein sollte. Es geht um ein zutreffendes Verständnis Jesu, von dem Markus an markanten Stellen seines Werkes als Sohn Gottes spricht, dessen Bedeutung aber allein mit diesem Titel keineswegs schon zutreffend und umfassend umschrieben ist.
Sohn Gottes
Selbst der Titel „Sohn Gottes“ allein ist noch missverständlich, da dieser nach Ausweis der von Markus übernommenen Traditionen schon in der Kirche des ersten Jahrhunderts unterschiedlich verstanden wurde. Dieser und andere Titel konnten in der Tradition mit Wundergeschichten verbunden werden, die Jesu Würde als Gottessohn oder Davidssohn / Messias zum Ausdruck bringen. Dieses Verständnis lehnt Markus nicht ab, aber er hält es für außerordentlich missverständlich und ergänzungsbedürftig, weswegen er dieser ► theologia gloriae eine weitere Dimension hinzufügt, die des niedrigen und notwendig ins Leiden gehenden Jesus.
Der Jesus der Wunder und der Jesus des Leidens gehören für den Evangelisten untrennbar zusammen. Eine einseitige Betonung nur einer dieser zwei Seiten wird dem Jesusereignis nach Ansicht des Markus nicht gerecht. Zu einem angemessenen Verständnis Jesu gehört dessen ganzes Schicksal.
Wie nicht nur ein Titel genügt, um den Glauben an Jesus zutreffend zum Ausdruck zu bringen, und Jesus deshalb in allen Evangelien, nicht nur bei Markus, eine ganze Reihe von Heilbringertiteln erhält, so können diese Titel unterschiedliche Inhalte umfassen, die nach Markus beim Titel Gottessohn zusammengehören und nicht getrennt werden dürfen.
11.1 Das Messiasgeheimnis
Bekenntnis vs. Schweigegebote
Um freilich sein genaues Verständnis dieses Jesus deutlich zu machen, ist Markus Wege gegangen, die bis heute für uns nicht ganz durchschaubar sind. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts spricht man über das von W. Wrede so genannte „Messiasgeheimnis im Markusevangelium“, womit der auffällige Widerspruch zwischen offenem Bekenntnis der messianischen Würde Jesu z. B. durch die Dämonen und das sich anschließende Schweigegebot von Seiten Jesu oder der Zusammenhang zwischen Jüngerbekenntnis und Schweigegebot in Mk 8,27–33 gemeint sind.
Eine theologische Konstruktion
Dass es sich hierbei um eine Konstruktion und nicht um die exakte Wiedergabe einer historischen Einzelheit handelt, wird schon bei der Perikope vom Töchterlein des Jairus deutlich, wo zunächst der Tod des Mädchens sozusagen vom ganzen Dorf beklagt und im Anschluss an die Totenerweckung von Jesus die Weisung erteilt wird, niemandem etwas davon zu erzählen (Mk 5,22–24.35–43).
Die Komponenten des Messiasgeheimnisses
Im einzelnen sind im Zusammenhang mit dem Messiasgeheimnis folgende Komplexe zu unterscheiden:
(a) das Verbot bei manchen Wundergeschichten, das Wunder weiter zu erzählen (5,43;7,36) – dazu gehört auch, dass dieses Verbot z. T. übertreten wird, vgl. 7,36 und 1,44 f.,
(b) das Wissen der Dämonen um Jesu besondere Würde und der dazu gehörige Schweigebefehl (1,25.34;3,12),
(c) Das Wissen der Jünger um die besondere Würde Jesu und das Schweigegebot (8,27–30;9,9) einerseits, das Unverständnis der Jünger gegenüber den Worten Jesu andererseits (4,13; 8,14–21),
(d) Die Parabeltheorie (4,10–12, siehe dazu 11.2)
11.1.1 Das Wissen um die besondere Würde Jesu und die Schweigegebote
Die ersten drei Komplexe kommen darin überein, dass die Verbreitung entweder eines christologischen Hoheitstitels, der von den Dämonen (5,43;7,36) oder den Jüngern (8,27–29) zur Sprache gebracht wird oder auf andere Weise bekannt wird (9,2–9), oder dass die Verbreitung eines von Jesus vollbrachten Wunders untersagt wird.
Funktion der Schweigegebote
Die literarische Funktion dieser Konstruktion kommt in ihrem künstlichen, eher für schriftliche als für mündliche Literatur bezeichnenden Charakter zum Ausdruck: Die Verbreitung des Wunders wird verboten, aber das Wunder und das entsprechende Verbot werden erst einmal erzählt.
Grenze der Schweigegebote
Auf der Ebene des Markus ist dieser Widerspruch kein Problem, weil er in 9,9 Tod und Auferstehung Jesu als Grenze für das Schweigegebot bezeichnet hat – danach darf offen darüber gesprochen werden!
Wunder und Leiden
Nimmt man Mk 9,9 zusammen mit dem Bekenntnis des unbekannten Hauptmannes unter dem Kreuz, der ausgerechnet angesichts des Todes Jesu zu der Erkenntnis kommt, dass der soeben Verstorbene kein normaler Mensch, sondern ein Gottessohn war (Mk 15,39), und zieht dann auch noch mit in die Betrachtung ein, dass Markus gleich drei Leidensweissagungen in seinem Werk bietet (8,30–33;9,31;10,32–34), dann wird deutlich, dass Markus unbeschadet der Frage, welche Teile des ganzen Komplexes er schon in seiner Tradition vorfand und welche er selbst geschaffen hat, bewusst die Wundergeschichten und die Perikopen um die Hoheitstitel überliefert, dass er diese aber mit Hilfe des Schweigegebots mit dem Leiden Jesu zusammengebunden hat. Zu Jesus gehören die Wunder und das Leiden, weil er der Messias und der leidende Menschensohn zugleich ist.
Die Vermutung, die Gemeinde des Markus habe in der häretischen Gefahr gestanden, Jesus ausschließlich von der Wunder- und Hoheitsseite zu sehen, geht sicher viel zu weit, aber Markus hat nach Ausweis seines Werkes – vgl. vor allem die Abfolge von 8,27–30 und 31–33! – beide Seiten in Jesu Person zusammenbinden wollen.
Nach Markus ist der Jesus der Wunder nicht ohne das Leiden, und der Jesus des Leidens nicht ohne die Wunder zu haben. Beide Aussagereihen, Wunder und Kreuz, dürfen für ein im Sinne des Markus zutreffendes Verständnis von Person und Werk Jesu auf keinen Fall voneinander getrennt werden.
Das Schweigen der Frauen
Dass das Verbot, die Wunder weiter zu erzählen, nach dem Evangelium nicht gehalten wird, hat seinen Gegenpart in dem das Markusevangelium beendenden Schweigen der Frauen nach ihrer Flucht aus dem leeren Grab, hier nun gegen den ausdrücklichen Engelbefehl an sie, Petrus und die Jünger von der Auferweckung Jesu und von seinem Vorausgehen nach Galiläa zu unterrichten.
Wie dort entgegen dem Befehl Jesu das Wunder nicht verschwiegen, sondern öffentlich verkündigt wird, so vermag auch hier die menschliche Unzulänglichkeit der Frauen das Offenbarwerden der Auferstehung nicht zu verhindern. Die Botschaft von Jesus, von seinen Wundern und von seiner Auferstehung, setzt sich durch, auch gegen alle menschliche Unzulänglichkeit. Wie Jesu Wunder nicht verborgen bleiben konnten, so auch seine Auferstehung nicht. Obwohl die Frauen nichts erzählt haben, ist die Auffindung des leeren Grabes dennoch bekannt, und Markus kann sie erzählen.
Dass Markus mit 16,8 zum Ausdruck bringen wolle, die Jünger seien nie von der Auferstehung in Kenntnis gesetzt worden, und mit Hilfe dieser „Nachricht“ seinen Wunsch, „die Aufmerksamkeit vom Auferstandenen weg zum Gekreuzigten zu lenken“ (Kelber, Anfangsprozesse) verdeutliche, scheint mir weder der Erzählung Mk 16,1–8 noch dem Gesamtduktus des Evangeliums zu entsprechen. Dieser betont gerade nicht einseitig das Leiden, sondern auch die wunderbare Seite des Gottessohnes.
Das Leiden der Jünger Jesu
Der Notwendigkeit des Leidens Jesu geht die des Leidens der Jünger parallel, wie Markus z. B. im Nachtrag zur ersten Leidensverkündigung deutlich macht (8,34 ff.). Markus illustriert auf diese Weise, was Matthäus mit Hilfe eines Wortes der Logienquelle so sagt: „Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Herrn.“ (Mt 10,24 f.)
Wie schwer die Akzeptanz dieser Notwendigkeit für die Jünger war und auch noch ist, zeigt Markus an der Reaktion des Petrus auf die erste Leidensansage und in Mk 10,35 ff.
11.1.2 Das Jüngerunverständnis
Das Jüngerunverständnis, das bei Markus mehrfach begegnet (4,10.13;6,52; 7,17 f. ;8,16–18.21 ;10,35 ff.) und nicht immer so betont ist wie in 4,13 ;7,17 f.; 8,17 f. und zu dem auch der Tadel des Petrus in 8,30 und das Unverständnis gegenüber der Notwendigkeit des Leidens in 9,32 gehören, soll keineswegs eine Distanz zwischen Jesus und seinen Jüngern schaffen, sondern hat zumindest eine doppelte Funktion:
Doppelfunktion des Jüngerunverständnisses
(1.) Zum einen macht das Unverständnis der Worte und Taten Jesu auf seiten der Jünger immer wieder deren besondere Belehrung durch Jesus notwendig (4,14 ff.;7,18 ff. ;8,19 f.), so dass sie nach Ostern in der Tat besonders qualifizierte Zeugen des Jesusgeschehens sind, auf deren Überlieferung der Worte und Taten Jesu Verlass ist.
(2.) Zum anderen stellt das Unverständnis der Jünger diese aber zugleich in eine Reihe mit den Lesern des Markusevangeliums – wenn diese nicht alles sofort begreifen, müssen sie sich darüber weder wundern noch sich schämen, den Jüngern des Herrn ist es ganz genauso gegangen.
11.2 Die Parabeltheorie
Gleichnisse zur Verstockung des Volkes?
Nach Mk 4,10–12 sind die Gleichnisse gerade keine Verständnishilfe für die Botschaft Jesu, vielmehr dienen sie der Verstockung des Volkes. Diese sog. Parabeltheorie zeigt deutlich, wie weit die Entwicklung der Tradition weg vom Ursprung im Markusevangelium bereits fortgeschritten ist, denn dahinter steht ja offensichtlich die Meinung, dass die Gleichnisse Jesu mit ihren doch einfachen und schlichten Bildern für das einfache Volk nicht verstehbar sind und dass man eines besonderen Schlüssels für deren Verständnis bedarf.
Dieses markinische Verständnis der Gleichnisse wird diesen selbst nicht gerecht. Man kann das schon daran erkennen, dass Markus trotz der von ihm übernommenen Parabeltheorie nur für ein Gleichnis eine Deutung mitüberliefert – von den anderen geht auch er offensichtlich davon aus, dass sie ohne Deutung für alle und nicht nur für die eingeweihten Jünger verstehbar sind. Darüber hinaus hat Markus mit der Parabeltheorie noch einen weiteren Widerspruch übernommen, gelten doch nach dieser Theorie die Jünger als mit einem besonderen Wissen begabt, während sie nach dem übrigen Evangelium als eher unverständig und besonderer Belehrung bedürftig erscheinen.
Gerade von diesen Spannungen her muss m. E. die Frage noch einmal genau geprüft werden, ob die Verfasser der Evangelien sich ihren Stoff so zu eigen gemacht haben, wie das vor allem in den letzten Jahren unter Einfluss der Redaktionsgeschichte und der synchronischen Analyse vertreten worden ist. Diese Frage ist m. E. auch dann zu stellen, wenn man in Markus nicht den konservativen Redaktor sieht, wie ihn v. a. R. Pesch in seinem Markuskommentar gezeichnet hat. Die Evangelisten können wesentlich mehr selbständige Autoren gewesen sein, als es die Formgeschichte angenommen hat, ohne dass sie sich mit allem und jedem, das sie aus der Tradition übernahmen, identifizierten, zumal bei Markus ja noch die kaum zu klärende Frage offen ist, ob nicht auch er schon, wie Matthäus und Lukas es dann für uns nachvollziehbar getan haben, Stoff aus dem ihm überkommenen Material weggelassen hat.