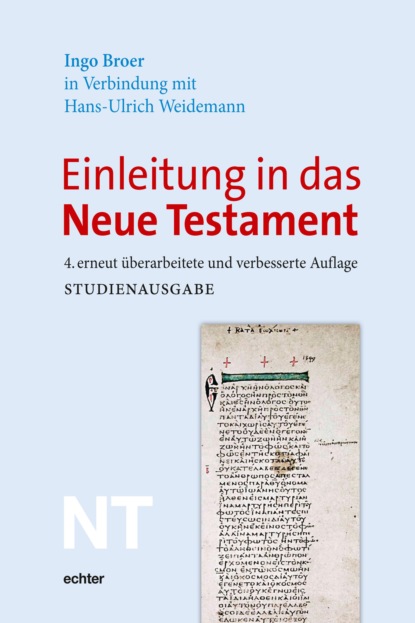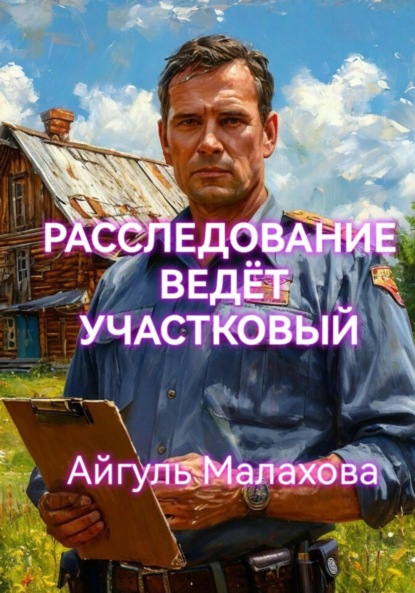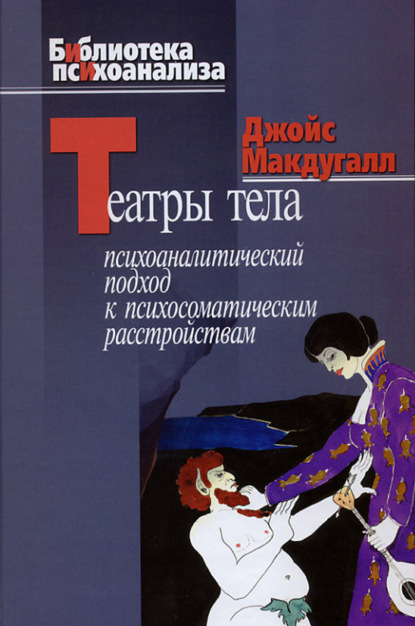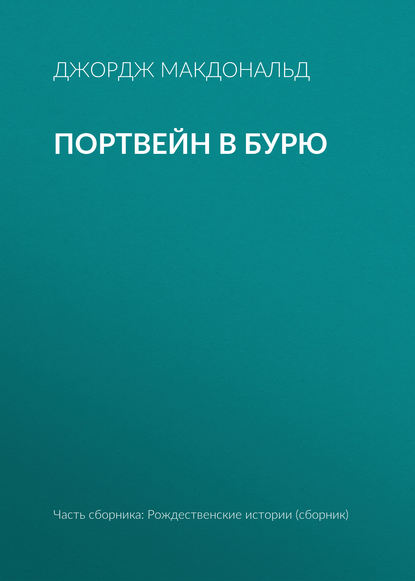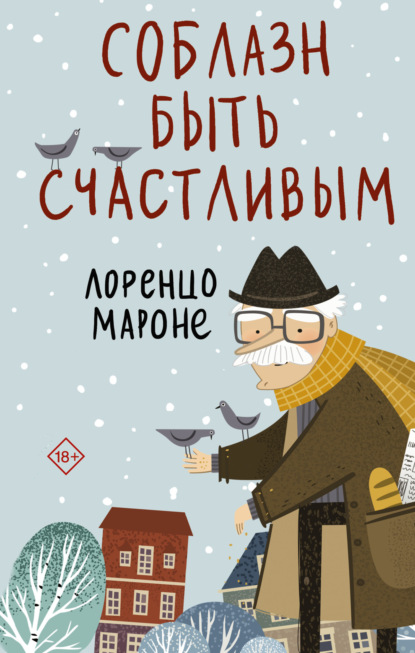- -
- 100%
- +
Zu a) Dass diese Interpretation möglich ist, kann m. E. nicht bestritten werden. Mindestens ebenso gut möglich ist aber auch eine andere, nämlich die, dass Matthäus die Sadduzäer eher stereotyp und ohne besonderes Interesse an ihnen einführt. Für letztere Deutung spricht sogar, dass von den sieben Belegen einer aus Markus übernommen ist (22,23) und ein zweiter in der Überleitung zur nächsten Perikope das Nomen anstelle des bei Markus vorhandenen Personalpronomens gebraucht (22,34), freilich dabei gutes Gefühl für die Differenzen zwischen den Pharisäern und Sadduzäern erkennen lässt. In den übrigen fünf Belegen werden die Sadduzäer immer stereotyp zusammen mit den Pharisäern genannt, woraus nun doch wirklich nicht auf ein besonderes Interesse an ihnen geschlossen werden kann. Wenn auf der einen Seite dem Matthäus vorgeworfen wird, seine Darstellung der Pharisäer und Sadduzäer (in Mt 16,11 f.) könne kaum von einem Judenchristen stammen (s. oben Nr. 3), dann kann man doch dieser Stelle kaum eine konkrete Auseinandersetzung der Gemeinde des Matthäus mit den Sadduzäern entnehmen – sonst würde er genau über die Kenntnisse verfügen, deren Fehlen an dieser Stelle moniert wird. Deutlicher kann die Tatsache, dass die Einleitungswissenschaft es mit ausgesprochen weichen und deswegen nur mit äußerster Vorsicht zu extrapolierenden Daten zu tun hat, nicht demonstriert werden.
Zu b) Dass die Gemeinde des Matthäus noch die Tempelsteuer zahlt, kann der Perikope keineswegs mit Sicherheit entnommen werden, so sehr diese Problematik auch die Entstehung der Perikope veranlasst haben dürfte. Der Autor des ersten Evangeliums kann die Perikope ebenso gut wegen der in ihr zur Sprache kommenden grundsätzlichen Freiheit der „Söhne“ übernommen haben, ohne dass die Frage der Tempelsteuer für ihn und seine Gemeinde noch aktuell gewesen sein muss.
Erste Rezeption
Sind die Argumente für die Frühdatierung keineswegs zwingend, so kann nun eine Datierung des ersten Evangeliums nach der Ausarbeitung des Markusevangeliums, die den frühesten Zeitpunkt für die Abfassung des Matthäusevangeliums bildet, versucht werden. Den zweiten Pol, auch als ante quem („vor dem“ das Evangelium entstanden sein muss) bezeichnet, bilden eine Reihe von Dokumenten aus der Alten Kirche: Der Erste Petrusbrief, der noch im ersten Jahrhundert verfasst sein dürfte, nimmt nach einer neueren Untersuchung auf das Matthäusevangelium Bezug (Metzner; vgl. auch Luz, Matthäus I 76; I 103 f.). Das Gleiche gilt für die schon genannten Briefe des Bischofs Ignatius von Antiochien, die mit großer Wahrscheinlichkeit eine Kenntnis des Matthäusevangeliums widerspiegeln, deren Abfassungszeit um 110 inzwischen aber häufig zugunsten einer zumindest etwas späteren Datierung (z. B. 130, aber auch später) aufgegeben wird. Auch die in Syrien angesiedelte, in der Regel auf das auslaufende erste oder das beginnende zweite Jahrhundert datierte ► Didache, die z. B. das „Vater unser“ mit ganz geringen Abweichungen in der matthäischen Form bietet und dabei ausdrücklich wie auch an anderen Stellen auf „das Evangelium des Herrn“ Bezug nimmt, kann hierfür herangezogen werden. Der Einwand, das „Vater Unser“ der Didache sei erst in der handschriftlichen Überlieferung an das des Matthäusevangeliums angeglichen worden, trifft nicht zu. Dagegen sprechen die eindeutig stehen gebliebenen Abweichungen! Die Abfassungszeit muss also in der Zeit nach 70 und vor dem ausgehenden ersten (1 Petr) oder spätestens zu Anfang des zweiten Jahrhunderts (Didache) liegen.
Dieser Zeitraum wird häufig noch mit Hilfe von Angaben aus dem Evangelium selbst etwas eingeschränkt. Dabei greift man vor allem auf 22,7; 23,38 und 21,41 zurück, Angaben, die allesamt die Zerstörung Jerusalems widerspiegeln sollen. Obwohl das nicht unbestritten ist (vgl. Schulz, 225, der Mt 22,7 aus der Rückschau der Jahre 80–100 für nicht befriedigend erklärbar hält und für einen vorausschauenden Charakter des Wortes plädiert, das in der Erregung über die Verstocktheit der herrschenden Kreise des jüdischen Volkes seinen Grund hat. Schöner kann man m. E. nicht demonstrieren, wie stark der subjektive Faktor bei den vorausgesetzten Plausibilitäten ist. Anders z. B. Theißen, 285), erübrigt sich an unserer Stelle eine Auseinandersetzung mit diesen Argumenten, da die Abfassung nach der Zerstörung Jerusalems sich aus der Benutzung des Markusevangeliums schon zwingend ergibt. Da das Markusevangelium eine Zeitlang gebraucht haben wird, bis es bei Matthäus angekommen ist, wird man kaum mit einer Abfassung des ersten Evangeliums vor 80 rechnen können. Ob es aber nun eher um 80 oder eher um 90 verfasst worden ist, lässt sich nicht mehr feststellen, da Argumentationen mit Hilfe theologischer Entwicklungen angesichts der unterschiedlichen Entwicklung der Gemeinden und ihrer Theologie im ersten Jahrhundert kaum zu überzeugen vermögen.
Das Matthäusevangelium ist aufgrund seiner Abhängigkeit vom Werk des Markus nach 70 entstanden. Da es zu Anfang des 2. Jahrhunderts bekannt ist, dürfte es zwischen 80 und 100 entstanden sein.
5. Der Abfassungsort des Matthäusevangeliums
Eine Griechisch sprechende Gemeinde
Der Evangelist schreibt ein griechisches Werk für Griechisch sprechende Leser und lebt damit offensichtlich auch in einer Griechisch sprechenden Gemeinde und nicht im sog. palästinischen Mutterland. Wegen der starken jüdischen Prägung des Evangeliums wird in der Regel auf eine nicht allzu große Entfernung zu Palästina geschlossen und der Abfassungsort deswegen sehr häufig nach Syrien verlegt und ebenfalls häufig mit Antiochien identifiziert.
Diese am 22. Mai 300 v. Chr. offiziell gegründete und nach dem Vater des Seleukos I. Nikator, Antiochus, benannte Stadt am Ufer des Orontes, die in der Antike oft „die Schöne“ genannt wurde, beherbergte seit ihrer Gründung eine jüdische Gemeinde in ihren Mauern, deren Größe unter Augustus zwischen 22.000 und 45.000 Mitglieder betragen haben soll. Andere Schätzungen gehen noch höher und rechnen mit bis zu 65.000 Juden in Antiochien.
Nach Ausweis der Apostelgeschichte und von Gal 2 gab es in Antiochien schon früh auch eine Gemeinde der Jesusbewegung. Von daher bietet Antiochien gute Voraussetzungen, dass das Matthäusevangelium dort entstanden sein kann, ohne dass einige Gründe, die in jüngster Zeit als eindeutig für Antiochia sprechend wiederholt worden sind, als durchschlagend angesehen werden können. Die herausragende Rolle des Petrus im Matthäusevangelium und seine von den Kirchenvätern bestätigte Bedeutung für die antiochenische Gemeinde sprechen nicht zwingend für eine antiochenische Entstehung des Matthäusevangeliums.
Gründe gegen Antiochien
Allerdings gibt es auch Gründe, die gegen Antiochien sprechen. Der wichtigste resultiert aus Apg 11,19–26. Wenn diese Angaben zuverlässig sind, dann ist die Gemeinde in Antiochien schon ziemlich von Anfang an auch auf die Heidenmission ausgerichtet, was für die Gemeinde des Matthäus so nicht gelten wird. Der Nachdruck, mit dem der Evangelist den Auferstandenen den Missionsbefehl an alle Völker sprechen lässt, und die Beschränkung der Wirksamkeit des irdischen Jesus auf Israel dürften ein Hinweis darauf sein, dass die Entscheidung für die Heidenmission noch nicht sehr alt und vor allem noch nicht allgemein akzeptiert ist. Aber man kann diese Schwierigkeit insofern umgehen, als man in der großen Stadt Antiochien natürlich mit einer Vielzahl von (Haus-)Gemeinden rechnen kann, die keineswegs alle gleichzeitig den Schritt zur Heidenmission gemacht haben müssen. Aber dass in derselben Stadt die eine Gemeinde den Schritt zur (gesetzesfreien) Mission schon sehr früh gegangen ist und eine andere sich diesem Schritt lange Zeit vollkommen versagt und sich auf Israel mit seiner Mission beschränkt hat, ist auch nicht sehr wahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich. Insofern scheint Antiochien doch nicht die größte Wahrscheinlichkeit für sich zu haben.
Neben Antiochien gibt es auch noch eine Reihe von anderen Städten, die für die Gemeinde des Matthäus vorgeschlagen worden sind (Alexandrien, Damaskus, Caesarea am Meer, Caesarea Philippi, Edessa usw.). Für Antiochien hinwiederum spricht, dass der älteste Zeuge für das Matthäusevangelium aus dieser Stadt stammt, nämlich Ignatius, der Bischof von Antiochien, der sich in seinen Briefen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Matthäusevangelium bezieht und dieses deswegen gekannt haben wird. Da er sich in Smyrn. 1,1 auf einen redaktionellen Vers des Matthäus stützt, kann diese Übereinstimmung kaum auf die Kenntnis einer gemeinsamen, dem Matthäusevangelium und dem Ignatiusbrief zugrundeliegenden Tradition, sondern muss auf das Werk des Evangelisten selbst zurückgeführt werden (vgl. dazu Köhler, 73–96; vorsichtiger Trevett und Schoedel; aber auch Meier, Ignatius). Aufgrund dieser Argumente kann die aus dem Evangelium zu erschließende Nähe zum Judentum mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf den syrischen Raum und hier vielleicht auf Antiochien konkretisiert werden. Diese These erfreut sich zur Zeit jedenfalls zunehmender Beliebtheit.
Eindeutige Hinweise auf den Abfassungsort liefert das Evangelium des Matthäus nicht. Es gibt aber eine Reihe von Anhaltspunkten, die Antiochien als Abfassungsort des Werkes wahrscheinlich machen.
6. Sprache und Stil des Evangelisten Matthäus
Matthäus verbessert eindeutig die Sprache seiner markinischen Vorlage. Als Beispiel dafür lässt sich der Ersatz der griechischem Sprachgefühl nicht entsprechenden Parataxe durch Partizipialkonstruktionen nennen. Man hat die Sprache des Matthäus deswegen im Vergleich mit der des Markus zu Recht als gehobener bezeichnet. Das bedeutet freilich nicht, dass der erste Evangelist mit seiner Sprache schon in die Nähe der klassischen Autoren geriete. Im Gegenteil, auch er schreibt noch ein semitisierendes Griechisch mit unverkennbaren Anklängen an die LXX und verwendet sprachliche Figuren in einer Weise, wie sie in der klassischen Literatur auf keinen Fall angewendet worden wären, aber damals in volkstümlicher Literatur nach Ausweis der Papyri offensichtlich verbreitet waren.
Als Beispiel für seine Nähe zum Semitischen kann etwa auf die Bevorzugung des Parallelismus, der z. B. in den alttestamentlichen Psalmen in allen Formen begegnet, hingewiesen werden. Auch die Vorliebe für die direkte Rede könnte mit dieser Nähe zusammenhängen. Matthäus hat eine Vorliebe für bestimmte Formeln und Wiederholungen, mit denen er u. a. Inklusionen schafft. Diese dienen teilweise der Hervorhebung, teilweise sicher auch der besseren Einprägsamkeit. Es ist ja auffällig, dass Matthäus sich gegen Ende des ersten Jahrhunderts trotz der von den Christen längst reklamierten Überlegenheit Jesu über den Täufer, auf die auch Matthäus Wert legt (3,14), nicht scheut, diesem und Jesus wörtlich die gleiche Verkündigung in den Mund zu legen: „Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.“ (3,2 und 4,17, vgl. auch 10,7 den Predigtauftrag der Jünger). Auf den Zusammenschluss der Bergpredigt mit den folgenden Wundertaten durch 4,23 und 9,35 wurde schon oben unter 1 hingewiesen, ebenfalls auf die die einzelnen Redekomplexe abschließenden Verse 7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1 (vgl. darüber hinaus noch 5,3–11 die Gleichförmigkeit der Seligpreisungen, 5,21–48 mit den jeweils genau abgestuften Einleitungsformeln der Antithesen, 6,1–18 und die Wehe in Kap. 23).
Diese sprachlichen Signale sind ein deutlicher Hinweis, dass der erste Evangelist bewusst mit seiner Sprache umgeht und dass die Exegese deswegen seine sprachlichen Eigenheiten und seinen Stilwillen auch beachten muss. Dass das mit einer Übersetzung nicht gelingt, muss nicht eigens hervorgehoben werden.
7. Die theologischen Anschauungen des Evangelisten Matthäus
7.1 Die Hauptthemen der matthäischen Theologie
Die Bedeutung Jesu
Unter den Gründen für die Abfassung des Evangeliums haben wir gesehen, dass neben der Kenntnisnahme des Markusevangeliums die Auseinandersetzungen mit der Synagogengemeinde am gleichen Ort und die davon für die matthäische Gemeinde ausgehende Verunsicherung ein wesentliches Motiv für den ersten Evangelisten gewesen sein dürften, sich ans Werk zu machen. Wenn es bei diesen Auseinandersetzungen auch vordergründig um die Frage des Stellenwertes des Gesetzes gegangen sein dürfte, so stand dahinter doch eine ganz andere und für die Gemeinde des Matthäus viel zentralere Frage, nämlich die nach der Bedeutung des Jesusereignisses überhaupt. Dies ist die Grundfrage, die zwischen der Synagogen- und der matthäischen Gemeinde auf der anderen Straßenseite kontrovers ist und auf die Matthäus mit seinem Werk antworten will. Dass diese Beobachtung zutrifft, zeigen schon der Anfang und der Schluss seines Werkes, die die besondere Bedeutung Jesu herausstellen. In 1,1 betont Matthäus, dass er das „Buch von der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams“ schreiben will und stellt so Jesus in die Kontinuität mit Abraham, dem Erzvater Israels und der Verkörperung des Gesetzesgehorsams (Sir 44,19 ff.; Jub 6,19), und David, als dessen Sohn der Messias erwartet wurde (2 Sam 7,12–16; ► bSanh 97 f).
Ist damit die heilsgeschichtliche Relevanz Jesu nur mehr angedeutet, so wird sie im folgenden Stammbaum zur vollen Klarheit erhoben, indem mit Hilfe des Schemas von den dreimal 14 Generationen deutlich gemacht wird, dass der Platz Jesu in der Heilsgeschichte die Bedeutung Davids und die des Babylonischen Exils noch übertrifft. Am Ende des Evangeliums erscheint Jesus als der Auferstandene den Elf in einer unvergleichlichen Machtstellung, die aber nicht durch einen christologischen Hoheitstitel verdeutlicht wird, und befiehlt ihnen, sein Wort allen Völkern als Lebens-Maßstab zu verkündigen. Stellte der Anfang Jesus in Relation zu Israel dar, so ist am Ende von dieser Relation nicht mehr die Rede, sondern nur noch von den Völkern. Das Evangelium stellt den Weg Jesu und seiner Botschaft zu Israel und nach dessen Verweigerung, die nach Matthäus in der Kreuzigung Jesu kulminiert, den Weg zu den Völkern ohne spezifischen Israelbezug dar.
Durch die Worte des Erhöhten wird der Hörer und Leser des Evangeliums nicht nur auf die Worte Jesu im Evangelium zurückverwiesen, sondern diese Worte erhalten auch große Autorität: Treue zu Jesus bedeutet Treue zu seinen Worten und, das steht dahinter, diese Worte Jesu werden von „den“ Juden nicht anerkannt, weswegen die matthäische Gemeinde in Treue zu diesen Worten ihren eigenen Weg zu den Völkern gehen muss. Damit sind die wichtigsten Themen matthäischer Theologie intoniert, es geht um die Bedeutung Jesu für seine Anhänger und die aus der Jesusbewegung entstehende Kirche, das Gesetz als Lebensregel und das Verhältnis zum Judentum. Diese Themen stehen nicht selbständig nebeneinander, sondern sind großenteils miteinander verschränkt.
7.2 Jesus Christus
Erfüllungszitate
Das wichtigste Faktum, unter dem Matthäus die Existenz Jesu sieht, ist das der Erfüllung des Alten Testaments. Mit Hilfe der sog. Erfüllungszitate (vgl. nur 1,22 f.; 2,15.17 f.23; 4,14–16; 8,17; 12,18–21 usw.) bringt er zum Ausdruck, dass in Jesu Schicksal und Wort zahlreiche Prophetenworte in Erfüllung gegangen sind, und betont so die Kontinuität des Jesusereignisses mit der als Prophetie verstandenen Heiligen Schrift, die zu seiner Zeit ja nur aus dem später so genannten Alten Testament bestand.
Zahlreiche Hoheitstitel
Deswegen stellt Matthäus auch nicht einen Hoheitstitel in den Vordergrund, sondern überträgt alle bei Markus vorhandenen Hoheitstitel auf Jesus, fügt weitere hinzu (z. B. Immanuel und die Zeichnung des Jesusschicksals in Mt 2 als neuer Moses) und verändert teilweise deren Verständnis. Gab es schon bei Markus eine Tendenz, die Hoheitstitel nebeneinander zu gebrauchen (vgl. nur Mk 8,27–33; 14,61 f.), so liegt diese Tendenz bei Matthäus noch verstärkt vor, wie man u. a. an den Heilungswundergeschichten sehen kann, die Matthäus in der Regel mit den Titeln Kyrios, Davidssohn und Messias verbindet, die er aber auch mit dem Gottessohn-Titel versehen kann.
Gottes Sohn durch Zeugung
Es ist immer wieder erstaunlich festzustellen, welche Nuancen in den Quellen dem Evangelisten aufgefallen sind und wo er wegen Nichtübereinstimmung mit seiner Theologie in seine Vorlagen eingegriffen hat, während er an anderer Stelle solche Spannungen zu seiner Theologie in seinen Quellen übersieht. So bemerkt Matthäus offensichtlich, dass das Schema einer Adoption Jesu zum Gottessohn in der Taufe mit seinen theologischen Anschauungen von der Gottessohnschaft, die in der Zeugung durch den heiligen Geist wurzeln, nicht übereinstimmt und ändert deswegen die Adoptionsformel bei der Taufe in eine Proklamationsformel (3,17 parMk), wie sie das Markusevangelium in der Verklärungsszene bietet. Nach seinem Verständnis steht Gott so sehr hinter dem Jesusereignis, dass er sogar zu dessen Existenzermöglichung in besonderer Weise eingegriffen hat, so dass Jesus von Beginn seiner Existenz Sohn Gottes ist und dazu nicht erst durch Adoption werden kann bzw. muss. Allerdings wird man deswegen nicht gleich sagen können, das Verständnis Jesu als Gottes Sohn sei für den Evangelisten besonders zentral und überrage die anderen Hoheitstitel, selbst wenn er einige Aussagen vom Gottessohn redaktionell geschaffen und diesen dabei ein besonderes Profil verliehen hat.
Das Lernen des Gotteswillens
Gerade für den heutigen Menschen aufschlussreich ist das Gottessohnverständnis der Versuchungsgeschichte, die Matthäus zwar aus der Logienquelle Q übernommen, die er sich aber aufgrund seiner Übernahme dieses Abschnittes auch zu eigen gemacht hat, so dass sie auch für ihn und seine Theologie in Anspruch genommen werden kann. Der matthäische Gottessohn ist offenbar nicht jener süße, temperament- und geschlechtslose, über alle Fragen erhabene, überaus angepasste Mensch früherer dogmatischer Vorstellungen, sondern er kennt Versuchungen, muss sich gegen diese wehren und den von Gott gewollten Weg in der Auseinandersetzung mit dem Satan finden, wobei allerdings nicht das Finden besonders hervorgehoben wird, sondern das Wissen und die Urteilskraft.
Diese Kenntnis des Willens Gottes ist ein Charakteristikum des matthäischen Gottessohnverständnisses, das auch im Zusammenhang mit der Gottessohnproklamation bei der Taufe in 3,15 eine Rolle spielt.
Innerer Kampf
Solche Kenntnis des Willens Gottes begegnet im ersten Evangelium auch unabhängig vom Gottessohn-Titel (z. B. in 5,17–7,26), die Gethsemane-Perikope aber zeigt, dass der Wille Gottes Jesus nach Ansicht des Matthäus nicht in jeder Situation einfach und klar vor Augen steht und wie von selbst von ihm erfüllt wird, sondern dass das Sich-Einfügen in diesen Willen auch für Jesus inneren Kampf bedeuten kann (26,39.42). Jesus benutzt zwar bei seinem zweiten, von Matthäus eingefügten Gebet in Gethsemane die Formulierung des Vaterunsers „Es geschehe dein Wille“ (26,42), aber welche inneren Schwierigkeiten ihm dies nach dem Verständnis des Matthäus bereitet, deutet der Evangelist durch den zweimal vorangestellten Halbsatz an: „wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann“. Sowohl in der Versuchungsgeschichte als auch in der Szene unter dem Kreuz (27,40.43) setzt Matthäus sich mit einem ganz anderen Verständnis der Gottessohnschaft auseinander und lehnt dieses ab. Zwar könnte der von Matthäus gezeichnete Jesus sicher vom Kreuz herabsteigen (vgl. nur 26,53), tut dies aber gerade nicht, weil er in Gethsemane gelernt hat, dass das Kreuz der Wille seines Vaters ist. – Insofern das Tun des Willens Gottes auch die von Jesus den Menschen zugewiesene Aufgabe ist (7,21; 12,50), hat der Jesus des Matthäus hier auch eine Vorbildfunktion. Allerdings sind Matthäus unsere Vorstellungen vom Gottessohn, die diesen dem Menschsein entheben, auch nicht ganz fremd, wie man daran sehen kann, dass er eine Reihe von Gemütsbewegungen etc., die im Markusstoff vorhanden waren, ausgelassen hat (vgl. Mk 1,41 par; 3,5 par; 6,5 f. par). In dieser Hinsicht ist er freilich nicht konsequent gewesen, einige solcher Züge hat er Jesus durchaus belassen (vgl. 9,36; 14,14; 15,32 u. ö.)
Vorbildfunktion
Autoritativer Lehrer
Matthäus betont so die heilsentscheidende Rolle Jesu, der als der von Gott gesandte und bevollmächtigte Lehrer den Willen Gottes autoritativ ausgelegt hat. An der Befolgung dieser Lehre hängt das Schicksal der Menschen. Aber diese besondere Sendung hat Jesus nicht einfach allem Menschlichen enthoben, Jesus blieb versuchbar und hat in Gethsemane das Sich-Einfügen in den von ihm sonst so autoritativ verkündigten Willen Gottes selbst mühsam lernen müssen. Obwohl sich bei Matthäus auch Ansätze einer Herrlichkeitschristologie finden lassen, so hat er doch Jesu Not in Gethsemane über Markus hinaus verstärkt und auch den Verzweiflungsruf des Gekreuzigten aus Markus übernommen und so die Gefahr einer zu starken Betonung der Herrlichkeitschristologie durchaus gebannt.
Das Verständnis Jesu als Gottessohn ist dem Menschen allerdings nicht von sich aus möglich. Jedenfalls hebt Matthäus in 16,17 hervor, dass Petrus die in 16,16 ausgesprochene Erkenntnis nicht aus sich heraus, sondern aufgrund einer Offenbarung hat. Dazu passt, dass die Jünger in 14,33 aufgrund eines erfahrenen Wunders sich zu Jesus als Gottessohn bekennen, während das Bekenntnis Jesu zu seiner Gottessohnschaft vor dem Hohen Rat nur Spott, Verhöhnung und das Todesurteil auslöst.
7.3 Das Gesetz
Von Gott autorisierte Interpretation der Tora
Die These, der historische Jesus habe das alttestamentlich-jüdische Gesetz außer Kraft gesetzt, hat wesentlich in den Antithesen des Matthäusevangeliums ihren Grund. In diesen wird der Gegensatz zum Gesetz schon durch das (variierte) Schema „Ihr habt gehört, dass (den Alten) gesagt worden ist …, ich aber sage euch“ stark hervorgehoben, obwohl eine Außerkraftsetzung des Gesetzes in den Antithesen inhaltlich m. E. bislang noch nicht plausibel nachgewiesen werden konnte. Die aus einer solchen Außerkraftsetzung gezogenen Konsequenzen für die Rolle und das Selbstverständnis Jesu dürften ohnehin kaum zutreffen. Denn im Judentum der damaligen Zeit konnte durchaus als Wille Gottes verstanden werden, was dem Wortlaut des Gesetzes jedenfalls zu widersprechen schien (vgl. K. H. Müller). Ob Matthäus nun die Antithesen und vor allem ihr Schema in Anlehnung an rabbinische Redeweise selbst gebildet oder diese vorgefunden hat, in jedem Falle ist zu berücksichtigen, dass Matthäus diesen einen auf äußerste Weise die Verbindlichkeit des Gesetzes betonenden Text (5,17–20) vorangestellt hat, so dass die Antithesen nur zusammen mit diesem Vorspann interpretiert werden dürfen. Diese Zusammenstellung zeigt aber gerade, dass der Autor unseres Evangeliums keineswegs nur am Gegensatz Jesu zum Gesetz interessiert ist, sondern dass er die gesetzeskritischen Wendungen in den Antithesen als Erfüllung des Gesetzes verstanden wissen will. Jesus bringt nach Matthäus nicht die messianische Tora des Judentums, die es dort als Vorstellung gar nicht gegeben hat, sondern er bringt im Rahmen des damals im Judentum durchaus weiter verbreiteten Ringens um die gültige Interpretation des Willens Gottes die von Gott autorisierte Interpretation der alttestamentlichen Tora. Matthäus geht sogar so weit, die Autorität und Geltung dieser Weisung in der Person Jesu zu verankern – die von Jesus ausgelegte Tora gilt aufgrund seiner Weisung als des von Gott gesandten Erlösers.
Gesetz und Situation
Gleichwohl betrachten Matthäus und wohl auch seine Gemeinde diese Weisung ihres Herrn nicht als sakrosanktes, in seinem exakten Wortlaut stets zu bewahrendes göttliches Gesetz. Einem solchen Verständnis widerspricht die von allen urgemeindlichen Zentren geteilte Tendenz, die Worte Jesu nicht dem Wortlaut nach zu überliefern, sondern dem Sinne nach, und sie zugleich auf die die Gegenwart bedrängenden Fragen hin zu fokussieren. Bei Matthäus haben wir in den Eheweisungen ein schönes Beispiel dafür, dass er sich genauso verhalten hat. Denn Matthäus überliefert hier eindeutig nicht das ursprüngliche strenge Eheethos des historischen Jesus, wie er es bei Markus vorfand (Mk 10,6–10 parMt 19,4–9; vgl. auch Mt 5,32), sondern erlaubt eine Ausnahme vom absoluten Ehescheidungsverbot. Offensichtlich waren er und seine Gemeinde der Meinung, dass diese Ausnahme vom Eheethos des historischen Jesus durchaus gedeckt wird, und sie hielten eine Überlieferung des Sinnes für wichtiger als das sklavische Festhalten am Wortlaut. Den Maßstab für die Anpassung der Gesetzes-Vorschriften an die Gegenwart nennt Matthäus in seinem Evangelium häufig. Mit Markus nennt er das Liebesgebot zusammen mit dem der Gottesliebe als höchstes Gebot (22,35–40 par Mk), stärker als Markus stellt er das der Gottesverehrung dem der Nächstenliebe gleich (22,39) und betont beide als Summe und Angelpunkt des Gesetzes (22,40). Über Markus hinaus führt er (in 9,13 und 12,7 mit einem Zitat von Hos 6,6 „Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer“) die Barmherzigkeit als Maßstab ein, und schließlich lässt er die exakt gegliederte Reihe der Antithesen im Feindesliebesgebot gipfeln (5,43–48).