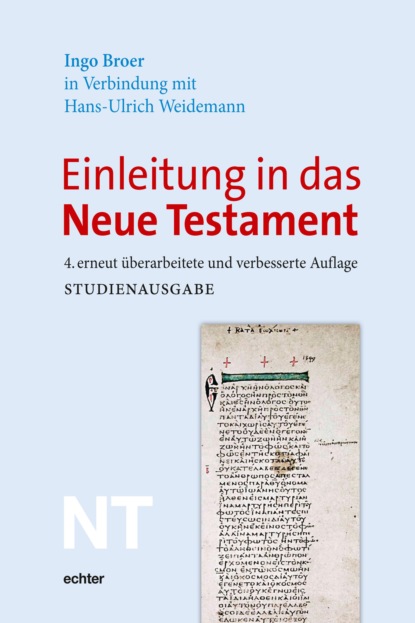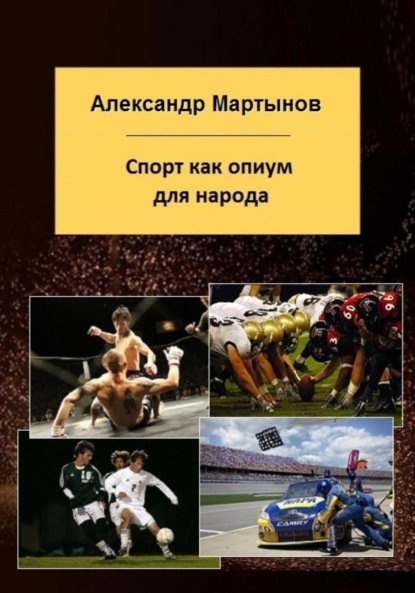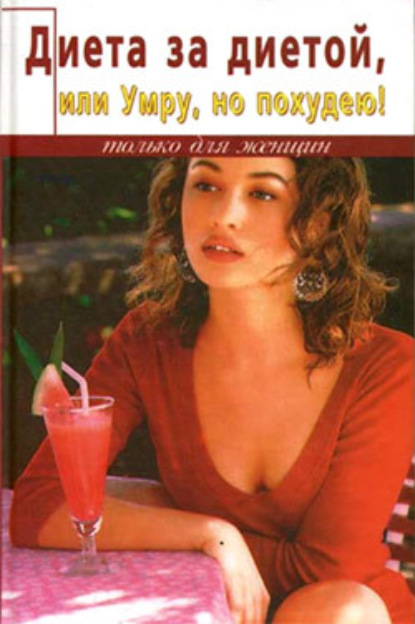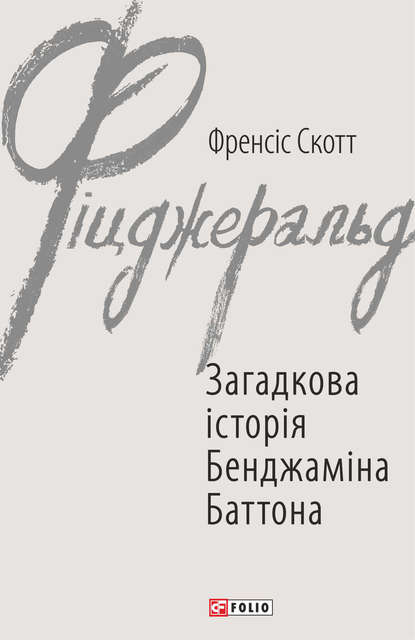- -
- 100%
- +
Gnade und Werke
Häufig wird in der Literatur die Frage gestellt, wie es denn im Matthäusevangelium mit dem Verhältnis von Gnade und Werken sei, gelegentlich wird sogar der Gedanke der zuvorkommenden Gnade der späteren kirchlichen Tradition bereits im Matthäusevangelium gefunden. Aber es begegnet auch das Verdikt, Matthäus lege Jesus immer wieder Worte von der Verdienstlichkeit der Werke in den Mund und insofern bestehe ein unüberbrückbarer Gegensatz zu Paulus und seiner Lehre von der Rechtfertigung allein aus Glauben, die als die Mitte der Schrift über die Zugehörigkeit zum Kanon zu entscheiden habe. Wenn der Verfasser des ersten Evangeliums auch später schreibt als Paulus, so sind ihm die Paulusbriefe doch nicht bekannt gewesen, zumindest wird deren Kenntnis in seinem Evangelium an keiner Stelle erkennbar, und man tut gut daran, sein Werk nicht mit Hilfe fremder Kategorien zu vermessen, wenn natürlich auch hinter der Frage ein ernsthaftes Anliegen steht. Dieses besteht nicht nur in der Frage nach dem Verhältnis zur paulinischen Theologie – nicht notwendig als Kanon im Kanon verstanden – und der Einheit der Schrift, sondern z. B. auch darin, ob Matthäus so etwas wie Gnade kennt. Dass bei Matthäus die Werke stark betont sind, kann nicht bezweifelt werden; man vergleiche nur 5,19; 7,15–27; 25,31–46. Aber auch Paulus fordert ja das Wirksamwerden des Glaubens in der Liebe (Gal 5,6) und spricht von der Erfüllung des Gesetzes (Röm 13,8–10) bzw. des Gesetzes Christi (Gal 6,2) – insofern kann nicht schon die Forderung nach Erfüllung des Gesetzes, zumal wenn die Liebe der Maßstab dafür ist (Mt 7,12; 22,39 f.), den Gegensatz zu Paulus konstituieren, sondern erst der Stellenwert dieser Werke. Erst wenn der Mensch nach Matthäus von sich aus in der Lage wäre, sich selbst durch gute Werke das Heil unabhängig vom Christusereignis zu beschaffen, wäre ein Gegensatz zu Paulus gegeben. Dass es Stellen im Evangelium gibt, die so verstanden werden können, kann nicht bestritten werden (vgl. Mt 25,31–46). Hier spielen der Glaube und das Christusereignis keine Rolle für das zuzusprechende Heil, außer dass der Menschensohn mit dem Richter identifiziert wird. Allerdings kennt auch Paulus eine Überordnung der Liebe über den Glauben (1 Kor 13,13) sowie das Gericht nach den Werken (Röm 2,13; 14,10; 1 Kor 4,5; 2 Kor 5,10), was noch einmal zu demonstrieren vermag, dass die Frage komplex angegangen werden muss und man sich nicht einfach auf einzelne Formulierungen stützen darf.
Liebe
Seligpreisungen
Es ist in diesem Zusammenhang auf die Seligpreisungen hinzuweisen, deren bloß ethisches Verständnis eindeutig ein Missverständnis der matthäischen Intention darstellt, da diese primär Zuspruchs- und erst sekundär auch Forderungscharakter tragen, ebenso auf die Sprüche vom Salz der Erde und Licht der Welt (5,13–16), wo dem Befehl zum Salzen und Leuchten die indikativische Aussage „Ihr seid …“ vorausgeht, und schließlich auf die Parabel vom Verzicht auf das Prinzip von Leistung und Gegenleistung (18,23–35), die in ihrer Aussagespitze gerade von dem Missverhältnis von empfangener Gabe und eigener Gebebereitschaft lebt, sowie auf die Parabel von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1–16). Auch Mt 26,28 ist hierfür ebenso in Rechnung zu stellen wie die Tatsache, dass Matthäus Judenchrist ist und die paulinische Sicht dem Judentum sicher nicht in jeder Hinsicht gerecht wird. Wenn also Matthäus auch den paulinischen Begriff für Gnade nicht kennt, so gibt es doch wenigstens eine Reihe von Ansatzpunkten für die Ansicht, dass Matthäus nicht einfach mit den judaistischen Gegnern des Paulus in einen Topf geworfen werden darf, wenn vielleicht auch die Aussage von 24,20 dafür spricht, dass die matthäische Gemeinde noch den Sabbat feiert.
Matthäus bejaht also das Gesetz, lässt es Jesus freilich eigenständig interpretieren. Der Maßstab für diese Interpretation ist das Liebesgebot, wobei die Anwendung des Liebesgebotes auf das jesuanische absolute Ehescheidungsverbot Matthäus zu etwas anderen Konsequenzen führt, als Jesus sie gezogen hat. Diese Einbindung des Gesetzes in die jesuanische Interpretation und eine Reihe von Einzelstellen sprechen dagegen, dass Matthäus das vertritt, was man in paulinischer Theologie mit „Werkerei“ bezeichnet.
7.4 Die Kirche
Nur zweimal „Kirche“
Dass das Thema Kirche für das Evangelium wichtig ist, kann man nicht unbedingt der Häufigkeit des Wortes entnehmen, das bei Matthäus nur zweimal begegnet – allerdings steigt das Gewicht dieser zwei Belege enorm, wenn man sich vor Augen hält, dass das Wort Kirche in den übrigen Evangelien überhaupt nicht begegnet. Darüber hinaus gehören zu diesem Wortfeld auch Begriffe wie das „Reich des Menschensohnes“ (16,28), so dass sich auch die Zahl der Belege noch erhöht. Schließlich ist das erste Evangelium das einzige im Neuen Testament, das eine Kirchenstiftung durch den historischen Jesus überliefert.
Situative Polemik
Das Thema Kirche als einer eigenständigen, von Israel unabhängigen Institution des Heils ist für Matthäus von besonderer Bedeutung, und diese Tatsache kann angesichts der dargestellten Situation seiner Gemeinde nicht verwundern. Diese Situation lässt aber zugleich auch erwarten, dass das Verhältnis von Israel und Kirche von Matthäus nicht neutral und objektiv, sondern polemisch und vielleicht auch karikierend beschrieben wird. Jedenfalls darf man sicher nicht z. B. 8,11 f. einfach im Sinne der Summe eines Traktats über Israel und die Kirche verstehen, sondern muss diesen Satz von der Auseinandersetzung zwischen Judentum und Kirche her deuten. Zwar handelt es sich dabei um ein Wort aus der Logienquelle, aber offensichtlich passt dieses auch noch in die Situation des Matthäus. Das gleiche gilt für 21,43 – dies sind nicht einfach Sätze, die im 20. Jahrhundert zur Basis der Beschreibung des Verhältnisses von Judentum und Christentum genommen werden dürfen, wenn freilich auch nicht einfach die furchtbaren Ereignisse des 20. Jahrhunderts – um nur diese zu nennen – den Maßstab für die Auslegung der Schriften aus dem ersten Jahrhundert abgeben dürfen. Am ehesten wird diesen Sätzen eine Deutung aus ihrer Entstehungssituation gerecht (womit noch einmal die Einleitungswissenschaft und ihre Fragen gerechtfertigt werden), die auch die Tatsache zu berücksichtigen hat, dass Matthäus in dieser Kontroverse rhetorische Figuren der jüdischen Polemik gebraucht. Diese stellen im Kontext des Evangeliums zwar eine Kritik Israels von außen dar, zum Zeitpunkt ihrer Entstehung aber dürften sie Teil einer innerjüdischen Auseinandersetzung gewesen sein, da keineswegs alle diese Äußerungen als von Matthäus selbst redaktionell in der Zeit nach der Trennung von der jüdischen Gemeinde verfasst angesehen werden dürfen. Aber auch Matthäus wird sich selbst als Judenchrist nach der Trennung noch solcher Redemuster bedient haben, ohne sich Rechenschaft darüber abzulegen, dass solche Rede in einem nicht-jüdischen Kontext zu Fehlschlüssen führen kann und muss. Freilich bleibt trotz dieser Abhängigkeit von den Mustern jüdischer Polemik die Frage bestehen, wie mit diesen polemischen Aussagen heute umzugehen ist. Denn polemische Aussagen eines Autors enthalten durchaus einen wahren Kern, der auch außerhalb der Polemik Gültigkeit besitzt – es sei denn, es handelt sich um Polemik um ihrer selbst willen. Insofern darf man es sich mit den antijüdischen Aussagen des Matthäus auch nicht zu leicht machen.
Fragt man von daher nach der Bedeutung von Mt 8,11 f. und 21,43 für ein heutiges Kirchenverständnis und für die Frage nach dem Heil der Juden, so wird man unbeschadet der Tatsache, dass Matthäus die traurige Geschichte von Juden und Christen noch vor sich und nicht bereits hinter sich hat, darauf hinweisen müssen, dass 8,11 f. ein aus dem Ringen der Q-Gemeinde um Israel stammendes Drohwort ist und dass Mt 21,33–42 parMk das Verhältnis der Juden bzw. der jüdischen Obrigkeit zu Jesus mit Sicherheit aus nachösterlicher Sicht verzeichnet. Ob Matthäus dies freilich bei der Übernahme in sein Evangelium gesehen hat und beachtet wissen wollte, ist eine ganz andere Frage. Das Verhältnis des Matthäus zu Israel wird im Übrigen derzeit sehr breit diskutiert und z. T. positiver gesehen als in der Vergangenheit, bis dahin, dass der vollständige Übertritt zum Judentum incl. Beschneidung als angemessene Konsequenz des Bekenntnisses zu Christus angesehen wird (Sim) – ein Beispiel, das die Leserorientierung m. E. doch erheblich übertreibt.
Die Versuche, die in der Regel israel-kritisch gedeuteten Stellen des Matthäusevangeliums, z. B. 21,43 und 27,24 f., nicht israel-kritisch zu deuten, sind zwar aller Ehren wert, dürften aber den Tenor des ersten Evangeliums kaum treffen. Denn wenn es zum Beispiel in 21,43 nur um die Ablösung der jüdischen Autoritäten geht, an deren Stelle die Jünger treten sollen (Konradt), die die geforderten Früchte bringen, so fragt man sich unwillkürlich, warum Matthäus diese Aussage so kompliziert zum Ausdruck bringt und nicht statt vom Volk gleich von den Jüngern spricht. Die Deutung des „ganzen Volkes“ in Matthäus 27,25 auf Jerusalemer Volkshaufen wird zwar der historischen Perspektive durchaus gerecht, nicht aber dem besonderen Sprachgebrauch des Matthäus in 27,24f., der in seinem redaktionellen V. 25 nun einmal, statt die Bezeichnung „Volk“ aus V. 24 zu übernehmen, einen anderen, in der Septuaginta häufig für das Heilsvolk Israel gebrauchten Terminus verwendet. Dies gilt umso mehr, wenn es sich hier um einen „Schlüsseltext des Matthäusevangeliums“ handelt (Luz). Desweiteren ist auch auf den Fortgang des Evangeliums mit dem Missionsbefehl zu verweisen. Die Weisung der Jünger zu den Völkern durch den Auferstandenen im Unterschied zu dem nach Mt 15,24 ausschließlich zu Israel gesandten Jesus hat nach dem Duktus des Evangeliums in der Ablehnung der Botschaft Jesu durch „das ganze Volk“ in 27,25 seinen Grund.
Für das Verständnis des Verhältnisses von Israel und Kirche nach Matthäus ist wichtig, dass auch letztere unter dem Gericht steht. Die Glieder der Kirche haben nur eine Chance auf das Heil, wenn sie der Gottesherrschaft würdige Früchte bringen (21,43). Matthäus setzt das Heil in eine enge Beziehung zur Praxis (der Barmherzigkeit 9,13; 12,7). Matthäus verlagert die Gründung der Kirche in das Leben des historischen Jesus (16,18 f.), liefert die Begründung dafür aber mit seinem Gesamtwerk, das mit Jesu Tod und seiner Auferweckung endet. Der irdische Jesus wusste sich nach Matthäus ausdrücklich nur zu Israel gesandt (10,5bf.23; 15,24) und die Ablehnung Jesu durch Israel, die sich vor allem in der Szene vor Pilatus (27,24 f.) und in der trotz der eindeutig bezeugten Auferstehung erfolgten Verleumdung der Oberpriester und Ältesten (28,11–15) manifestiert, ist der Grund für die Gründung der Kirche und für die Hinwendung zu den Heiden. Deswegen kann erst der Auferstandene den Missionsbefehl zu den Heiden verkündigen. In der Situation von Mt 16,18 f. ist von den Heiden noch nicht die Rede.
Die Vollmacht der Kirche
Der Kirche ist die Befolgung der ihr von Jesus übergebenen Weisung aufgetragen, sie hat aber auch selbst die Vollmacht, den Willen Gottes zu interpretieren, was Matthäus faktisch am Ehescheidungsverbot demonstriert und theoretisch mit der Vollmacht zum Binden und Lösen in 16,19 und 18,18 verdeutlicht. Diese Vollmacht ist noch nicht an ein Amt gebunden, da Matthäus mit Ausnahme von christlichen Schriftgelehrten noch keine Ämter in der Kirche kennt. Im Gegenteil, in 23,8–12 betont er stark die Bruderschaft in der Gemeinde. Dementsprechend stellt er die Jünger auch nicht als Vorbild und ideale Christen dar, sondern lässt sie für die Christen seiner Zeit mit allen ihren Stärken und Schwächen transparent werden. Nicht umsonst nennt er sie mehrfach Kleingläubige und verweist so darauf, dass sie zwar schon den Glauben haben, dass dieser aber noch nicht die angemessene Tiefe besitzt.
Matthäus hat so aufgrund der schmerzvollen Trennung von der jüdischen Synagoge die Selbständigkeit der Kirche auf Kosten des Judentums stark hervorgehoben, eine besondere heilsgeschichtliche Rolle Israels ist für ihn nicht mehr gegeben. Allerdings ist die Kirche nicht einfach schon im Heil, sondern steht selbst noch unter dem Gericht, das aufgrund der Werke erfolgt. Welche Werke gefordert sind, hat der Jesus des Evangeliums kraft der ihm von Gott gegebenen Autorität festgelegt, aber auch die Gemeinde als Ganze partizipiert an dieser Vollmacht und hat die Aufgabe, den von Jesus interpretierten Willen Gottes je neu auf die konkrete geschichtliche Lage anzuwenden. Dabei rechnet Matthäus nicht mit fehlerfreien und sündlosen Menschen, sondern zeichnet bereits die Jünger in der Nachfolge Jesu als auf dem Weg, aber eben noch nicht am Ziel.
Das Evangelium des Matthäus spiegelt den Weg der nachösterlichen Gemeinde aus dem Judentum heraus zur beschneidungsfreien Heidenmission und legitimiert diese. Indem die Gemeinde diesen Weg geht, bleibt sie ihrem Herrn und seinen Weisungen treu. Matthäus bringt Jesus in ein so intensives Verhältnis zu Gott, dass er seine natürliche Herkunft auf den Heiligen Geist zurückführt. Deswegen kennt Jesus auch den Willen Gottes, was ihn aber von Problemen mit dem Willen Gottes nicht enthebt. Weitere Themen der matthäischen Theologie sind das Gesetz und die Kirche.
Literatur
1. Kommentare
DAVIES, W. D. / ALLISON, D. C., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Matthew I–III (ICC) Edinburgh 1991 ff.; FIEDLER, P., Das Matthäusevangelium (ThKNT 1) Stuttgart 2006; FRANKEMÖLLE, H., Matthäus-Kommentar 1/2, Düsseldorf 1994.1997; GNILKA, J., Das Matthäusevangelium 1 und 2 (HThK I/1 und 2) Freiburg u. a. 31993. 21992; HARE, D. R.A., Matthew, Louisville 1993; HARRINGTON, D. J., The Gospel of Matthew (Sacra Pagina 1) Collegeville 1991; KEENER, C. S., A Commentary on the Gospel of Matthew, Grand Rapids, Mich. / Cambridge 1999; KONRADT, M., Das Evangelium nach Matthäus (NTD 1) Göttingen 2015; LUCK, U., Das Evangelium nach Matthäus (ZBK. NT 1) Zürich 1993; LUZ, U., Das Evangelium nach Matthäus I–IV (EKK I/15–4) Zürich u. a. 1989 ff.; MAIER, G., Das Evangelium des Matthäus I, Holzgerlingen 2015; MORRIS, L., The Gospel acc. to Matthew, Grand Rapids, Mich. / Leicester 1992; MOUNCE, R. H., Matthew (NIBC) Peabody 1993; SAND, A., Das Evangelium nach Matthäus (RNT) Regensburg 1986; SCHNACKENBURG, R., Matthäusevangelium Bd. 1 und 2 (NEB 1/1 und 1/2) Würzburg 21991. 21994; SCHWEIZER, E., Das Evangelium nach Matthäus (NTD 2) Göttingen 41986; WEBER, S. K., Matthew (Holman NT Commentary 1) Nashville 2000; WIEFEL, W., Das Evangelium nach Matthäus (ThHK 1) Leipzig 1998.
2. Monographien und Aufsätze
BALCH, D. L. (Hg.), Social History of the Matthean Community. Cross-Disciplinary Approaches, Minneapolis 1991; Bauer, D. R. / Powell, M. A. (Hg.), Treasures New and Old. Recent Contributions to Matthean Studies (SBL Symp. Ser. 1) Atlanta, GA 1996; BORNKAMM, G. / BARTH, G. / HELD, G., Überlieferung und Auslegung im Matthäusevangelium (WMANT 1) Neukirchen 71975; BORNKAMM, G., Studien zum Matthäus-Evangelium (WMANT 125) Neukirchen-Vluyn 2009; BROER, I., Das Verhältnis von Judentum und Christentum im Matthäus-Evangelium (Franz-Delitzsch-Vorlesung 1994) Münster 1995; ders., Versuch zur Christologie des ersten Evangeliums, in: Segbroeck, F. v. / Tuckett, C. M. / Belle, G. v. / Verheyden, J. (Hg.) (s. § 4 unter Zeller) 1251–1282; CUVILLIER, E., Torah Observance and Radicalization in the First Gospel. Matthew and First-Century Judaism: A Contribution to the Debate, in: NTS 55 (2009) 144–159; DAVID, E. (Hg.), The Gospel of Matthew in current study. Studies in memory of W. G. Thompson, Grand Rapids, Mich. 2001; DEINES, R., Die Gerechtigkeit der Tora des Menschensohnes (WUNT 177) Tübingen 2004; ders., Das Erkennen von Gottes Handeln in der Geschichte bei Matthäus, in: Frey, J. (Hg.), Heil und Geschichte. Die Geschichtsbezogenheit des Heils und das Problem der Heilsgeschichte in der biblischen Tradition und in der theologischen Deutung (WUNT 248)
Tübingen 2009, 403–441; FENEBERG, R., Die Erwählung Israels und die Gemeinde Jesu Christi. Biographie und Theologie Jesu im Matthäusevangelium. (HBS 58) Freiburg u. a. 2009; FOSTER, P., Community, Law and Mission in Matthew’s Gospel (WUNT II 177) Tübingen 2004; FRANKEMÖLLE, H., Die sogenannten Antithesen des Matthäus (Mt 5,21 ff). Hebt Matthäus für Christen das Alte Testament auf? Von der Macht der Vorurteile, in: ders. (Hg.), Die Bibel. Das bekannte Buch – das fremde Buch, Paderborn u. a. 1994, 61–92; ders., Jahwebund und Kirche Christi (NTA 10) Münster 21984; GARBE, G., Der Hirte Israels. Eine Untersuchung zur Israeltheologie des Matthäusevangeliums (WMANT 106) Neukirchen-Vluyn 2005; GUNDRY, R. H., The Apostolically Johannine Pre-Papian Tradition (s. § 5); Gurtner, D. M. / Nolland, J. (Hg.), Built Upon the Rock. Studies in the Gospel of Matthew. Grand Rapids, Mich. 2008; KAMPLING, R. (Hg.), „Dies ist das Buch …“. Das Matthäusevangelium (Fs. H. Frankemölle) Paderborn u. a. 2004; Lange, J. (Hg.), Das Matthäus-Evangelium (WdF 525) Darmstadt 1980; KINGSBURY, J. D., Matthew: Structure, Christology, Kingdom, Minneapolis 21989; KÖHLER, W-D., Die Rezeption des Matthäusevangeliums in der Zeit vor Irenäus (WUNT II 24) Tübingen 1987; KONRADT, M., Die Sendung zu Israel und zu den Völkern im Matthäusevangelium im Lichte seiner narrativen Theologie, in: ZThK 101 (2004) 397–425; ders., Studien zum Matthäusevangelium (WUNT 358) Tübingen 2016; ders., Die Rezeption der Schrift im Matthäusevangelium in der neueren Forschung, in: ThLZ 135 (2010) 919–932; ders., Matthäus und Markus. Überlegungen zur matthäischen Stellung zum Markusevangelium, in: P. v. Gemünden u. a. (Hg.), Jesus – Gestalt und Gestaltungen. Rezeptionen des Galiläers in Wissenschaft, Kirche und Gesellschaft, Göttingen 2013, 211–235; ders., Die Ausrichtung der Mission im Matthäusevangelium und die Entwicklung zur universalen Kirche. Überlegungen zum Standort des Matthäusevangeliums, in: C. K. Rothschild / J. Schröter (Hg.), The Rise and Expansion of Christianity in the First Three Centuries of the Common Era (WUNT 301) Tübingen 2013, 143–164; KÜRZINGER, J., Das Papiaszeugnis (s. § 5); Lampe, P. (Hg.), Neutestamentliche Exegese im Dialog. Hermeneutik, Wirkungsgeschichte, Matthäusevangelium. Fs. für U. Luz, Neukirchen-Vluyn 2008; LINDEMANN, A., Literatur zu den synoptischen Evangelien 1984–1991 II, in: ThR 59 (1994) 113–185; V 1992–2000 in: ThR 70 (2005) 174–216.338–382; LUZ, U., Die Jesusgeschichte des Matthäus, Neukirchen-Vluyn 1993; ders., Geschichte und Wahrheit im Matthäusevangelium, in: EvTh 69 (2009) 194–208; Massaux, E., Influence de l’évangile de Saint Matthieu sur la littérature chrétienne avant Saint Irénée, reimpr. anast. pres. par F. Neirynck (BEThL 75) Leuven 1986; METZNER, R., Die Rezeption des Matthäusevangeliums im 1. Petrusbrief. Studien zum traditionsgeschichtlichen und theologischen Einfluss des 1. Evangeliums auf den 1. Petrusbrief (WUNT 74) Tübingen 1995; MILER, J., Les citations d’accomplissement dans l’Évangile de Matthieu (AnBib 140) Rom 1999; MÜLLER, K. H., Beobachtungen zum Verhältnis von Tora und Halacha in frühjüdischen Quellen, in: Broer, I. (Hg.), Jesus und das jüdische Gesetz, Stuttgart u. a. 1992, 105–134; NORTH, J. L., Reactions in Early Christianity to Some References to the Hebrew Prophets in Matthew’s Gospel, in: NTS 54 (2008) 254–274; Oberlinner, L. / Fiedler, P. (Hg.), Salz der Erde – Licht der Welt. Exegetische Studien zum Matthäusevangelium. Fs. A. Vögtle, Stuttgart 1991; Powell, M. A. (Hg.), Methods for Matthew. Cambridge / New York 2009; REPSCHINSKI, B., The Controversy Stories in the Gospel of Matthew (FRLANT 189) Göttingen 2000; SALDARINI, A. J., Matthew’s Christian-Jewish Community, Chicago / London 1994; SAND, A., Das Matthäus-Evangelium (EdF 275) Darmstadt 1991; Schenke, L. (Hg.), Studien zum Matthäusevangelium. Festschrift W. Pesch (SBS) Stuttgart 1988; SCHMIDT, J., Gesetzesfreie Heilsverkündigung im Evangelium nach Matthäus (fzb113) Würzburg 2007; SCHOEDEL, W. R., Ignatius and the Reception of the Gospel of Matthew in Antioch, in: Balch, D. L. (Hg.) (s. o.) 129–177; SCHWEIZER, E., Matthäus und seine Gemeinde (SBS 71) Stuttgart 1974; SENIOR, D. (Hg.), The Gospel of Matthew at the Crossroads of Early Christianity (BEThL 243) Löwen 2011; SIM, D. C., The Gospel of Matthew and Christian Judaism, Edinburgh 1998; ders., Paul and Matthew on the Torah, in: Middleton, P. / Paddison, A. / Wenell, K. J. (Hg.), Paul, Grace and Freedom. Essays in Honour of J. K. Riches, London / New York 2009, 50–64; ders., Reconstructing the Social and Religious Milieu of Matthew: Methods, Sources and the possible Results, in: Sandt, H. v. de / Zangenberg, J. K. (Hg.), Matthew, James, and Didache: Three Related Documents in Their Jewish and Christian Settings (SBL. SS 45) Atlanta 2008, 13–32; STANTON, G., The Origin and Purpose of Matthew’s Gospel, in: ANRW 25.3 (Berlin / New York 1985) 1889–1951; ders., A Gospel for a New People, Edinburgh 1992; STRECKER, G., Der Weg der Gerechtigkeit (FRLANT 82) Göttingen 31971; THEISSEN, G., Lokalkolorit (s. § 4); TOMSON, P. J., Das Matthäusevangelium im Wandel der Horizonte: Vom ‚Hause Israels‘ (10,6) zu ‚allen Völkern‘ (28,19), in: Doering, L. / Waubke, H.-G. / Wilk, F. (Hg.), Judaistik und neutestamentliche Wissenschaft (FRLANT 226) Göttingen 2008, 313–333; TREVETT, C., Approaching Matthew from the Second Century, in: JSNT 20 (1984) 59–67; TRILLING, W., Das wahre Israel (StANT 10 = EThSt 7) München 31967; TRUNK, D., Der messianische Heiler (HBS 3) Freiburg u. a. 1994; VLEDDER,E.-J. / AARDE, A. G., The social location of the Matthean community, in: HTS 51 (1995) 388–408; ZUMSTEIN, J., Antioche sur l’Oronte et l’évangile selon Matthieu, in: ders., Miettes exégétiques, Genf 1991, 151–167.
1. Gliederung
Das kunstvolle Proömium
Man hat die literarische Gestalt des Lukasevangeliums nicht zu Unrecht gerühmt und mit einem Architekturwerk verglichen, dessen Gliederung sich erst bei dessen Durchschreiten erschließe. Die kunstvolle Komposition signalisieren schon das Proömium und die Tatsache, dass Lukas nicht nur ein Evangelium, sondern auch ein zweites, damit zusammenhängendes Werk (vgl. Apg 1,1) verfasst hat, sowie der Umstand, dass das Vorwort des Evangeliums wahrscheinlich auch schon das zweite Werk mit im Blick hat. Aber der Vergleich mit der Architektur darf nicht zu der Annahme führen, die Strukturen dieses Werkes lägen offen zutage, wenn man nur das Portal durchschreite und sich mit lebendigen Augen ins Innere begebe.
Fehlen von Gliederungsmerkmalen
Inhaltliche Kriterien als Ersatz
Zwar stellen Vorworte schon konventionell etwas eigenes dar, und die Vorgeschichte (1–2) ist erkennbar auch formal vom Beginn der öffentlichen Wirksamkeit des Täufers und der Jesu durch den Synchronismus (= Zusammenstellung von gleichzeitigen Personen oder Ereignissen) in 3,1 f. abgehoben, aber ähnliche trennende Signale finden sich im weiteren Verlauf des Evangeliums nicht, es sei denn, man nähme die etwas feierliche, an ► Septuagintawendungen anknüpfende Formulierung in 9,51 als eine solche, was aber kaum berechtigt ist.
Wie im ersten und zweiten Evangelium sind also auch im dritten nur ganz wenige wirklich deutliche Gliederungssignale vorhanden. Weder der unterschiedliche Stil zwischen Lk 1 und 2 einerseits und dem Korpus des Evangeliums andererseits noch die Tatsache, dass der sog. Reisebericht in 9,51–19,27 keine Parallele bei den übrigen Synoptikern hat und auch sonst abweicht, sind als Gliederungssignal zu bewerten, da das Lukasevangelium nach der Absicht seines Autors ja aller Wahrscheinlichkeit nach als selbständiges Werk gesehen und so auch gelesen werden will (und nicht in ständigem Vergleich mit dem Markusevangelium). Das hat zur Folge, dass man auch hier wie bei den anderen Synoptikern inhaltliche oder geographische Kriterien zur Gliederung heranzieht.
Allerdings gibt es durchaus Autoren, die angesichts des Fehlens solcher formellen Einteilungshinweise hinter 3,1 in 3,1–24,53 einen in sich geschlossenen Hauptteil sehen. Freilich müssen auch sie dann diesen großen Abschnitt in Unterabschnitte zerlegen und sich dabei der genannten oder anderer Kriterien bedienen. Da die Wendung Jesu nach Jerusalem in 9,51 nicht nur deutlich angezeigt, sondern auch mit einer gewissen Feierlichkeit formuliert ist, wird dieser Einschnitt von vielen Autoren als Gliederungsmerkmal akzeptiert. Das gleiche gilt für 4,14 und 19,28/29, obwohl hierfür keine sprachliche Hervorhebung, sondern nur die Hinwendung nach Galiläa bzw. das erstmalige Betreten von Jerusalem und seiner Umgebung angeführt werden kann. Nicht umsonst sind die Autoren, die hier einen neuen Abschnitt beginnen lassen, uneinig, ob dieser mit 19,28 oder mit 19,29 beginnt. Außer der Annäherung an Jerusalem ist dort auch wirklich kein Signal für einen neuen Abschnitt zu entdecken. Dieses aber wird in 19,28 genannt, weswegen mit V. 28 der neue Abschnitt beginnen muss, wenn man hier einen Einschnitt finden will. Hat man sich so auf die Geographie als Gliederungskriterium einmal eingelassen, so kann man auch für den ersten Teil noch in 4,14 aufgrund der Hinwendung Jesu nach Galiläa einen weiteren Abschnitt beginnen lassen.