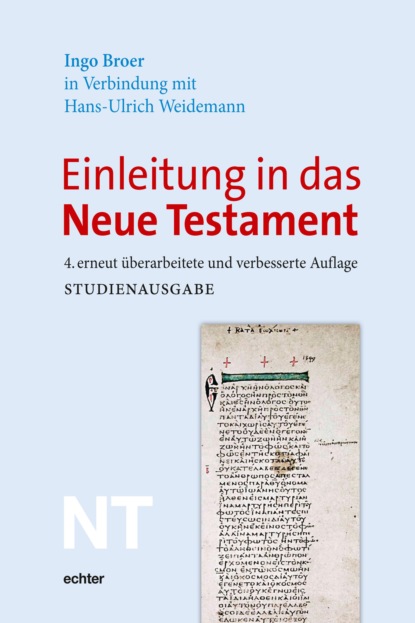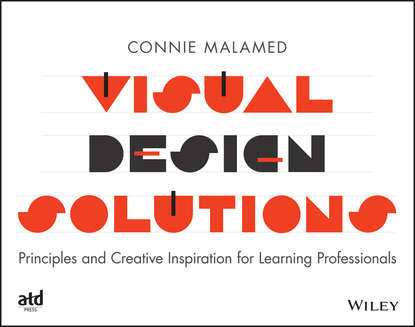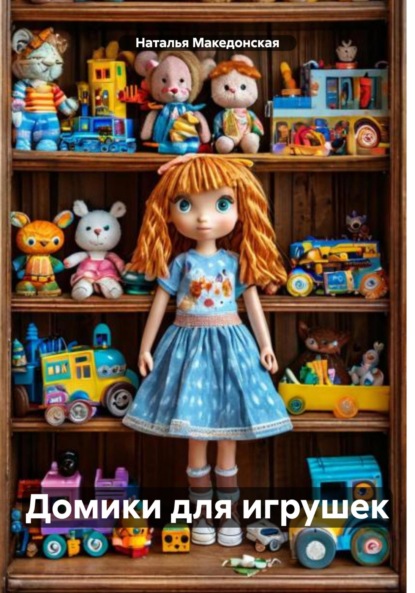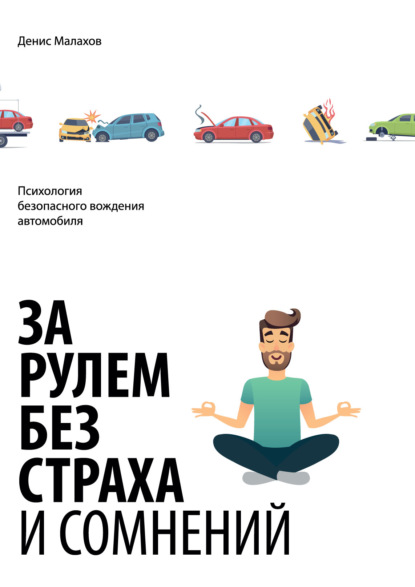- -
- 100%
- +
Legt man sich aber Rechenschaft darüber ab, nach welchem Kriterium diese Einteilung erfolgt ist, so ist dies außer dem konventionellen Einschnitt zwischen Vorwort und Korpus des Evangeliums in 1,5 und dem von Lukas deutlich auch sprachlich signalisierten Einschnitt in 3,1 f. nur die Geographie (4,14; 9,51; 19,28). Dann sollte man nicht auch noch mit 22,1, dem Beginn der Passionsgeschichte, einen neuen Abschnitt beginnen lassen. Das legt sich zwar vielleicht inhaltlich nahe, ist aber durch keine geographische Veränderung angezeigt – auf diese Art und Weise kann man ein einheitliches Gliederungskriterium einigermaßen durchhalten.
Diese Überlegungen führen zu folgender Einteilung:
1,1–4Lukasprolog (Vorwort) mit Widmung an Theophilos1,5–4,13Kindheitsgeschichten und Vorbereitung des Auftretens Jesu1,5–2,52Die Kindheitsgeschichten Johannes des Täufers und Jesu3,1–4,13Johannes der Täufer, Taufe und Erprobung Jesu4,14–9,50Jesus in Galiläa und Judäa4,14–6,16Beginn des öffentlichen Wirkens in Nazareth, Berufung der ersten Jünger, Heilungen und erste Auseinandersetzungen6,17–49Die Feldrede7,1–9,50Zyklus von Machttaten, Gleichnissen und zunehmende Auseinandersetzungen9,51–19,27Der sog. „Reisebericht“darunter: der barmherzige Samariter (10,25–37), Maria und Martha (10,38– 42), das Vaterunser (11,1–4), der reiche Kornbauer (12,13–21), das Gleichnis vom Gastmahl (14,15–24), der verlorene Sohn (15,11–32), das Kommen des Menschensohnes (17,20–37)19,28–24,53Letzte Tage in Jerusalem, Tod und Auferstehung Jesu19,27–20,47Einzug, Tempelaktion und Auseinandersetzungen mit Jerusalemer Gegnern21 Die Endzeitrede Jesu22–23 Passion, Tod und Begräbnis Jesu24 Die Auffindung des leeren Grabes, die Emmausgeschichte, die Ostererscheinung Jesu in Jerusalem und die Himmelfahrt Jesu2. Gründe für die Abfassung des Lukasevangeliums
Lk und Joh nennen Abfassungsgründe
Während Markus und Matthäus zu den Gründen, aus denen heraus sie sich zum Verfassen ihrer Schriften entschlossen haben, keine Auskunft geben, äußern Lukas und Johannes sich dazu. Beide geben deutlich zu erkennen, dass sie ein Buch für den Glauben schreiben wollen – dabei gibt es allerdings charakteristische Unterschiede. Während der Verfasser des Johannesevangeliums am Ende seines Werkes (20,30 f.) deutlich macht, dass es ihm wichtiger ist, den Nicht-Wunderstoff zu erzählen als noch mehr Wundergeschichten zu überliefern, dass aber gleichwohl die bereits erzählten Berichte von den „Zeichen“ besonders geeignet sind, zum Glauben zu führen bzw. in diesem zu halten, stellt Lukas in schriftstellerischer Manier seinem Werk ein Proömium / Vorwort voran, in dem er seine Absichten und sein Verfahren beschreibt. Ist hier auch im einzelnen manches umstritten und sind auch die Absichten, die Lukas mit seinem Evangelium und der Apostelgeschichte verbindet, in ihrer genauen Kennzeichnung kontrovers, so kann man doch sein Ziel anhand seiner Ausführungen wenigstens insoweit umschreiben, dass sein Werk wie das des vierten Evangelisten dem Glauben dienen, näherhin die Zuverlässigkeit der christlichen Lehre aufzeigen will. Wie es das im einzelnen anstrebt, ist allerdings nicht so eindeutig und auch Gegenstand heftiger theologischer Kontroversen geworden.
2.1 Glaube und Historie nach Lukas
Historische Glaubensbeweise
Die grundlegende Frage dabei ist, wodurch genau Lukas die Zuverlässigkeit, die er dem Theophilus mit Hilfe seines Werkes in Aussicht stellt, erreichen will und was diese Zuverlässigkeit der Worte, in denen Theophilus unterrichtet worden ist, exakt meint. Soll hier, wie vorgetragen worden ist, durch historische Rückfrage die Integrität der apostolischen Tradition sichergestellt und dem Glauben auf diese Weise ein zuverlässiges Fundament gegeben werden? Dagegen lässt sich natürlich trefflich einwenden, dass dann dem Glauben das menschliche Bemühen vorgeordnet werde und das Evangelium darüber hinaus unter das Lessingsche Verdikt von den zufälligen Geschichtswahrheiten falle. Zeigt aber Lukas in seinem Vorwort wirklich, dass er etwas ganz anderes will als seine Vorgänger, die sich mit dem Überliefern der Berichte der Tradition zufrieden gaben, während er zu den Tatsachen selbst durchstoßen will? Worin besteht z. B. der Unterschied zu Joh 20,30 f.? Dort ist doch auch nicht ganz allgemein und etwa im modernen Sinne an die Bedeutsamkeit der Wundergeschichten und die daraus zu ziehenden Konsequenzen gedacht, sondern die Wundergeschichten erzählen Dinge, die Jesus, noch zahlreicher als im Evangelium berichtet, „getan“ hat, und diese sind „aufgeschrieben, damit ihr glaubt“. Hier sind die Wunder kaum als zarter Hinweis gedacht, den man aufnehmen, aber auch ebenso gut überhören kann, sondern eher im Sinne des Ersten Vatikanischen Konzils als „ganz sichere Zeichen für die Göttlichkeit der Offenbarung“ verstanden. Lukas geht, das ist zuzugeben, den Weg der Tatsachen viel offener und auch breiter, indem er die Erkenntnis der Zuverlässigkeit der Lehre an seine gesamten Ausführungen und nicht nur an die Wundergeschichten bindet.
Das lukanische Werk als ganzes gewährt nach seiner Ansicht die Zuverlässigkeit der christlichen Lehre, weil sein Verfasser alles getan hat, was man von einem Historiker erwarten kann, allem sorgfältig und von Anfang an nachgegangen ist und es der Reihe nach aufgeschrieben hat. Daraus aber, dass der Bericht des Lukas „wahr“ im Sinne von historisch korrekt zu sein beansprucht, und aus der vorausgesetzten Übereinstimmung dieses Berichtes mit der Lehre, in der Theophilus unterrichtet worden ist, soll dieser deren Zuverlässigkeit erkennen. Vom Glauben ist direkt gar nicht die Rede, und dass die Übereinstimmung der beiden Zeugnisse die Wahrheit des von den Worten Gemeinten beinhaltet, ist ebenfalls auffälligerweise nicht gesagt. Nach Ausweis seines Vorwortes hat Lukas also als ein gebildeter ► Hellenist die evangelische Überlieferung einer sorgfältigen Überprüfung unterzogen und zweifelt keinen Moment daran, dass das Ergebnis seiner Untersuchung mit der Lehre, in der Theophilus unterrichtet ist, übereinstimmt. Dass er sich diese Mühe macht, spricht dafür, dass er sich davon etwas für den Glauben verspricht, aber wie er sich das Verhältnis zwischen der sich aus dieser Übereinstimmung ergebenden Zuverlässigkeit und dem Glauben denkt, gibt er nicht zu erkennen.
Analogie zu Joh 20,30
Die Vermutung, dass er sich dieses ähnlich vorgestellt hat wie der Evangelist in Joh 20,30 f., ist freilich nahe liegend, aber kann man ihm dies zum Vorwurf machen, wenn die Geistesgeschichte noch lange Zeit bis zur Erkenntnis der grundsätzlichen Zufälligkeit alles Historischen gebraucht hat? Ansätze zu dieser Erkenntnis finden sich freilich schon im Neuen Testament (vgl. Mt 12,27 f., aber auch Betz / Riesner 194, die die Zufälligkeit alles Historischen auf ein „mit dem heilsgeschichtlichen Denken der Bibel unvereinbares philosophisches Vorurteil“ zurückführen). Und wird der Glaube schon an die eigene Tätigkeit des Menschen ausgeliefert, wenn ein Schriftsteller die Basis-Erzählungen seiner religiösen Bewegung in eine Form bringt, die den Erfordernissen seiner Zeitgenossen entspricht, die nun einmal auf „Historisches“ aus sind? Man vergleiche dazu nur, wie Josephus versucht, für sein Volk den Anschluss an die Geschichte zu gewinnen (CAp I 1). Die Absicht des Lukas könnte es durchaus sein, allein dieser Tendenz nach Historischem zu genügen, weswegen man auch nicht unbedingt nach Gerüchten über die Christen und Kritik an ihnen als Anlass für die Arbeit des Lukas suchen muss.
Notwendigkeit des lukanischen Unternehmens
Aus dem Vorwort ergibt sich des Weiteren, dass nach Ansicht des Lukas aus den von ihm erwähnten Vorgängerwerken diese Sicherheit nicht zu gewinnen war. Insofern solche historische Zuverlässigkeit aber nach Ansicht des Lukas für den Glauben in der hellenistischen Welt notwendig ist, ist das von Lukas in Angriff genommene Unternehmen für seine Umgebung zwingend erforderlich.
2.2 Das Verfahren des „Historikers“ Lukas
Anspruch und Wirklichkeit
Ein Problem besteht nun freilich darin, dass Lukas diesen in seinem Vorwort ausgedrückten Anspruch im Innern seines Werkes in keiner Weise einlöst.
Zwar verbessert er seine Vorlagen, kürzt sie auch und stellt gelegentlich größere Zusammenhänge her, aber dass er systematisch, womöglich aufgrund von Nachforschungen, Verbesserungen an seinen Quellen im Hinblick auf deren größere historische Genauigkeit vornimmt, ist nicht feststellbar, es sei denn, man begreift die Auslassung eines erheblichen Teiles des Markusstoffes als solche. Aber allein die Art und Weise, wie er mit der eschatologischen Botschaft Jesu umgeht, spricht in keiner Weise dafür, dass dies auf einer sorgfältigen Nachforschung bis zu den Ursprüngen beruht oder dass diese auch nur beabsichtigt ist. Entgegen den Ausführungen im Vorwort verhält er sich im Innern seines Werkes keineswegs anders als seine Vorgänger.
Zwar lassen sich eine ganze Reihe von Umstellungen und Auslassungen gegenüber dem Markusevangelium beobachten, aber auch die Gründe dafür sind in der Regel erkennbar, und diese sind schriftstellerischer und nicht historischer Natur. Man kann das sehr schön an der Perikope von der Verwerfung Jesu in seiner Vaterstadt (4,16–30 par Mk 6,1–6) sehen, die Lukas in Abweichung von seiner Markusvorlage zu einer programmatischen, das öffentliche Wirken Jesu eröffnenden Szene umgestaltet hat, in der sich das Wirken Jesu und sein „Erfolg“ bereits abschattet. Es spricht nichts dafür, dass Lukas für diese redaktionell gestaltete Szene an dieser Stelle eine konkrete Nachricht hatte, vielmehr weist alles darauf hin, dass Lukas diese Szene hierher gestellt und selbst gestaltet hat, weil er sie für die Eröffnung des öffentlichen Wirkens Jesu für besonders geeignet hielt. Nicht eine geschichtliche Nachricht, sondern die schriftstellerischen Ziele des Lukas sind der Anlass für diese Szene. Dieses Verfahren – Lukas richtet sich nach schriftstellerischen Notwendigkeiten und nicht nach seinen Quellen – lässt sich auch sonst in seinem Werk häufig beobachten und zeigt, dass die Beschreibung der lukanischen Absicht im Prolog nicht im Sinne eines heutigen Historikers missverstanden werden darf.
Lukas ist der einzige Evangelist, der sein Werk nach Art der antiken Schriftsteller mit einem Prooemium eröffnet, in dem er seine Absicht erläutert. Indem er mit seinem Werk für Theophilos, dem er das Werk widmet, die Zuverlässigkeit der Lehre erweisen will, will er nicht den Glauben an die Historie ausliefern und begreift er das Jesusgeschehen auch nicht als ein ausschließlich der Vergangenheit angehörendes Ereignis, sondern begreift das Jesusgeschehen als konstitutiven Teil der Ereignisse, die sich als Erfüllung der Schrift ereignet haben.
3. Der Verfasser des Lukasevangeliums
Sehr auffällig ist die Tatsache, dass Lukas trotz seines literarisch ausgefeilten Vorwortes seinen Namen in diesem nicht preisgibt, obwohl an sich die Nennung des Namens durchaus zum Stil des Vorwortes gehört. Deswegen sind wir für die Rückfrage nach dem Verfasser zunächst ausschließlich auf innere Kriterien angewiesen. Allerdings kann dazu auch die Apostelgeschichte herangezogen werden, da diese vom selben Verfasser stammt (zur Begründung s. unten § 8 Nr. 3.1)
3.1 Ein Verfasser der dritten christlichen Generation
Juden oder Heidenchrist?
Schon aus dem Vorwort geht hervor, dass der Verfasser des Lukasevangeliums nicht den Anspruch erhebt, Augenzeuge des Jesusgeschehens zu sein, sondern der zweiten oder eher der dritten Generation angehört. Da Sprache und Stil der lukanischen Werke auf einen gebildeten ► Hellenisten hinweisen, konzentriert sich die Frage nach dem Verfasser zunächst darauf, ob es sich um einen Judenoder einen Heidenchristen handelt.
Ambivalente Argumente
In der Regel wird für die Entscheidung dieser Frage einerseits darauf hingewiesen, dass der Verfasser mit dem Alten Testament in seiner griechischen Übersetzung sehr vertraut und von dessen Sprache geprägt ist, durchaus ein gewisses Interesse am Gesetz, den Propheten und Jerusalem hat, dass er den Synagogengottesdienst korrekt zu beschreiben in der Lage ist (Lk 4,16–30; Apg 13,14–41) und über zahlreiche, aus judenchristlichem Milieu stammende Sondertraditionen verfügt (Lk 1–2; 17,11–19; 18,9–14). Andererseits gibt es aber wichtige Argumente, die für einen Heidenchristen sprechen: Lukas vermeidet semitische Begriffe, hat kein Interesse an Auseinandersetzungen um kultische Fragen, kennt sich in der Geographie Palästinas nicht aus (17,11), und die typisch jüdische Sühnevorstellung tritt stark zurück. Das Ergebnis dieser Argumentation ist dann in der Regel ein Heidenchrist mit Kontakt zum Diasporajudentum als Autor des dritten Evangeliums, wenn der Verfasser nicht weitergehend sogar zu dem Kreis der Gottesfürchtigen im Umfeld der Synagoge gezählt wird.
Die Lage ist naturgemäß doch komplexer, als sie bei solcher Zusammenfassung erscheint. Lukas hat z. B. durchaus jüdische Termini nicht nur gestrichen bzw. durch griechische Termini ersetzt (Rabbi, Rabbuni, Kananäer), sondern auch beibehalten. So begegnet Beelzebul bei Lk genauso häufig wie bei Matthäus, aber häufiger als bei Markus, für Mammon lauten die Zahlen: Matthäus 1, Markus 0, Lukas 3, für gehenna Matthäus 7, Markus 3, Lukas 1 und für Satan Matthäus 3, Markus 5, Lukas 5 Belege. Ebenso überliefert Lukas durchaus eine ganze Reihe von Perikopen, die von Gesetzes- und Reinheitsproblemen handeln (vgl. nur Mk 2,23–3,6 parLk), und dass Geographie-Kenntnisse als Argument kaum zu verwenden sind, haben wir schon beim Markusevangelium gesehen (s. dazu oben § 5 Nr. 3.2.2).
Dennoch gehen die oben genannten Argumente in die richtige Richtung, weisen doch die Sprache und die hellenistische Bildung des dritten Evangelisten auf einen in der Diaspora Geborenen hin. Die Tendenz zur Reduzierung jüdischer Fragen und Ausdrücke, die sich ja sicher auch der fortgeschrittenen Entwicklung des „Christentums“ und seiner Bewegung vom Judentum fort verdankt, könnte ein Hinweis dafür sein, dass der Verfasser eher aus dem Heiden- als aus dem Judentum stammt. Dass dies „mit Sicherheit“ gesagt werden kann, scheint mir jedoch eine Übertreibung zu sein – die mangelnde Kenntnis der Geographie Palästinas und die Reduzierung der semitischen Fragen und Begriffe geben diese Sicherheit nicht her. Das gleiche gilt freilich erst recht für die neuerdings wieder vereinzelt vorgetragene Ansicht, Lukas sei ein Judenchrist aus der Diaspora.
3.2 Die Nachrichten aus der Alten Kirche und die moderne Kritik
3.2.1 Die Zeugnisse
Irenäus von Lyon
Nun gibt es freilich aus der Alten Kirche wie schon bei den Evangelien nach Matthäus und Markus eine Reihe von Nachrichten, die den Verfasser wesentlich genauer zu kennen scheinen. Im einzelnen handelt es sich um Zeugnisse von der Mitte des zweiten Jahrhunderts an, von denen anzuführen sich m. E. allenfalls das des Irenäus von Lyon († um 200) lohnt: „Und Lukas hat als Begleiter des Paulus das von ihm gepredigte Evangelium in einem Buch niedergelegt“ (Haer. III 1,1 nach Eusebius, Kirchengeschichte V. 8,3; vgl. noch Irenäus, Haer. III 10,1; 14,1.2 und I 23,1). Irenäus verweist zur Begründung auf die sog. Wir-Berichte der Apostelgeschichte (s. dazu unten § 8 Nr. 6.3.1), die den Verfasser der Apostelgeschichte als Begleiter des Paulus ausweisen, und auf 2 Tim 4,10 f., wo Lukas als einziger Begleiter des Paulus genannt ist, sowie auf Kol 4,14, wo von Lukas als dem geliebten Arzt die Rede ist (Haer. III 14,1). Auf Philemon 24, wo ebenfalls ein Lukas als Mitarbeiter des Paulus erwähnt wird, nimmt er hier keinen Bezug.
Irenäus schreibt: „Dieser Lukas war von Paulus unzertrennlich und sein Mitarbeiter am Evangelium, wie er selbst deutlich macht, und zwar nicht, um sich aufzuspielen, sondern von der Wahrheit gedrängt. Denn als sich Barnabas und Johannes, der sich Markus nennt, von Paulus getrennt und sich nach Zypern eingeschifft hatten (vgl. Apg 15,39), da, sagt er, ‚kamen wir nach Troas‘ (Apg 16,8). Und als Paulus im Traum einen Mann aus Mazedonien gesehen hatte, der zu ihm sagte: ‚Komm nach Mazedonien und hilf uns‘, Paulus (Apg 16,9), da, sagt er, ‚hatten wir das Verlangen, sofort nach Mazedonien aufzubrechen, da uns klar war, dass der Herr uns rief, ihnen das Evangelium zu bringen. Wir segelten also von Troas ab mit Kurs auf Samothrake‘ (Apg 16,10 f.). Im Folgenden beschreibt er sorgfältig ihre ganze weitere Reise bis nach Philippi (vgl. Apg 16,12) und wie sie (dort) zum erstenmal predigten: ‚Wir setzten uns‘, sagt er nämlich, ‚und sprachen zu den Frauen, die sich eingefunden hatten‘ (Apg 16,13). Es (wird auch berichtet), was für Leute da zum Glauben kamen und wie viele es waren. Und er sagt auch: ‚Nach den Tagen der Ungesäuerten Brote segelten wir von Philippi ab und kamen nach Troas, wo wir uns sieben Tage aufhielten‘ (Apg 20,6).. Weil Lukas bei allem dabei war, hat er alles genau aufgeschrieben, ohne bei einer Lüge oder Übertreibung ertappt werden zu können, weil eben alle diese Dinge so feststehen und er älter ist als alle, die jetzt andere Lehren verbreiten und die Wahrheit nicht kennen. Er war ja nicht nur ein Begleiter der Apostel, sondern auch ihr Mitarbeiter, vor allem aber der des Paulus, und Paulus hat das in seinen Briefen auch selbst gezeigt …“ (Irenäus von Lyon, Haer. III 14,1).
Weitere Zeugnisse
In den sog. ► anti-marcionitischen, in ihrem Alter häufig überschätzten Evangelienprologen wird im Vorwort zum Lukasevangelium gesagt, dies sei von dem Arzt Lukas aus Antiochien geschrieben, der keine Frau und keine Kinder gehabt und sein Evangelium als dritter, also nach Matthäus und Markus, aber vor Johannes verfasst habe und in Bithynien im Alter von 84 (88) Jahren gestorben sei. Darüber hinaus finden sich bei Justin dem Märtyrer († um 165) Anspielungen auf das Lukasevangelium, und Marcion hat bekanntlich (um 140) das Werk des Lukas ohne dessen Namen mit erheblichen Streichungen (z. B. Lk 1–2 und das meiste von Lk 3–4) und Korrekturen als sein „Evangelium“ herausgegeben. Auch in dem im ausgehenden zweiten Jahrhundert verfassten ► Muratorischen Kanonverzeichnis wird von Lukas berichtet, ohne dass daraus neue Kenntnisse über die bereits genannten Quellen hinaus gewonnen werden könnten. Nach Origenes (185 – nach 254) hat Paulus das Werk des Lukas sogar mit Lob bedacht.
3.2.2 Überprüfung der Kirchenväterzeugnisse
Lukas als Paulusbegleiter?
Die Zeugnisse aus der Alten Kirche lassen sich dadurch auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen, dass diese Lukas mit dem in Phlm 24 von Paulus selbst und dem in den ► Deuteropaulinen genannten Paulusbegleiter Lukas identifizieren. Wäre dieser Lukas der Verfasser der Apostelgeschichte, dann müsste er Paulus längere Zeit begleitet haben, was Irenäus ja auch tatsächlich behauptet, und deswegen nicht nur mit seiner Theologie, sondern auch mit seinen wesentlichen Daten und Intentionen vertraut sein, so dass zu fragen ist: Passt das Zeugnis der Apostelgeschichte mit dem Selbstzeugnis des Paulus zusammen? Dies ist nach allgemeiner Überzeugung aber nicht der Fall. Weder die Paulusreisen nach Jerusalem vor dem Apostelkonzil, noch die Darstellung der Auseinandersetzungen und Beschlüsse dieses Konzils stimmen bei Paulus und in der Apostelgeschichte überein, und dass Paulus einen seiner Mitarbeiter den Juden(-christen) zuliebe hätte beschneiden lassen (Apg 16,3), scheint mir absolut unvorstellbar, auch wenn dies Exegeten gelegentlich für möglich halten.
Da den Berichten des Paulus als Beteiligten und in vieler Hinsicht Betroffenen trotz aller auch hier anzuwendenden Vorsicht eindeutig die Priorität gebührt und auch die theologischen Anschauungen des Paulus in der Apostelgeschichte kaum wiederzuerkennen sind und darüber hinaus die Existenz von Paulusbriefen in der Apostelgeschichte nicht erwähnt wird, kann der Autor dieses Werkes kaum der Paulusbegleiter Lukas sein. Allerdings ist gerade in dieser Frage des Verhältnisses der lukanischen Apostelgeschichte zu Paulus und seiner Theologie in der letzten Zeit vieles in Bewegung. Schröter hat in seinem Literaturbericht die Lage so zusammen gefasst. Die Diskussion bewege sich zwischen zwei Extremen: „der Paulusbegleiter Lukas, der einen historisch zuverlässigen Bericht über die Paulusmission übermittelt, auf der einen, der unbekannte Autor aus dem 2. Jh., der praktisch ohne Zugang zu Paulusüberlieferungen das literarische Konstrukt eines ‚paulinischen Christentums’ entwirft, auf der anderen Seite.“ Trotz der in der neueren Literatur deutlich erkennbaren Annäherung des Lukas und seiner Theologie an Paulus bleibt festzustellen, dass die Spezifika der paulinischen Briefe in der Apostelgeschichte fehlen. Dies kann kaum ausschließlich damit zusammenhängen, dass der Paulusbegleiter der Wir-Berichte in der Zeit, in der der Apostel die Briefe schrieb (= Teile der zweiten und dritten Missionsreise, 16,18–20,4) gerade nicht bei Paulus war.
Lk im Neuen Testament
Darüber hinaus ist häufig so argumentiert worden, die alten kirchlichen Nachrichten über den Autor des Lukasevangeliums verdienten auch deswegen kein historisches Vertrauen, weil wir ihre Entstehung aus den Nachrichten der oben genannten Spätzeugnisse des Neuen Testaments selbst noch verfolgen könnten. Deswegen erstaunt es auch nicht, dass die aufgrund von Kol 4,14 („Lukas der Arzt“) durchgeführte Prüfung, ob die Werke des Lukas eine besondere Affinität zur Medizin erkennen lassen, zu keinem positiven Ergebnis geführt hat.
Nun hat man aber diese Behauptung, die altkirchlichen Aussagen beruhten auf einer Kombination aus den paulinischen und deuteropaulinischen Bemerkungen über Lukas, mit dem Argument als unbrauchbar zu erweisen versucht, es handele sich doch um einen merkwürdigen Zufall, „dass die Kirche auf der Suche nach geeigneten Verfassernamen für zwei ihrer Evangelien ausgerechnet in solchen Briefen ‚fündig“ geworden sein soll, die um Jahrzehnte jünger sind als die beiden Evangelien“ (Thornton 80). Die Angelegenheit sei vielmehr genau umgekehrt abgelaufen. Weil die Verfasser des Ersten Petrus- und des Zweiten Timotheusbriefes Markus und Lukas bereits als Verfasser von Evangelien gekannt hätten, hätten sie diese mit Petrus und Paulus in Verbindung gebracht. Dieses Argument scheint insgesamt kaum plausibler zu sein als das oben erwähnte von der Erschließung des Lukas aus den Wir-Berichten der Apostelgeschichte.
Das zuerst genannte Argument von der Erschließung aus den Wir-Berichten kann sich immerhin darauf stützen, dass Irenäus selbst auf diese Wir-Berichte Bezug nimmt. In jedem Fall schießt m. E. die Annahme Thorntons (66), spätestens mit der Verbreitung eines Evangeliums über die Grenze der Entstehungsgemeinde hinaus habe ein Interesse bestanden, nicht nur Verfasser und Titel, sondern auch noch weitere Informationen über diese Schrift zu besitzen, zumindest beim Markusevangelium weit über das Ziel hinaus. Es dürfte doch nicht von ungefähr kommen, dass im Prinzip alle vier in den Kanon aufgenommenen Evangelien keinen Verfassernamen (außer in der Überschrift, die in der Regel für sekundär gehalten wird) aufweisen, was gerade beim Lukasevangelium angesichts des topischen Charakters seines Vorwortes, zu dem normalerweise der Verfassername gehört, besonders auffällig ist. Sosehr irgendwann zum Ausgang des ersten oder zu Beginn des zweiten Jahrhunderts, sobald mehrere Evangelien in einzelnen Gemeinden Verbreitung gefunden hatten, eine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen den verschiedenen Evangelien geschaffen worden sein muss, so wenig muss beim Markusevangelium diese sozusagen von Anfang an – beim Verlassen der Heimatgemeinde! – bestanden haben, weil es eben nicht das Evangelium des Markus, sondern das von Jesus Christus ist und weitere Werke der gleichen Art damals noch nicht existierten. Die Tatsache, dass auch Matthäus und vor allem Lukas ihren Namen nicht im Korpus des Evangeliums nennen, könnte zumindest ein Hinweis darauf sein, dass die Notwendigkeit der Unterscheidung des eigenen Werkes von den anderen Evangelien auch von ihnen nicht gesehen wurde, zumal keineswegs ausgemacht ist, ob Matthäus und Lukas ihr Werk neben das Markusevangelium stellen wollten oder ob sie nicht eher dessen Ersetzung anstrebten.
Das Lukasevangelium stammt von einem hellenistisch gebildeten, mit der LXX und jüdischen Bräuchen vertrauten Christen, dessen Namen wir nicht kennen und der vermutlich kein geborener Jude war. Dass wir gleichwohl auch weiterhin von Lukas und dem Lukasevangelium sprechen, wie wir es bereits beim Markus- und Matthäusevangelium getan haben, hat traditionelle Gründe. Eigentlich müsste man den Namen immer in Anführungszeichen setzen.