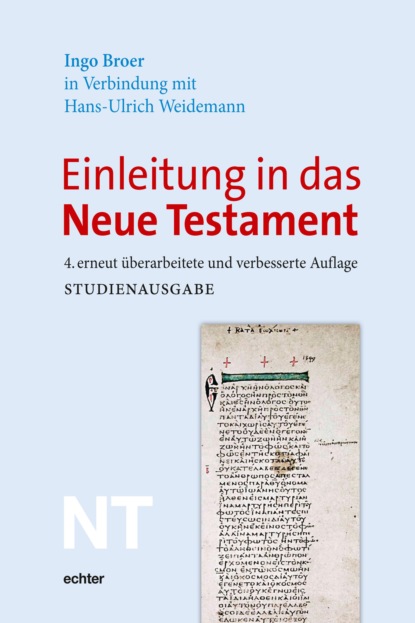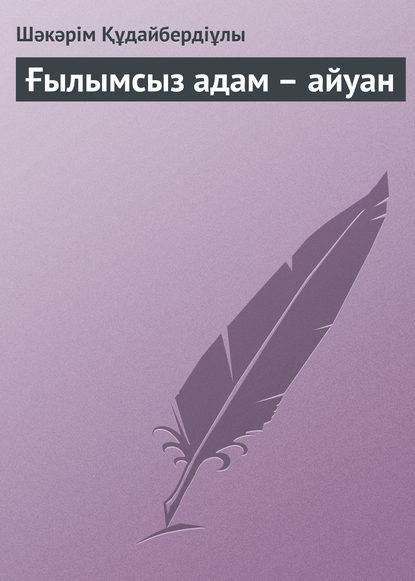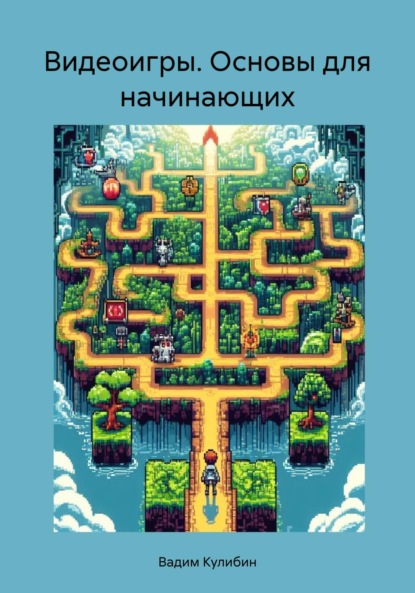- -
- 100%
- +
8. Die Gattung der Logienquelle
Halbevangelium
Die bereits erwähnte formkritische Charakterisierung der Q zugrundeliegenden Teilsammlungen hat auch die Gattungsbestimmung der ganzen Sammlung beeinflusst. Sie ist sowohl als Weisheitssammlung als auch als Prophetenbuch bestimmt worden. Das Vorhandensein unterschiedlicher Teilgattungen in Q hat einige Autoren aber dazu gebracht, in Q eine Größe ganz eigener Art zu sehen, die ohne Analogie in der umgebenden Literatur ist, wie wir das ja auch schon bei der Gattung Evangelium gesehen haben (vgl. oben § 2 Nr. 2.2–2.4). Bei der Logienquelle wird das m. E. dem Charakter dieser Sammlung eher gerecht als die Bezeichnung als Halbevangelium, als zweites Hauptelement der Gattung Evangelium oder ähnliche Bezeichnungen. Der Schöpfer der Gattung Evangelium, der das Schicksal Jesu in einen Spannungsbogen von seiner Taufe bis zur Auferstehung einspannte, schuf etwas Neues. Die Logienquelle, die anderes Material enthielt, das nach Ausweis der Werke der ► Seitenreferenten zur Ergänzung des markinischen Werkes geeignet war, war nicht einfach auf dem Wege dahin. Deswegen kann dieses Werk nicht als Halbevangelium o. ä. bezeichnet werden, ohne dass dem ältesten Evangelisten und seinem Werk Unrecht geschieht, so sehr durch die Anfügung (weniger) narrativer Elemente in Q bereits ein gewisser, aber wirklich nur ein gewisser, biographischer Zusammenhang entstand. Es stellt eine Übertreibung dar, hierin bereits einen entscheidenden Schritt in Richtung Evangelienbildung zu sehen. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Entwicklung automatisch in Richtung Evangelium gelaufen wäre. – Etwas anderes ist es, wenn man von Q als Evangelium / gospel spricht, da dabei der Begriff „Evangelium“ nicht als Gattungs-, sondern als Inhaltskriterium verstanden ist, und in diesem Sinne kann die Logienquelle natürlich als Evangelium bezeichnet werden. Denn für die Träger der Logienquelle war Q die Gestalt ihrer Heilspredigt von Jesus Christus, der auch als Person und nicht nur als Übermittler einer Botschaft für die Q-Tradenten von Bedeutung war.
Gospel
Die nächsten Parallelen zu Q als Sammlung von Einzelsprüchen liegen im jüdischen Traktat ► Abot und aus christlicher Tradition im ► Thomasevangelium und evtl. auch im ► Philippusevangelium vor. Zu einer exakten Beschreibung von Q als Gattung führen diese Analogien freilich nicht.
9. Die Trägerkreise der Logienquelle
Wanderradikale und Sesshafte
Einzellogien von Q setzen wandernde Prediger voraus (Q 9,57–60; 10,2–12; 12,22–31.33–34), andere Logien hinwiederum passen eindeutig nicht zu solchen Wanderpredigern und müssen deswegen aus einer sesshaften Gemeinde stammen (Q 6,30; 16,13). Die Wanderprediger sind heimat- (Q 9,58) und besitzlos (Q 6,20 f.; 12,22–31.33 f.), mit Familie haben sie nichts im Sinn (vgl. Q 9,57 f; 14,26), was für die sesshafte Gemeinde alles nicht gilt. Nur den, der etwas hat, kann man sinnvollerweise zum Geben auffordern (Q 6,30)! Hinter der Logienquelle stehen also unterschiedliche Trägerkreise, zum einen Leute, die geben können, zum anderen Leute, die auf diese Gaben angewiesen sind und gleichzeitig die Besitzenden zum Geben auffordern. Ob die Armut der Letzteren freiwillig ist und zu ihrer Berufung gehört, oder ob die Armut unfreiwillig ist, wird diskutiert. Q 10,4 spricht aber doch wohl für freiwillige Besitzlosigkeit und damit für ein Ethos der Armut.
Veränderung durch Redaktion
In welchem Verhältnis die Gruppen der sesshaften und der nicht-sesshaften Tradentenkreise von Q zueinander stehen, ist schwierig zu beurteilen, es kommt sowohl ein Nacheinander als auch ein Nebeneinander in Frage, d. h. das Q-Material kann zunächst von wandercharismatischen Gruppen tradiert (und zum Teil auch gebildet) worden sein, die dann später sesshaft geworden sind, was ihr Ethos naturgemäß beeinflusst und zur Bildung von Worten geführt hat, die die neue Situation widerspiegeln. Die wandernden Missionare können aber u. U. auch von einer sesshaften Gemeinde ausgesandt worden sein und dabei parallel zur Existenz der sesshaften Gemeinde ihr Ethos entwickelt haben. Jedenfalls bestimmen die das Ethos der wandernden Prediger widerspiegelnden Worte nicht mehr die Gesamtperspektive von Q, so dass ihr Einfluss auf die Endredaktion allenfalls begrenzt gewesen zu sein scheint. Dies würde natürlich erst recht gelten, wenn diejenigen Forscher recht hätten, die diese radikalen Worte auch schon auf der Ebene von Q nur noch bildhaft verstanden wissen wollen.
Parallelen aus dem frühen 2. Jahrhundert
Die sog. Wandercharismatiker, also die nicht-sesshaften Tradenten von in die Logienquelle aufgenommenen Worten, haben in den letzten Jahrzehnten besonderes Interesse gefunden. Dass es diese in der Urkirche gegeben hat, sagt die Logienquelle nicht ausdrücklich, aber schon die paulinische Art der Verkündigung des Evangeliums bezeugt solche Existenz, wenn auch die Wandertätigkeit der Q-Boten in Galiläa und Syrien nur partiell mit den weiten Reisen des Apostels verglichen werden kann. In der ► Didache, einer Schrift aus der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, werden solche wandernden Lehrer ausdrücklich genannt, und auch in den Johannesbriefen spiegelt sich dieselbe Erscheinung (2 Joh 10; 3 Joh 5–8.10). Zeigen diese Belege die Bedeutung des Phänomens bis ins zweite Jahrhundert, so wird diese noch dadurch unterstrichen, dass der zweite Johannesbrief und die Didache Beurteilungskriterien nennen, die der Gemeinde helfen sollen, zwischen echten Predigern, die zu ihr kommen, und solchen, die nur um des eigenen Vorteils willen predigend umherziehen, zu unterscheiden. Offensichtlich waren angesichts der Vielzahl solcher Wanderprediger solche Kriterien notwendig. In der ► Didache heißt es:
„Wer nun kommt und euch dies alles bisher Gesagte lehrt, den nehmt auf. Wenn aber der Lehrende selbst sich abwendet und eine andere Lehre lehrt, um (die rechte Lehre) aufzulösen, so hört nicht auf ihn; (lehrt er) hingegen, um zu vermehren Gerechtigkeit und Erkenntnis des Herrn, so nehmt ihn auf wie den Herrn.
Aber hinsichtlich der Apostel und Propheten verfahrt nach der Weisung des Evangeliums so: Jeder Apostel, der zu euch kommt, soll aufgenommen werden wie der Herr. Er soll aber nur einen Tag lang bleiben; wenn aber eine Notwendigkeit besteht, auch den zweiten. Wenn er aber drei bleibt, ist er ein Pseudoprophet. Wenn aber der Apostel weggeht, soll er nichts mitnehmen außer Brot, bis er übernachtet; wenn er aber um Geld bittet, ist er ein Pseudoprophet…. Jeder aber, der kommt im Namen des Herrn, soll aufgenommen werden; dann aber werdet ihr ihn durch kritische Beurteilung erkennen; denn ihr habt Einsicht nach rechts und nach links. Wenn der Ankömmling ein Durchreisender ist, helft ihm so viel ihr könnt; er soll aber bei euch nur zwei oder drei Tage bleiben, wenn es nötig ist. Wenn er sich aber bei euch niederlassen will, und er ist ein Handwerker, soll er arbeiten und soll er essen. Wenn er aber kein Handwerk versteht, dann trefft nach eurer Einsicht Vorsorge, damit er als Christ ganz gewiss nicht müßig bei euch lebe“ (Didache 11,1–6; 12,1–4).
Temporär Wandernde?
Sollten diese Apostel mit den wandernden Missionaren der Logienquelle identisch sein, so macht es wohl wenig Sinn, die Spannung zwischen dem Ethos der wandernden und der sesshaften Anhänger der Jesusbewegung dadurch aufzulösen, dass man die Wandernden und die Sesshaften miteinander identifiziert, indem man die Wandernden nur temporär und vorübergehend Wandernde sein lässt. Denn wer die Situation des Wanderns aus der Perspektive der Sesshaftigkeit kennt, wird kaum selbst als temporär Wandernder die Situation ausnutzen wollen.
Nicht erst neuerdings hat man in den radikalen, u. a. den Besitzverzicht betonenden Worten der Logienquelle Parallelen zum griechischen ► Kynismus gefunden, bei dem der Name (von griechisch kyon = der Hund) Programm und Hinweis auf die bedürfnislose Lebensweise ist. Im einzelnen finden sich z. B. in der Aussendungsrede von Q eine ganze Reihe von Ähnlichkeiten, von denen hier nur einige genannt werden: Das Wort von den Schafen unter den Wölfen spiegelt die Konflikte, in die der tugendhafte Mensch gerät, womit auch die Kyniker Erfahrung haben. Zu der sog. Ausrüstungsregel in Q 10,4 gibt es enge Parallelen bei den Kynikern, wenn auch der den Q-Boten (zwar nicht hier, aber in Q 9,3) verbotene Stab und der nach Q 9,3 und 10,4 ebenfalls verbotene Beutel für den Kyniker gerade kennzeichnend sind. Auch zu Q 10,5 f. finden sich, allerdings mit Ausnahme des Friedenswunsches, Parallelen im Kynismus. Gleichwohl wird man ein direktes Verhältnis zwischen Logienquelle und Kynismus ablehnen müssen, solange nicht auch über die genannten Parallelen hinaus ein Einfluss des Kynismus in Palästina und auf die Jesusbewegung nachgewiesen werden kann. Denn abgesehen von gewissen Parallelen zwischen der Logienquelle und Kynikerworten, die z. B. einfach mit dem von beiden Gruppen vertretenen Armutsideal zusammenhängen können, wird man bei den Vertretern der Kynikerhypothese doch eine einseitige Interpretation der Q-Worte zugunsten der kynischen Aussagen festhalten müssen. Näherliegende Parallelen in der alttestamentlichen und jüdischen Literatur werden vernachlässigt, Differenzen heruntergespielt und der apokalyptische Zusammenhang vieler Worte außer acht gelassen. Das Verständnis der Gottesherrschaft wird sich bei den Trägern der Logienquelle im Gegensatz zum Verständnis einiger Vertreter der Kynikerhypothese keineswegs in dem modernen Verständnis von Glücklich- und Gesundsein erschöpft haben.
Ähnlichkeiten zum Kynismus
Einseitige Interpretation
10. Die Logienquelle und das Markusevangelium
Ein besonderes Problem stellen einige Stücke in den synoptischen Evangelien dar, die aufgrund ihres übereinstimmenden Wortlautes im Matthäus- und Lukasevangelium definitionsgemäß Q zuzurechnen sind, bei denen es aber gleichzeitig Übereinstimmungen mit dem Markusevangelium gibt, so dass die Frage entsteht: Kannte Markus ebenfalls Q oder kannte gar der letzte Redaktor von Q das Markusevangelium? Eine solche Beziehung zwischen der Logienquelle und dem Markusevangelium wäre freilich für die Frage nach der Abhängigkeit der Evangelien, also für die synoptische Frage, fatal, weil diese dann noch einmal aufgerollt und neu gestellt werden müsste. Diese Konsequenz darf allerdings den Blick auf das Phänomen nicht beeinflussen, es geht um dessen unvoreingenommene Würdigung. Dieses Problem wurde früher häufig mit nur wenigen Sätzen abgetan, wird aber in der heutigen Forschung zur Logienquelle wesentlich breiter beachtet.
Kannte Mk Q?
Wenn eine Beziehung zwischen Q und dem Markusevangelium angenommen wird, so wird heute in der Regel eine Kenntnis der Logienquelle durch den Evangelisten Markus vertreten und nicht eine Abhängigkeit der Logienquelle vom Markusevangelium.
Spuren der Redaktion von Q im Mk
Zwar ist in der Literatur der letzten Jahre der erfolgreiche Abschluss dieser Diskussion vermeldet und die Frage als in dem Sinne geklärt bezeichnet worden (Jacobson in einer Rezension von Schüling), dass eine Abhängigkeit von Q für das Markusevangelium nicht in Frage kommt, aber diese Äußerung war offensichtlich etwas voreilig. Denn ebenfalls in den letzten Jahren ist eine ganze Reihe von Arbeiten erschienen, die gleichwohl eine Kenntnis der Logienquelle durch den Markusevangelisten erweisen zu können meinen. Dabei ist v. a. auf die jüngst erschienene Arbeit von H. Fleddermann zu verweisen, der – freilich nicht als erster – den umfassenden Nachweis einer Kenntnis von Q durch Markus zu führen versucht, indem er auf Spuren der Redaktion der Logienquelle im Markusevangelium verweist. Auf diese Weise wird der naheliegenden Vermutung der Weg versperrt, dass die Übereinstimmungen zwischen Q und dem Markusevangelium auf gemeinsamer Tradition basieren, die sowohl in Q als auch in das Markusevangelium Eingang gefunden hat. Wie wir noch sehen werden, wird auch das Verhältnis des Johannesevangeliums zu den Synoptikern ebenfalls durch solchen Rückgriff auf redaktionelle Verse der Synoptiker zu klären versucht. Die Übereinstimmungen zwischen Q und dem Markusevangelium beruhen nach dieser Untersuchung (und anderen Arbeiten) darauf, dass Markus die Logienquelle kannte und nicht etwa auf der Kenntnis einer Q und dem Markusevangelium vorausliegenden Vorlage. Andere nehmen die Kenntnis einer früheren und einfacheren Stufe der Logienquelle für Markus an.
Es geht hier u. a. um folgende Texte:
Mk 1,2 f. / Mt 11,10; 3,3/Lk 7,27; 3,4Zwei alttestamentliche Zitate über den Wegbereiter des HerrnMk 1,12 f. / Mt 4,1–11 /Lk 4,1–13Die Versuchung JesuMk 3,22–30/Mt 12,24–26/Lk 11,14–23Die Beelzebul-PerikopeMk 3,28 f. / Mt 12,31 f. / Lk 12,10Die Sünde wider den Heiligen GeistMk 4,30–32/Lk 13,18 f.Das Senfkorn-GleichnisMk 6,7–13/Mt 9,37–10,16/Lk 9,1–6/Lk 10,1–16Die JüngeraussendungMk 8,11 f. / Mt 12,38 f. Lk 12,54–56/Mt 16,1–4Die ZeichenforderungMk 8,35/Mt 16,25/Lk 9,24Mt 10,39/Lk 17,33Das Wort vom Verlieren des LebensMk 8,38/Lk 9,26 Mt 10,32 f. / Lk 12,8 f.Bekennen und VerleugnenMk 9,37/Mt 18,5/Lk 9,48 Mt 10,40/Lk 10,16Das AufnehmenMk 10,11 f. / Mt 19,9/Mt 5,32/Lk 16,18Das EhescheidungswortMk 13/Mt 24/10,22–37/Lk 12 und 17Evtl. auch Mk 12,28–34/Mt 22,34–40/Lk 10,25–28Teile der synoptischen ApokalypseAuf den ersten Blick könnte man immerhin erwägen, ob sich diese Fälle nicht eher mit der Abhängigkeit der ► Seitenreferenten von Markus als mit einer doppelten Tradition erklären lassen. Aber die Übereinstimmungen zwischen Matthäus und Lukas gegen Markus zeigen, dass die Seitenreferenten hier auf eine Q-Vorlage zurückgegriffen haben. Wir verdeutlichen uns das an einem allgemein als ► Doppelüberlieferung anerkannten Text, nämlich Mk 1,7 f. par., unbeschadet der bereits erwähnten Tatsache, dass Geltung beanspruchende Lösungen sich an allen in Frage kommenden Fällen bewähren müssen.
In Mk 1,7 f. weisen zunächst folgende Momente den parallelen Matthäus-und Lukastext als zur Logienquelle gehörig aus:
(a) die über den Markuskontext hinausschießende Rede von der Feuertaufe bei Matthäus (3,11) und Lukas (3,16) – bei Annahme einer Abhängigkeit vom Markusevangelium müsste man an eine bei beiden Evangelisten unabhängig voneinander entstandene Einfügung an der gleichen Stelle denken, was kaum plausibel zu machen ist,
(b) bei Lukas und Matthäus ist das Wort von dem kommenden Stärkeren direkt mit der Taufankündigung verbunden (Q 3,16), was bei Markus so nicht der Fall ist. Markus fügt zwischen dem Hinweis auf den Kommenden und dessen Taufe noch eine Bemerkung über die Taufe des Johannes ein, die bei Matthäus und Lukas am Beginn des Absatzes steht,
(c) die Verbindung mit dem Gerichtswort von Spreu und Weizen, das sich bei Markus nicht findet.
Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten im Matthäus- und Lukasevangelium in Abweichung vom Markusevangelium ergibt sich, dass Matthäus und Lukas hier auf eine gemeinsame Vorlage zurückgreifen, also von der Logienquelle abhängig sind. Da Markus von Q erheblich abweicht, müsste ihm, wenn auch er Q folgen sollte, eine ziemlich unterschiedliche Fassung der Taufperikope in Q vorgelegen haben – mit welchen Argumenten lässt sich die Annahme einer Abhängigkeit des Markus von Q an dieser Stelle stützen? Es sind im Grunde nur zwei Gründe:
(a) Es war die Q-Redaktion, die den Heiligen Geist in das ursprünglich nur von einer Feuer- = Gerichtstaufe sprechende Wort Q 3,16 eingefügt hat. Da Markus nur von einer Geisttaufe spricht, soll er von der Q-Redaktion abhängig sein.
(b) Die Markusfassung lässt sich ohne Schwierigkeiten als redaktionelle Umformung der (rekonstruierten) Q-Fassung verstehen.
Selbst wenn man davon absieht, dass die Traditionsgeschichte von Q 3,16 auch ganz anders gesehen werden kann und z. B. auch die Einfügung des Feuermotivs auf der Ebene von Q in der Literatur vertreten wird, so sind diese Argumente kaum überzeugend, weil in gewisser Weise beliebig. Die Einfügung des Geistmotivs in das Taufwort Q 3,16 durch die Redaktion der Logienquelle lässt sich in keiner Hinsicht ausreichend begründen und die Beschreibung der Markusversion als redigierte Q-Fassung grenzt an eine petitio principii, wenn ausgeführt wird: Markus räume dem Täufer und seiner Predigt keinen selbständigen Platz mehr ein, verstehe ihn vielmehr vollkommen als Vorläufer Jesu, und deswegen wolle er nicht, dass die ersten Worte des Täufers von seiner Taufe handeln, sondern vom Kommen Jesu. So richtig die erste Beobachtung ist, so wenig zwingend ist die daraus gezogene Konsequenz! Wäre es, wenn man diese Intention dem Markus unterstellt, nicht besser gewesen, er hätte die Taufe des Johannes ganz unterschlagen? Wenn auch die Markusfassung des Taufwortes aufgrund der Gegenüberstellung von Taufe des Täufers und Taufe des Stärkeren mit Heiligem Geist nach allgemeiner Einschätzung jünger ist als die von Matthäus und Lukas gebotene Q-Fassung, die die kommende Taufe durch den Hinweis auf das Feuer zumindest auch auf das kommende Gericht bezieht, so ist deswegen die Annahme einer Abhängigkeit der Markusfassung von der Logienquelle in keiner Weise notwendig.
Beispiel für Kenntnis von Q durch Mk?
Gewisse Beliebigkeit der Argumente
Da die Annahme einer Kenntnis der Logienquelle auf Seiten des Evangelisten Markus die Auslassung des größten Teiles von Q durch den zweiten Evangelisten nicht zu erklären vermag und die nicht zu leugnenden Gemeinsamkeiten zwischen dem Markusevangelium und der Logienquelle sich auch durch die gemeinsame Traditionsgeschichte der in Frage kommenden Stoffe erklären lassen, ist die Annahme, dass die Logienquelle zu den Vorlagen des Evangelisten Markus gehört hat, unnötig.
11. Theologische Grundlinien der Logienquelle
Fehlen von Jesu Tod und Auferweckung
Die theologische Besonderheit der Logienquelle wird sofort deutlich, wenn man die Themen und ihren Stellenwert beachtet, die in Q eine Rolle spielen, zugleich aber auch die Themen, die in den Evangelien und bei Paulus wichtig sind, bei Q aber gerade fehlen, in den Blick nimmt. Der auffälligste Unterschied besteht, wie bereits mehrfach erwähnt, darin, dass Jesu Tod und Auferweckung und vor allem der heilsmittlerische Charakter des Todes Jesu in der Logienquelle nicht genannt werden, was kleinere Anspielungen, wie sie in Q 6,22 f.(?)27–29(?); 11,47–51; 12,4(?); 13,34 f.(?); 14,27 vorliegen, nicht ausschließt. Wie einzigartig dieses Fehlen ist, mag die Tatsache verdeutlichen, dass auch heute noch eine Reihe von Exegeten annimmt, dass die Logienquelle das Passionskerygma zwar nicht nenne, es aber doch voraussetze und bejahe. Zwar kann diese Behauptung nicht einfach widerlegt werden, aber sie basiert vermutlich doch sehr stark auf einem ex-post-Standpunkt. Infolge der Dominanz der paulinischen Form des ► Kerygmas können sich viele Exegeten offensichtlich nicht vorstellen, dass es zumindest eine Zeitlang auch Jesusanhänger gegeben hat, die sich diese Form des Kerygmas – sagen wir es vorsichtig – nicht zu eigen gemacht haben. Aus Q kann m. E. nicht geschlossen werden, dass diese Sammlung nur zur Ergänzung eines schon vorhandenen Kerygmas gebildet wurde.
Ergänzender Charakter von Q?
Wer einen solchen, bloß ergänzenden Charakter von Q annehmen will, muss jedenfalls Gründe dafür benennen, warum die Tradenten von Q eine Logiensammlung niederschrieben, ohne das maßgebende Kerygma, dessen Ergänzung Q sein soll, mitzuüberliefern. Offensichtlich sahen sich die Tradenten von Q dazu berechtigt, Jesu Worte trotz seines Todes und unabhängig von seiner Auferstehung auch über den Tod hinaus als wirksam und bedeutungsvoll weiter zu predigen. Es ist daher vielleicht doch nicht so, wie viele christliche Theologen bislang gemeint haben, dass eine Weitertradierung der Verkündigung Jesu ohne die Erfahrung der Auferstehung im damaligen Judentum absolut unmöglich gewesen wäre. Dafür, dass das Hindernis für eine Weitertradierung der Jesusbotschaft nicht so groß war, wie wir Heutigen meinen, spricht im übrigen nicht nur die Logienquelle, sondern auch die Tatsache, dass mit der Hinrichtung des Täufers durch Herodes Antipas dessen Botschaft offensichtlich auch nicht einfach obsolet war, sondern von dessen Jüngern ebenfalls weitertradiert wurde. Allerdings fällt es zugegebenermaßen schwer, sich eine Gruppe von Jesusanhängern vorzustellen, die im Jahre 60 oder später noch nicht von seiner Auferstehung gehört hat. Man wird deswegen erwägen müssen, ob die Q-Gruppe sich vielleicht einem Teil der Jesusbewegung verdankt, der keine (oder nur wenige) Auferstehungserfahrungen gemacht hat (z. B. auch, weil ihnen der Irdische auch nach seinem Tod genug war) und dem deswegen die (an sich bekannten) Erscheinungen des Auferstandenen nicht so wichtig waren. Jedenfalls waren ihnen die Worte Jesu wesentlich wichtiger! In der Nichterwähnung des Heilstodes und der Auferstehung Jesu käme dann nicht deren Unkenntnis in der Gemeinde von Q, sehr wohl aber deren theologische Bewertung zum Ausdruck. Die Tatsache, dass die spätere Theologie die Akzente anders gesetzt hat und uns diese Akzentsetzung wichtig geworden ist, ist noch kein Argument dagegen, dass andere Zeiten und andere Gruppen, zumal wenn Teile von ihnen sehr eng mit dem irdischen Jesus verbunden waren, dies anders gesehen haben. Die gültige Tradition darf uns dafür nicht den Blick verstellen. Diese Überlegungen wären m. E. auch dann gültig, wenn z. B. hinter Q 6,46 noch die Kenntnis einer erhöhten Existenz Jesu hervorscheint, weil diese Kenntnis sich auch dann nur sehr vorsichtig und ganz unbetont in Q niedergeschlagen hat. Dass die Tradenten der Logienquelle den Tod Jesu nicht als einen alles verändernden Einschnitt gesehen haben, der die Jesusbotschaft in eine völlig veränderte Perspektive rückt, zeigt auch die Tatsache, dass sie, ohne auf Jesu Tod und Auferstehung zu reflektieren, die Ansage der Heilszeit in der Gegenwart auch nach seinem Tod weiterverkündet und vielleicht auch die Wundervollmacht aus der Zeit der Gegenwart Jesu in die Zeit nach Ostern hinübergerettet haben (Q 7,22; 10,9). Die Wende vom verkündigenden zum verkündigten Christus findet hier also, wenn überhaupt, nur sehr begrenzt statt. Der irdische Jesus ist die leitende Größe für Q! Auch für diese Fortsetzung der vorösterlichen Verkündigung ist wiederum der Jüngerkreis des Täufers die beste Analogie. Die Johannesjünger hielten ebenfalls trotz der Hinrichtung des Johannes an seiner Predigt und an seiner Taufe fest (vgl. Apg 19,1–7).
Keine oder nur wenige Auferstehungs-Erfahrungen in der Q-Gruppe
Verschiedene Theologien in der Urgemeinde
Heil und Ethik
Aber Q redet natürlich auch vom Heil. Aber nicht vom Heil allein durch den Glauben an das Heilsereignis in Jesus Christus wie bei Paulus, sondern das Heil wird mit den von Jesus erhobenen ethischen Forderungen zusammengebracht – hier haben wir durchaus eine Nähe zum späteren Matthäusevangelium, wo das, wie wir sehen werden, ganz ähnlich ist. Matthäus bringt diesen Gedanken auch mit Hilfe von Texten der Logienquelle zum Ausdruck. In der Logienquelle werden die Heilstexte freilich von den Gerichtstexten zahlenmäßig erheblich übertroffen, was sicher nicht nur eine Reaktion auf die Ablehnung Jesu, sondern auch auf die Ablehnung der nachösterlichen Q-Boten darstellt. Diese Ablehnung erklärt die Logienquelle mit der Halsstarrigkeit Israels, wie sie bereits im alttestamentlichen, deuteronomistischen Schema vom prophetenmordenden Israel zum Ausdruck kommt, das in Q ebenfalls auf Israel angewendet wird. Wie dieses Schema, so wollte auch die Gerichtspredigt von Q ursprünglich einmal Israel zur Umkehr führen. Ob Q auf der Ebene der letzten Redaktion noch diese Absicht hat, ist allerdings mehr als fraglich. Israel scheint von der Q-Gemeinde in seiner Gesamtheit aufgrund seiner Ablehnung der Q-Boten und ihrer Botschaft abgeschrieben zu sein und steht nicht mehr im Horizont des missionarischen Denkens von Q. Die Q tradierende Gemeinde hat bereits auch Heiden aufgenommen und stellt diese dem ihre Botschaft ablehnenden Israel als Vorbild gegenüber (Q 7,1–10; 10,13–15). Allerdings ist das Gericht nicht nur auf Israel gerichtet, sondern auch die eigene Gruppe steht unter dem Gericht, wenn sie nicht auf die Weisungen des von der Weisheit gesandten Lehrers Jesus hört und diese nicht befolgt (Q 6,46–49) oder wenn sie ihm in den Verfolgungen nicht die Treue bewahrt (Q 12,8 f.). Auch dieser Gedanke wird später vom Evangelisten Matthäus aufgenommen und noch verstärkt (Mt 7,21–27 unter Aufnahme von Q-Material; 25,31–46). – Q hebt aber nicht nur auf das Gericht zur Begründung für die Befolgung der Weisungen Jesu ab, sondern gibt typisch weisheitlich auch Begründungen aus der Schöpfung sowie aus der Menschenwelt, die sich durch solche Eindrücklichkeit auszeichnen, dass sie über das Matthäusevangelium sogar in das Bildgut der europäischen Kultur eingegangen sind. Man denke an die Lilien des Feldes und die Vögel des Himmels (Q 6,26.28–30.35; 11,11 f.; 12,6 f.).