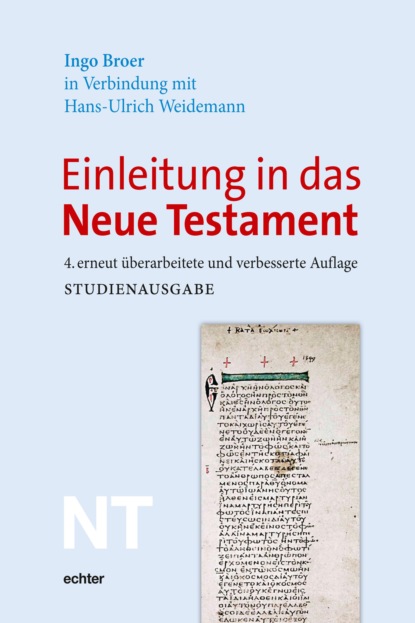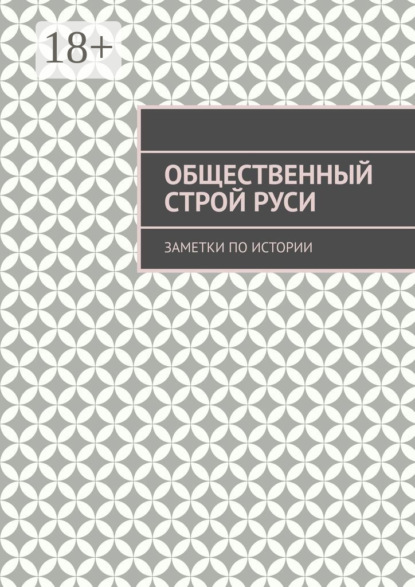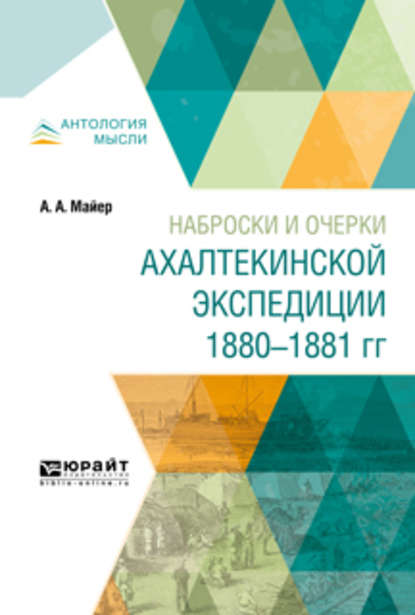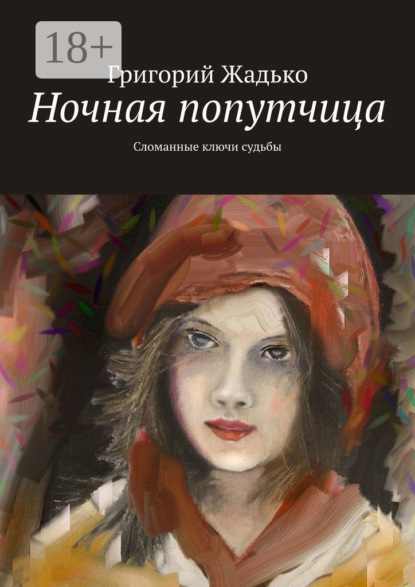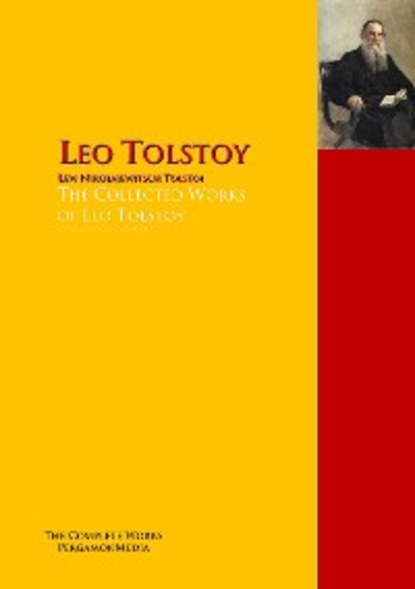- -
- 100%
- +
Ablehnung der Q-Boten
Bekehrung Israels?
Heiden als Vorbild
Schöpfungsethik
Unterschiedliche Antworten
Dem Wachstumsprozess entsprechend gibt Q für manche Problemkreise unterschiedliche Antworten. So finden sich neben positiven Worten über den Täufer (Q 7,24–28a) auch solche, die Johannes geringer schätzen, worin wir bereits einen Niederschlag der nachösterlichen Rivalität zwischen den Anhängern Jesu und denen des Johannes gesehen haben, wie sie sich im Johannesevangelium (Joh 1,6–8.20–27; 3,30) und überhaupt in der christlichen Vereinnahmung des Täufers als Vorläufer Jesu, als der sich der historische Johannes sicher nicht verstanden hat, zeigt. Auch bei den sog. christologischen Hoheitstiteln, v. a. beim Menschensohn-Titel, ist eine solche Entwicklung zwischen den einzelnen Schichten von Q noch erkennbar.
Literatur
1. Synopsen zurLogienquelle Q
The Critical Edition of Q. Synopsis including the Gospels of Matthew and Luke, Mark and Thomas with English, German and French Translation of Q and Thomas hg. v. J. M. ROBINSON, P. HOFFMANN, J. S. KLOPPENBORG, Leuven 2000; Die Spruchquelle Q. Studienausgabe, Griechisch und Deutsch, hg. u. eingel. von P. HOFFMANN u. C. HEIL, Darmstadt / Leuven 32009; KLOPPENBORG, J. S., Q-Parallels, Sonoma 1988 (griechischer Text mit englischer Übersetzung); POLAG, A., Fragmenta Q. Textheft zur Logienquelle, Neukirchen 1979 (griechischer Text); NEIRYNCK, F., Q-Synposis. The Double Tradition Passages in Greek (Studiorum Novi Testamenti Auxilia 13) Leuven 21995; SCHENK, W, Synopse zur Redenquelle der Evangelien, Düsseldorf 1981 (nur deutscher Text); SCHULZ, S., Griechisch-deutsche Synopse der Q-Überlieferungen, Zürich 1972.
2. Kommentare
FLEDDERMANN, H. T., Q. A Reconstruction and Commentary (Biblical Tools and Studies 1) Löwen 2005; SCHULZ, S., Q. Die Spruchquelle der Evangelisten, Zürich 1972; VALAN -TASIS, R., The New Q. Translation with Commentary, New York 2005; ZELLER, D., Kommentar zur Logienquelle (SKK. NT 21) Stuttgart 1993.
3. Monographien und Aufsätze
(die Literatur zu diesem Thema ist in den letzten Jahren so angewachsen, dass hier nur einige wenige Titel genannt werden können)
ROBINSON, J. R. / HOFFMANN, P. / KLOPPENBORG, J. S. (Gen. Eds.), Documenta Q. Reconstructions of Q Through Two Centuries of Gospel Research Excerped, Sorted and Evaluated – verschiedene Bände, Leuven ab 1996.
BECKER, E.-M. (Hg.), Mark and Matthew I. Comparitive Readings. Understanding the Earliest Gospels in their first-century Settings (WUNT 271) Tübingen 2011; BERGEMANN, T, Q auf dem Prüfstand. Die Zuordnung des Mt / Lk-Stoffes zu Q am Beispiel der Bergpredigt (FRLANT 158) Göttingen 1993; BIGGS, H., The Q Debate Since 1955, in: Themelios 6 (1981) 18–28; CATCHPOLE, D. R., The Quest for Q, Edinburgh 1993; DEVISCH, M., La relation entre l’évangile selon Marc et le document Q, in: Sabbe, M. (Hg.), L’évangile selon Marc. Tradition et redaction (BEThL 34) Leuven 1974, 59–91; FLEDDERMANN, H. T., Mark and Q. A Study of the Overlap Texts, with an Assessment by F. Neirynck (BEThL 122) Leuven 1995; GOODACRE, M., The Case Against Q, Harrisburg 2002; DERS. / PERRIN, N. (Hg.), Questioning Q, London 2004; HEIL, C., Lukas und Q (BZNW 111) Berlin / New York 2003; HOFFMANN, P, Art. Logienquelle, in: LThK 36, 1019–1021; ders., Studien zur Theologie der Logienquelle (NTA 8) Münster 1982; HORN, F. W., Christentum und Judentum in der Logienquelle, in: EvTh 51 (1991) 344–364; JACOBSON, A. D., The First Gospel. An Introduction to Q, Sonoma 1992; KLOPPENBORG, J. S. (Hg.), The Shape of Q. Signal Essays on the Sayings Gospel, Minneapolis 1994; ders., The Formation of Q. Trajectories in Ancient Wisdom Collections (Studies in Antiquity and Christianity) Philadelphia 1987; ders., The Sayings Gospel Q: Recent Opinions on the People Behind the Document, in: CR. BS 1 (1993) 9–34; ders., Nomos and Ethos in Q, in: Goehring, J. E. / Sanders, J. T. / Hedrick, Ch. W. mit Betz, H. D. (Hg.), Gospel Origins and Christian Beginnings. In Honor of J. W. Robinson, Sonoma 1990, 35–48; ders., Synoptic Problems. Collected Essays (WUNT 329) Tübingen 2014; KOSCH, D., Die eschatologische Tora des Menschensohnes. Untersuchungen zur Rezeption der Stellung Jesu zur Tora in Q (NTOA 12) Freiburg / Schw. u. a. 1989; LINDEMANN, A., Neuere Literatur zur Logienquelle Q, in: ThR 80 (2015) 377–424; LÜHRMANN, D., Die Redaktion der Logienquelle (WMANT 33) Neukirchen 1969; MACK, B. L., The Lost Gospel. The Book of Q and Christian Origins, San Francisco 1993; MORGENTHALER, R., Statistische Synopse, Zürich 1971; MYLLYKOSKI, M., The Social History of Q and the Jewish War, in: Uro (s. u.) 143–199; PIPER, R. A. (Hg.), The Gospel behind the Gospels. Current Studies on Q (SuppNT LXXV) Leiden 1995; ROLLENS, S. E., Framing Social Criticism in the Jesus Movement. The Ideological Project in the Sayings Gospel Q (WUNT II/374) Tübingen 2014; SATO, M., Q und Prophetie. Studien zur Gattungs- und Traditionsgeschichte der Quelle Q (WUNT II 29) Tübingen 1988; SCHÜLING, J., Studien zum Verhältnis von Logienquelle und Markusevangelium (fzb 65) Würzburg 1991; SCHÜRMANN, H., Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zu den synoptischen Evangelien, Düsseldorf 1968; THEISSEN, G., Lokalkolorit und Zeitgeschichte in den Evangelien. Ein Beitrag zur Geschichte der synoptischen Tradition, Freiburg, Schw. / Göttingen 21992; TIWALD, Die Logienquelle, Stuttgart 2016; ders. (Hg.), Kein Jota wird vergehen. Das Gesetzesverständnis der Logienquelle vor dem Hintergrund frühjüdischer Theologie (BWANT 200) Stuttgart 2012; ders. (Hg.), Q in Context I. Die Scheidung zwischen Gerechten und Ungerechten in Frühjudentum und Logienquelle (BBB 172) Göttingen 2015; TÖDT, H. E., Der Menschensohn in der synoptischen Überlieferung, Gütersloh 1959; TUCKETT, C. M., Q and the History of Early Christianity. Studies on Q, Edinburgh 1996; ders., From the Sayings to the Gospels (WUNT 328) Tübingen 2014; URO, R. (Hg.), Symbols and Strata. Essays on the Sayings Gospel Q (SESJ 65) Helsinki u. a. 1996; ZELLER, D., Eine weisheitliche Grundschrift in der Logienquelle?, in: Segbroeck, F. v. / Tuckett, C. M. / Belle, G. v. / Verheyden, J. (Hg.), The Four Gospels (Fs F. Neirynck) (BEThL 100) Leuven 1992, 389–401; ZELLER, D., Redaktionsprozesse und wechselnder „Sitz im Leben“ beim Q-Material, in: Delobel, J. (Hg.), Logia. Les Paroles de Jesus – The Sayings of Jesus. Memorial Joseph Coppens (BEThL 59) Leuven 1982, 395–409.
Die Schwierigkeiten, vor die das älteste Evangelium die Forschung stellt, sind in der letzten Zeit besonders deutlich hervorgetreten. Zu Recht ist betont worden, dass kein Evangelium, auch nicht das Johannesevangelium, so viele Streitfragen hervorgerufen hat, wie das des Markus und dass die Auffassungen in der Literatur hier nicht aufeinander zulaufen, sondern immer stärker divergieren.
1. Gliederung des Evangeliums
Markus hat die Gliederungssignale offensichtlich nicht so gesetzt, dass sie uns Heutigen noch klar erkennbar wären.
Inhaltliche Gliederung
Kriterien
Darauf weist nicht nur die Uneinheitlichkeit der Gliederungsversuche hin – in der Literatur sind zweigliedrige, dreigliedrige und zahlreiche mehrgliedrige Aufteilungen vorgeschlagen worden, die bis zu sieben Abschnitten reichen, und die Einschnitte werden teilweise an ganz unterschiedlichen Stellen vorgenommen –, sondern auch der Umstand, dass der Übergang selbst an den Stellen gelegentlich sehr eng ist, wo häufig Unterteilungen vorgenommen werden, so z. B. vor 1,14.16 oder 6,29. Es kommt sicher nicht von ungefähr, dass zahlreiche Gliederungsversuche einen Einschnitt vor 1,14 finden und zahlreiche andere einen solchen erst vor 1,16. Diese Unsicherheit dürfte darin ihren Grund haben, dass das Gliederungsprinzip im Inhalt gefunden wird, ohne dass sich ein deutliches formales Signal finden lässt. Man kann sich insofern über die unterschiedlichen Gliederungsversuche nicht wundern. An sich könnte man aus der antiken Schreibkultur, die jedenfalls bei den Schriften des Neuen Testaments ohne Absätze und ohne Zwischenüberschriften verfährt, den Schluss ziehen, Gliederungssignale wären damals nicht so wichtig gewesen, jedoch lassen sowohl die Abhandlung des Aristoteles über die Poetik (z. B. Poetik 12; vgl. auch Rhetorik 3,13) als auch die vielfältigen Überlegungen zur dispositio in der antiken Rhetorik (vgl. nur Quintilian, inst. or. 3,3,1 ff.) eine solche Überlegung als abwegig erscheinen.
Die Uneinheitlichkeit der Gliederungsversuche hat freilich nicht nur in der markinischen Eigenart des Evangeliums mit seinen fließenden Übergängen ihren Grund, sondern auch in dem zu Recht angemahnten Fehlen einer einheitlichen Kriteriologie der Forschung. Denn als Kriterium für die Gliederung hat man so unterschiedliche Aspekte wie die geographische Aufteilung des Evangeliums, die Anlehnung an den jüdischen Festkalender oder das antike Drama, den Inhalt, die Sammelberichte, die Zeitebenen oder auch die ► Stichometrie benutzt.
Dreiteilung
Anhand inhaltlicher und geographischer Merkmale wird man von einer dreiteiligen Gliederung des Corpus des Evangeliums mit einem Prolog ausgehen. Die Möglichkeit, die Haupteinschnitte noch einmal zu unterteilen, ist dabei durchaus gegeben. Die Anwendung dieser Kriterien erscheint auch deswegen gerechtfertigt, weil die mehr auf formaler Analyse aufbauenden Gliederungsversuche m. E. ebenfalls inhaltliche Argumente enthalten.
Aufbau
1,1Überschrift (incipit)1,2–13Der Markusprolog: Johannes der Täufer, die Taufe und die Erprobung Jesu1,14–8,26Jesu öffentliches Wirken in Galiläa und Umgebung1,14–3,35Beginn der Verkündigung Jesu und Berufung der ersten Jünger, erster Zyklus von Machttaten und beginnende Auseinandersetzungen, Erwählung der Zwölf4,1–34Am See Genesareth: Die Gleichnisrede4,35–8,26Um den See Genesareth: Zweiter Zyklus von Machttaten (auch in nichtjüdischen Gegenden) und weitere Auseinandersetzungen8,27–10,52Jesus auf dem Weg von Caesarea Philippi nach JerusalemLeidensankündigungen, die Verklärung Jesu, Fragen der Nachfolge, Heilung des blinden Bartimäus11,1–16,8Letzte Tage in Jerusalem, Tod und Auferstehung Jesu11–12Einzug, Tempelaktion und Auseinandersetzungen mit Jerusalemer Gegnern13Die Endzeitrede14–15Passion, Tod und Begräbnis Jesu16,1–8Die Auffindung des leeren Grabes(16,9–20Sekundärer Markusschluss)2. Der Anlass für die Abfassung des Markusevangeliums
Markus: der „Erfinder“ der Gattung Evangelium
Was Markus tat, war neu, um nicht zu sagen revolutionär, und nicht neu zugleich:
Es war neu, insofern hier erstmalig die mündlichen Einzeltraditionen und die Sammlungen von mehreren Einzelgeschichten (z. B. Wundergeschichten) in den Rahmen der öffentlichen Wirksamkeit Jesu eingepasst, unter das Schema „Von Galiläa nach Jerusalem“, oder besser „Von der Taufe Jesu durch Johannes den Täufer bis zur Auferstehung in Jerusalem“ subsumiert und unter bestimmte theologische Leitgedanken gestellt wurden.
Es war nicht neu, insofern nach Ausweis seines Evangeliums vermutlich auch in seiner eigenen Gemeinde das Christusereignis mit Hilfe von solchen Geschichten aus dem Leben Jesu verkündigt wurde und insofern es auch schon vor der Abfassung seines Werkes kleinere Sammlungen von Einzelperikopen gegeben hat, die er in sein Werk integrierte.
Die Originalität der Absicht des Markus, die uns wegen unserer Vertrautheit mit der Gattung nicht besonders auffällt, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden und übersteigt z. B. die des Matthäus trotz der großartigen Konzeption des Matthäusevangeliums bei weitem. Markus verfiel als Erster auf die Idee, die überwiegend mündlich umlaufenden Jesusgeschichten nicht nur zu sammeln, sondern unter einer Gesamtperspektive als „literarisches“ Werk herauszubringen und als Evangelium zu begreifen.
Sitz im Leben: der Gottesdienst
Angesichts unserer Kenntnis von der Verlesung der Paulusbriefe im Gottesdienst der ersten Christen (vgl. Kol 4,16; auch 2 Petr 3,14–16) und der Rolle des Alten Testaments im Synagogengottesdienst ist davon auszugehen, dass der ► Sitz im Leben der Einzelgeschichten ebenfalls der Gottesdienst war.
Lesen und Vorlesen in der Antike
Man kann dafür des weiteren anführen, dass „Bücher“ selten und kostbar waren und dass die Fertigkeit des Lesens unter den damaligen Christen sicher nicht allzu weit verbreitet war.
Gleichwohl dürfte die Verlesung im Gottesdienst keinesfalls der einzige Abfassungszweck gewesen sein, weil diese atomisierende, das Ganze in kleine Abschnitte aufteilende Art, das Evangelium zur Kenntnis zu bringen, der Gesamtkomposition und den zugrunde liegenden Leitgedanken, ganz abgesehen von dem Spannungsbogen, nicht gerecht zu werden vermag. Allerdings geschah Lesen in der Antike sehr häufig als Vorlesen, und offensichtlich waren die Zuhörer in der Lage, nicht nur kompliziertere und längere, sondern auch übergreifende Zusammenhänge zu erkennen, was für uns weitgehend an eine schriftliche Kultur Gewöhnte wesentlich schwieriger ist. Von daher ist dieser Einwand gegen das Vorlesen wohl kaum durchschlagend. Im übrigen bezeugt bereits Thukydides, dass Bücher „zum dauernden Besitz, nicht als Prunkstück fürs einmalige Hören“ geschrieben wurden (I 22,4, vgl. aber auch 22,3: „Zum Zuhören wird vielleicht diese undichterische Darstellung minder ergötzlich scheinen“).
Unbeschadet der Frage, ob Markus oder die Verfasser der anderen Evangelien nun primär Leser oder Hörer im Blick gehabt haben, beweist Justin, Apol. I 67,3 für die Mitte des zweiten Jahrhunderts das Vorlesen der Evangelien im Gottesdienst:
„An dem Tage, den man Sonntag nennt, findet eine Versammlung aller statt, die in Städten oder auf dem Lande wohnen; dabei werden die Denkwürdigkeiten der Apostel oder die Schriften der Propheten vorgelesen, solange es angeht.“ (nach der Übersetzung von G. Rauschen in BKV; dass mit den „Denkwürdigkeiten der Apostel“ die Evangelien gemeint sind, geht aus Apol. I 66 eindeutig hervor).
Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Markus sein Werk für den Gottesdienst seiner Gemeinde geschaffen hat.
Das Werk und sein Anlass
Was Markus dazu veranlasst hat, die Jesusgeschichten nicht nur einfach zu sammeln, so wie etwa der Verfasser der Logienquelle die Jesusworte gesammelt hat, sondern ein Werk mit Leitgedanken und Spannungsbogen zu verfassen, wissen wir nicht, und wir sind zur Beantwortung dieser Frage ausschließlich auf sein Werk verwiesen. Es bedeutet aber nicht, aus der Not eine Tugend zu machen, wenn man überlegt, ob sich die Absicht des Markus nicht gerade aus diesem Werkcharakter des Evangeliums ergibt.
Die mündliche Tradierung der Einzelgeschichten im Gottesdienst war offensichtlich nicht in der Lage, das zu leisten, was er mit seinem Werk leisten wollte, nämlich das „Evangelium von Jesus Christus“ (1,1) adäquat zum Ausdruck zu bringen, weil die Einzelgeschichten in der Regel entweder den Christus der Herrlichkeit oder den des Leidens zur Sprache brachten, während es Markus gerade darauf ankam, beides miteinander zu verbinden und gemeinsam zur Sprache zu bringen.
Die Binnenperspektive des Buches
Von daher ergibt sich auch die Frage, ob die häufig genannte Zweckbestimmung, das Werk solle den Glauben wecken und stärken, ganz zutrifft und ob man beide Zwecke als gleichberechtigt nebeneinander stehend ansehen darf. Diese Zweckbestimmung nimmt ja die in der formgeschichtlichen Phase der Evangelienkritik für die Einzelperikopen angenommenen Zwecke auf und überträgt sie auf das Gesamtwerk. Muss man schon fragen, ob in einer heidnischen Umgebung die Missionspredigt einfach mit dem Christuskerygma einsetzen kann, so wird man angesichts des Ringens des Verfassers um das zutreffende Verständnis von Jesus, dem Christus, m. E. eher eine Binnen- als eine Außenperspektive für das Werk annehmen.
Markus geht mit seinem Werk erheblich über die ihm vorliegenden Sammlungen von Einzelgeschichten hinaus. Er schafft etwas völlig Neues und wendet sich vorrangig an Menschen, die schon Christen sind. Allenfalls in zweiter Hinsicht schreibt er ein Werk für die Missionspropaganda.
3. Die Frage nach dem Verfasser des Markusevangeliums
Die Überschrift
Das älteste Evangelium nennt den Namen seines Verfassers nicht. Der Name Markus, mit dem wir dieses traditionsgemäß verbinden, stammt zum einen aus der Überschrift, den dieses Werk in den neutestamentlichen ► Handschriften, die einen Titel bieten, trägt, zum anderen aus der Kirchenväterliteratur, in der Markus mehrfach als Verfasser eines Evangeliums genannt wird. Da jedoch die Überschrift jedenfalls beim Markusevangelium ohne Zweifel nicht ursprünglich ist, wie sich schon daraus ergibt, dass sie der Unterscheidung von anderen Werken / Evangelien dienen soll, die es zur Zeit der Abfassung des Markusevangeliums noch gar nicht gegeben hat und die bei der Abfassung dieses Werkes auch nicht unbedingt zu erwarten waren, müssen die Nachrichten aus der Väterliteratur genauer unter die Lupe genommen werden.
3.1 Ausgangspunkt Alte Kirche
Das Zeugnis des Papias
Das älteste Zeugnis verdanken wir Papias von Hierapolis, der um 120 oder 130 die fünf Bücher der „Erklärungen von Herrenworten“ verfasst hat, die leider nur in Auszügen erhalten sind. In diesen Büchern beruft er sich für das folgende Zeugnis über das Markusevangelium auf einen ► Presbyter Johannes, der Jünger des Herrn gewesen sei, so dass dieses Zeugnis uns vermeintlich direkt in die Urgemeinde und ihre Ansichten zu den Evangelien hineinführt.
„Auch dies lehrte der Presbyter: Markus hat die Worte und Taten des Herrn, an die er sich als Dolmetscher des Petrus erinnerte, genau, allerdings nicht der Reihe nach, aufgeschrieben. Denn er hatte den Herrn nicht gehört und begleitet; wohl aberfolgte er später, wie gesagt, dem Petrus, welcher seine Lehrvorträge nach den Bedürfnissen einrichtete, nicht aber so, dass er eine zusammenhängende Darstellung der Reden des Herrn gegeben hätte. Es ist daher keineswegs ein Fehler des Markus, wenn er einiges so aufzeichnete, wie es ihm das Gedächtnis eingab. Denn für eines trug er Sorge: nichts von dem, was er gehört hatte, auszulassen oder sich im Berichte keiner Lüge schuldig zu machen.“ (Eusebius, Kirchengeschichte III 39,15 in der Übersetzung von Ph. Haeuser, neu durchgesehen von H. A. Gärtner. Zu der Interpretation dieses Zeugnisses durch J. Kürzinger vgl. unten § 6 Nr. 3.5.1)
Der Dolmetscher Petri?
Die Frage, wie das in dieser Übersetzung mit „Dolmetscher“ wiedergegebene griechische Wort zu verstehen ist, ist in der Literatur heftig diskutiert worden, und man hat gefragt, ob Petrus denn wirklich auf einen Übersetzer angewiesen war. Wenn man Jesus die Kenntnis des Griechischen abspricht, kann man sie Petrus freilich nicht einfach zusprechen, obwohl Petrus sich das Griechische auch noch während seiner Missionstätigkeit angeeignet haben kann.
Der apologetische Charakter des Papiaszeugnisses
Unbeschadet der Auslegungsschwierigkeiten dieses Textes ist der apologetische Charakter dieses Zeugnisses doch offensichtlich. Der Verfasser dieser Nachricht verspürt für jeden Leser deutlich erkennbar die Notwendigkeit, die Zuverlässigkeit des Markusevangeliums gegen Angriffe zu verteidigen, kann dabei aber gleichzeitig den Tatbestand einer gewissen Unordnung nicht bestreiten.
Er wählt deswegen eine andere Strategie zur Verteidigung des Markusevangeliums: Diese Unordnung ist, anders als die Kritiker meinen, nach Ansicht des Papias eher als Zeugnis für die Authentizität des Evangeliums als gegen diese zu werten, wenn man sich nur die Entstehungsverhältnisse klar macht! Es handelt sich eben nicht um den Bericht eines Augenzeugen, sondern um Erinnerungen an die Predigten des Petrus, und diese waren nicht systematisch oder historisch geordnet, sondern waren nach den Bedürfnissen der Zuhörer gestaltet.
Auf diese Weise leistet der Hinweis des Papias ein Doppeltes: Er kommt den schon damals offensichtlich vorhandenen Kritikern entgegen, räumt ihnen teilweise die Berechtigung ihrer Kritik ein und ist gleichwohl in der Lage, das Werk des Markus und dessen Authentizität zu verteidigen.
Wenn man nicht davon ausgehen will, dass es im zweiten Jahrhundert, also zur Zeit des Papias, noch Menschen gegeben hat, die für sich eine unmittelbare Kenntnis der Jesusgeschichte beanspruchten, worauf im übrigen nichts hinweist, dann muss man fragen, auf welchem Hintergrund diese Kritik am Werk des Markus, die sich auf dessen (Un-)Ordnung bezieht, vorgetragen wird. Was war der Maßstab der Kritiker, von woher konnten sie sagen, das Markusevangelium entspreche nicht der richtigen Reihenfolge? Wahrscheinlich spielen die nicht geringen Divergenzen zwischen den Evangelien des Matthäus und Markus hier hinein, und das „kirchliche“, weil in der Kirche von Anfang an besonders beliebte Matthäusevangelium gibt den Maßstab ab, an Hand dessen das Markusevangelium, das im übrigen in der Alten Kirche immer nur auf geringes Interesse gestoßen ist, als weniger der Ordnung entsprechend angesehen wird.
Die Lösung des Presbyters
Mit dem Hinweis auf die Predigten des Petrus unterläuft der ► Presbyter geschickt den Vorwurf der Unordnung und setzt das Markus- wie das Matthäusevangelium gleichermaßen als zuverlässig ins Recht. Das Matthäusevangelium biete die zutreffende Ordnung der Worte und Taten Jesu, während das Markusevangelium ein Erinnerungswerk sei, das auf den Predigten des Petrus basiert und schon von daher – eine freilich andere – Authentizität atmet.
3.2 Moderne Versuche, das Zeugnis des Papias zu kontrollieren
Das Zeugnis des Papias ist in der Forschung nun immer wieder in der Hoffnung einer intensiven Nachprüfung unterzogen worden, dieses kontrollieren und die Identität des von Papias genannten Markus feststellen zu können.
Das Ergebnis dieser Bemühungen ist freilich sehr unterschiedlich. Ist das Papiaszeugnis nach Meinung der einen praktisch wertlos und verdankt es seine Existenz überhaupt nur dogmatisch-ideologischen Interessen, so ist nach anderen dieses Zeugnis zuverlässig. Das Überleben des Markusevangeliums nach der Abfassung des Matthäusevangeliums ist nach diesen Autoren nur verständlich, wenn es von Anfang an mit der Autorität des Petrus in Verbindung stand. Diese Nähe des zweiten Evangeliums zu Petrus findet sich übrigens nicht nur bei Papias, sondern auch in anderen Zeugnissen der Kirchenväter.
3.2.1 Der (Johannes) Markus des Neuen Testaments
Markus: Ein Jerusalemer Judenchrist?
Bei der Auswertung des Papiaszeugnisses spielt eine erhebliche Rolle, dass im Neuen Testament selbst an verschiedenen Stellen ein Markus genannt wird, und an einer Stelle sogar ein Markus in enge Beziehung zu Petrus gebracht ist: 1 Petr 5,13 (eine Stelle übrigens, die Papias gekannt haben dürfte, vgl. Eusebius, Kirchengeschichte III 39,17). Der dort genannte „Sohn“ des Petrus wird in der Literatur – ob zu Recht oder zu Unrecht, kann hier zunächst einmal dahingestellt bleiben – sowohl mit dem in einigen (z. T. sekundär unter dem Namen des Paulus verfassten) Briefen erwähnten Markus (Kol 4,10;2 Tim 4,11;Philm 24) als auch mit dem in Apg 12,12.25;15,37.39 mehrfach genannten, aus Jerusalem stammenden und mit Paulus und Barnabas in Zusammenhang stehenden Johannes Markus identifiziert, obwohl diese Identifikation des Verfassers des Markusevangeliums mit dieser Person gleichen Namens in der altkirchlichen Literatur nirgendwo vorgenommen wird. Setzt man diese Identifikation voraus, kann man trefflich die Korrektur-Frage stellen, ob der Verfasser des zweiten Evangeliums ein aus Jerusalem stammender Jude sein kann.
3.2.2 Die geographischen Angaben im Markusevangelium und der Autor des zweiten Evangeliums
Kenntnis der Geographie Palästinas?
Die Klärung dieser Frage wird mit Hilfe verschiedener Überlegungen versucht, z. B. wird gefragt, ob der Verfasser des zweiten Evangeliums sich in der Geographie Palästinas und Galiläas auskennt, ob er die jüdischen Bräuche einwandfrei beschreibt und ob er noch eine Kenntnis der aramäischen Sprache erkennen läßt – all das wäre ja von einem Jerusalemer Judenchristen zu erwarten. Die Geographie-Kenntnisse Galiläas und Jerusalems auf seiten des Markus werden dabei häufig recht kritisch betrachtet, weil Markus in der Tat an einigen Stellen Jesus eine zumindest merkwürdige Wegstrecke zurücklegen lässt.