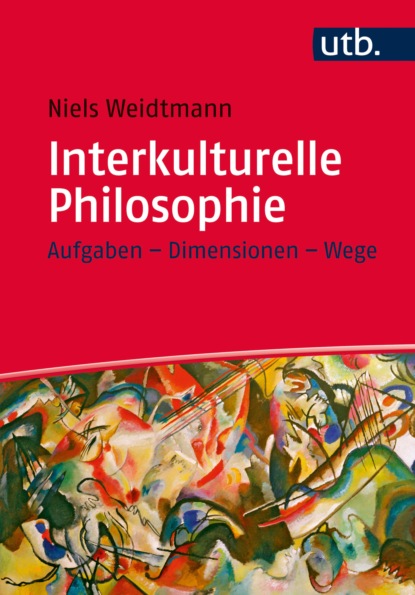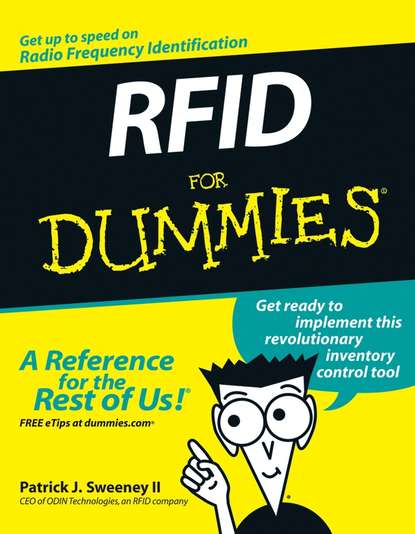- -
- 100%
- +
Philosophisch betrachtet stellt uns die Idee des Multikulturalismus freilich noch in anderer Hinsicht vor schwerwiegende Probleme. In ihm wird ein Kompromiss zwischen zwei einander widerstreitenden, gleichermaßen unverzichtbaren Einsichten in das Wesen des Menschen geschlossen, ohne dass dieser Kompromiss ein tieferes, die beiden widerstreitenden Einsichten unterfangendes Verständnis des Menschen darstellt. TaylorTaylor, Charles benennt die beiden einander widerstreitenden Einsichten in das Wesen des Menschen einerseits mit der Würde des Menschen, die darauf gründet, im Einzelnen das Menschsein überhaupt zu sehen, und andererseits der Einmaligkeit (Taylor spricht im Anschluss an Lionel Trilling von Authentizität) des Einzelnen, die gerade die Differenz zu anderen betont.3 Die Würde des Menschen besteht unabhängig von der Persönlichkeit des Einzelnen; sie kommt dem Menschen qua Menschsein zu, ja sie besteht gerade in der Einsicht darein, dass in jedem einzelnen Menschen das Menschsein im Ganzen auf dem Spiel steht – so, wie man einem einzelnen Menschen begegnet, so begegnet man der gesamten Menschheit. Anthropologisch gesehen ist nichts so universal wie die Menschenwürde. Eine Politik, die versucht, dieser wesensmäßigen Gleichheit aller Menschen Rechnung zu tragen, muss darauf abzielen, größtmögliche Gleichheit auch in der gelebten Praxis zu erreichen. Das betrifft in erster Linie die Gleichheit vor dem Gesetz, in der Folge aber auch die Gleichheit der den Einzelnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur freien Lebensgestaltung (Stichworte hierfür sind beispielsweise die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Gleichheit der Bildungs- und Berufschancen). Dieses in der Würde des Menschen begründete Gleichheitsdenken ist eine der wesentlichen Errungenschaften der Neuzeit. Dagegen steht nun eine weitere, nicht weniger fundamentale Einsicht in das Wesen des Menschen: Das Wesen des einzelnen Menschen erschöpft sich dieser Einsicht zufolge gerade nicht in dem, was er vor dem Gesetz ist oder wozu er durch die Wahrnehmung gesellschaftlich bereit gestellter Entfaltungsmöglichkeiten wird. Der Mensch ist dem zuvor als der, der er für sich selbst ist, einzigartig. Seine Entwicklung ist deshalb auch keinesfalls zufällig und allein von den verfügbaren Ressourcen und Möglichkeiten abhängig. Vielmehr folgt sie einer ›inneren Stimme‹ und bringt so das schlummernde Wesen des Einzelnen zur Entfaltung. Taylor macht diese Entdeckung der individuellen Subjektivität an Rousseau und HerderHerder, Johann G. fest. Die Anerkennung der Einzigartigkeit des Individuums führt zur Betonung der Differenz zwischen den Bürgern eines Staates. Letztlich ist jeder Bürger anders und bedarf darum auch einer anderen Behandlung durch den Staat (das entscheidende Stichwort hierfür liefern die besonderen Rechte für Minderheiten). Herder und HumboldtHumboldt, Wilhelm v. sind in diesem Zusammenhang besonders interessant, weil sie die Einzigartigkeit des Individuums auf Kulturen übertragen. So wie der Einzelne unverwechselbar ist, so bildet jede Kultur – in den Worten Wilhelm von Humboldts – ihre eigene »Weltansicht« aus;4 leitend ist dabei die Sprache, die sich gleichsam zwischen die Welt und den Verstand fügt. Kulturen sind für Humboldt und Herder deswegen zunächst einmal Sprachgemeinschaften – und auch diese sind, wie die Individuen, einzigartig.
Es ist leicht zu erahnen, dass diese beiden Grundannahmen über das Wesen des Menschen in einen Konflikt miteinander geraten können (wenn auch nicht notwendiger Weise müssen). Entweder alle Bürger einer Gesellschaft werden gleich behandelt, dann drohen bestehende Differenzen eingeebnet zu werden. Oder aber der Einzelne wird seinen individuellen Bedürfnissen entsprechend behandelt, dann ist dies ein Verstoß gegen das Gleichheitsprinzip. Eine nahe liegende Lösung wäre zu sagen, dass die Gleichheit gerade darin besteht, dass jeder individuell behandelt wird. Dass eine solche Lösung in der Praxis aber kaum möglich ist, wird am konkreten Beispiel schnell klar: Die Gleichberechtigung der Frau kann nicht darin bestehen, dass Frauen unterschiedlicher Herkunftsländer und Kulturen in ein und demselben Staat verschiedene Rechte besitzen. Bestimmte Grundrechte sind nicht verhandelbar; sie müssen auch dann gewährt sein, wenn dadurch bestehende kulturelle Differenzen eingeebnet werden. Multikulturalismus ist deshalb nur innerhalb eines klar gefügten Rahmens möglich, üblicherweise innerhalb eines Rechtsstaates, in dem jeder Bürger vor dem Gesetz gleich ist. Das macht deutlich, dass das Konzept der Multikulturalität selbst einer bestimmten Denktradition verbunden ist, nämlich dem modernen rechtsstaatlichen Denken, wie es sich in den liberalen westlichen Demokratien seit der amerikanischen Unabhängigkeit und der französischen Revolution nach und nach entwickelt hat.
Innerhalb eines rechtlich einheitlichen Rahmens lassen sich verschiedene Modelle des Multikulturalismus verwirklichen: Solche, die den Erhalt kultureller Eigenheiten aktiv fördern; und andere, die auf zunehmende Integration setzen. So oder so aber muss das Zusammenleben verschiedener Kulturen in einer Gesellschaft geregelt sein, ohne dass diese Regeln selbst von den einzelnen Kulturen verschieden ausgelegt werden dürfen. Ein solches Regelwerk, das die mit der Würde des Menschen zusammenhängenden Grundrechte sichert, ist aber keineswegs kulturell neutral. Es setzt beispielsweise das Recht über die Religion, was nicht nur in manchen anderen Kulturen undenkbar wäre, sondern auch in der europäisch-westlichen Tradition so erst in der Neuzeit möglich geworden ist. Vor allem aber liegt dem Modell der in ein Regelwerk gefassten multikulturellen Gesellschaft ein Verständnis von Kultur zugrunde, das diese gleichsam zur Privatsache erklärt, wohingegen allein das Regelwerk selbst öffentlichen Charakter hat.5 Was aber soll eine private Kultur sein? Der Begriff der Kultur macht überhaupt nur auf einer sozialen Ebene Sinn. Private Kulturen wären sinn-los – gerade so, wie Wittgenstein das für die Vorstellung einer Privatsprache zeigt. Wie die Sprache, so konstituiert sich auch die Kultur im wechselseitigen Austausch der Menschen untereinander als deren gemeinsame, und das heißt eben öffentliche, Lebenswelt. Eine solche Lebenswelt kann nicht nochmals in einen weiteren öffentlichen Raum eingebunden sein, es sei denn im Zuge der Konstitution einer weiteren, umfassenderen Kultur. Der Ansatz der Multikulturalität geht also einher mit einer Abwertung, ja Verkennung der konstitutiven Bedeutung, die Kultur für den Menschen hat. Gerade im multikulturellen Gesellschaftsmodell werden Kulturen nicht wirklich ernst genommen. Das mag ein Grund für die vielfältigen Schwierigkeiten sein, die im Zusammenleben verschiedener Kulturen in einer Gesellschaft immer wieder zu beobachten sind.6
BedorfBedorf, Thomas macht auf eine weitere Schwierigkeit aufmerksam.7 Die Konzeption der Multikulturalität hängt an der Anerkennung verschiedener kultureller Gruppen als gleichberechtigt innerhalb einer Gesellschaft. Anerkannt werden können aber immer nur konkrete Ausdrucksformen dieser kulturellen Gruppen, etwa ihre Sprachen, ihre Religionen, ihre Lebensstile. Darin gehen die Gruppen selber aber nicht auf. Im Prozess der Anerkennung werden die verschiedenen kulturellen Gruppen sozusagen notwendigerweise auf bestimmte Erscheinungsweisen festgelegt, die zwar möglicherweise wichtig sind für diese Gruppen, die aber bloße Erscheinungsweisen darstellen und das ›Wesen‹ der Gruppen darum niemals treffen können. Jede Form der Anerkennung führt zwangsläufig zu einer verkürzenden Sichtweise auf die anerkannten Gruppen. Bedorf spricht deshalb von »verkennender Anerkennung«. Ein ungewöhnliches, aber sehr anschauliches Beispiel dafür bietet der Konflikt über den Schutz der frankophonen Kultur Quebecs, von dem TaylorTaylor, Charles berichtet.8 In Quebec wurden in den späten 1970er Jahren eigene Sprachgesetze erlassen, die darauf abzielen, das Französische dem Englischen nicht nur gleichzustellen, sondern aktiv zur Bewahrung der französischsprachigen Tradition beizutragen.9 So ist es Eltern der französischsprachigen Bevölkerung Quebecs beispielsweise untersagt, ihre Kinder auf englischsprachige Schulen zu schicken. Damit wird, so die Kritik Bedorfs, die frankophone Kultur Quebecs auf die französische Sprache reduziert und das mit einer unglaublichen Konsequenz, so dass sich die Mitglieder dieser Kultur nun völlig unabhängig davon, wie wichtig ihnen selbst das Französische für ihr kulturelles Selbstverständnis tatsächlich ist, dem Diktat des Französischen ausgesetzt sehen. Ungewöhnlich ist das Beispiel vor allem deswegen, weil es im Falle Quebecs die Bevölkerungsmehrheit (bezogen auf ganz Kanada handelt es sich freilich um eine Minderheit) selbst ist, die diese Bestimmungen und damit eine auf die Sprache reduzierte Form ihrer eigenen Anerkennung festschreibt.
Um das Paradox einer verkennenden Anerkennung zu reflektieren, diskutiert BedorfBedorf, Thomas nun (unter Bezugnahme auf LévinasLévinas, Emmanuel, DerridaDerrida, Jacques und WaldenfelsWaldenfels, Bernhard) die Frage, worin eigentlich die Erfahrung der Andersheit gründet, die jeder Anerkennung vorausgehen muss. Etwas verkürzt könnte man sagen, dass das Entscheidende dieser Erfahrung darin liegt, dass der andere Mensch grundsätzlich als eigenständiges Subjekt erfahren wird. Der Andere taucht zwar in meiner Erfahrungswelt auf und ich kann ihn in der Rolle, die er in meiner Erfahrungswelt spielt, auch verstehen; er geht darüber aber weit hinaus, er ist immer unendlich viel mehr als in dieser Rolle zum Ausdruck kommt. Der Andere geht grundsätzlich in keiner meiner Erfahrungen und in keiner Rolle, die er einnimmt oder die ich ihm zuschreibe, auf, weil er selber Erfahrungen macht und deshalb jede konkrete gesellschaftliche Rolle, die er einnimmt und die ich erfahren kann, nur eine Momentaufnahme darstellt. Der Andere ist derjenige, der in den verschiedenen Rollen erscheint, selbst aber jenseits dieser Rollen für uns unerreichbar bleibt. »Radikal anders – unendlich – ist der Andere genau in dem Sinne, daß sein Erscheinen als solches, das Daß seines Auftretens, mit dem Wie der Rollen und Milieus nicht in eins zu setzen ist.«10 Auch wenn wir uns in den gleichen Kontexten bewegen, bleibt es deshalb eine dauernde Aufgabe, uns untereinander über unsere Erfahrungen zu verständigen. Nur so können wir eine geteilte Erfahrungswelt aufbauen. Diese wird aber immer vorläufig und begrenzt bleiben, und vor allem wird sie ständig auf dem Spiel stehen und der weiteren Verständigung bedürfen.
Der Andere widersetzt sich meiner Erfahrung also dadurch, dass ich ihn als selber Erfahrenden erfahre. Ich erfahre den Anderen als jemanden, der sich meiner Erfahrung entzieht. Darin liegt das Paradox der verkennenden Anerkennung begründet.11 In Anlehnung an LévinasLévinas, Emmanuel spricht BedorfBedorf, Thomas mit Blick auf dieses Paradox von der »primären« Andersheit, die er als »absolut« und »unendlich« kennzeichnet. Der Andere ist nicht lediglich vorübergehend oder in Bezug auf einzelne Aspekte anders, sondern entzieht sich meiner Erfahrung dadurch grundsätzlich, dass er selbst Erfahrender ist. Von der primären unterscheidet Bedorf nun eine »sekundäre, soziale Andersheit«, mit der jene Rollen gemeint sind, die der Andere in meiner mit ihm geteilten Erfahrungswelt einnimmt. Es ist diese sekundäre Andersheit, die anerkannt werden kann. Im Akt der Anerkennung liegt deshalb grundsätzlich eine Reduktion der primären Andersheit auf eine bestimmte Form sekundärer Andersheit. ›Die‹ frankophone Kultur Quebecs lässt sich nicht anerkennen, weil es sie als abgeschlossene oder wesensmäßige Entität gar nicht gibt. Sie ist grundsätzlich erfahrungsoffen und entzieht sich dadurch jeder Form von Festlegung. Diese primäre Andersheit lässt sich nun aber beispielsweise auf die Sprache als einer prominenten Form der sekundären Andersheit reduzieren. Und die Sprache, ihre Gleichberechtigung, ihr Erhalt und die ihr eigene Würde lassen sich nun sehr wohl anerkennen.
Auch wenn in jeder Form der Anerkennung also eine Verkennung liegt, so weist BedorfBedorf, Thomas doch darauf hin, dass uns dies nicht der Aufgabe, andere kulturelle Gruppen anzuerkennen, enthebt. Vielmehr sieht er gerade darin, dass wir in der Anerkennung primäre auf sekundäre Andersheit reduzieren, den Keim für unsere Verantwortung dem Anderen gegenüber liegen. Wir sind es, die den Anderen auf eine bestimmte Erscheinungsform festlegen, um seiner Forderung nach Anerkennung nachkommen zu können. Diese Festlegung haben wir zu verantworten und das in einem durchaus wörtlichen Sinn – nämlich so, dass wir die anerkennende Festlegung als eine Antwort auf die Forderung nach Anerkennung verstehen, nicht aber glauben, damit den Anderen erkannt zu haben. Eine solche Antwort bleibt sich ihrer Vorläufigkeit bewusst, die Anerkennung muss also immer wieder von neuem und auf neue Weise gestiftet und geleistet werden.
Es ist leicht ersichtlich, dass sich eine derart prozedural verstandene Form der Anerkennung umso leichter verwirklichen lässt, desto enger Menschen zusammenleben und desto mehr Erfahrungen sie teilen. Darin dürfte der Grund dafür liegen, dass Anerkennung innerhalb einer kulturellen Gruppe – in der sie zwischen den einzelnen Individuen selbstverständlich ebenso gefordert ist – leichter funktioniert als zwischen verschiedenen kulturellen Gruppen.
Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Multikulturalität das Zusammenleben verschiedener kultureller Gruppen in einer Gesellschaft beschreibt. Dabei werden bestimmte gesellschaftliche Rahmenbedingungen vorausgesetzt, die von allen Gruppen gleichermaßen akzeptiert werden müssen. TaylorTaylor, Charles nennt als entscheidende Prämissen einerseits die in der Würde des Einzelnen gründende Gleichberechtigung aller Menschen in einer Gesellschaft und andererseits das Recht auf Differenz (Einmaligkeit). Die jeweilige Gewichtung dieser beiden u.U. gegenläufigen Prämissen muss in der Gesellschaft immer wieder von neuem ausgehandelt werden. Multikulturalität ist Taylor zufolge darum letztlich nur in einer liberalen Gesellschaft möglich. Der Liberalismus steht aber selbst nicht jenseits aller Kulturen, sondern verdankt sich einer eigenen kulturellen Tradition. »Der Liberalismus«, so Taylor, »ist nicht die Stätte eines Austauschs aller Kulturen, er ist vielmehr der politische Ausdruck eines bestimmten Spektrums von Kulturen und mit einem anderen Spektrum anderer Kulturen unvereinbar«.1 Er bezeichnet ihn darum auch als »kämpferische Weltdeutung«.2
BedorfBedorf, Thomas macht zudem darauf aufmerksam, dass jede Form der Anerkennung zu einer Reduzierung der Andersheit der verschiedenen kulturellen Gruppen auf bestimmte Lebensformen in einer multikulturellen Gesellschaft führt. Multikulturalität als die Idee eines gleichberechtigten Nebeneinanders verschiedener kultureller Gruppen in einem gemeinsamen Staat stößt demnach an grundsätzliche Grenzen. Ein multikulturelles Miteinander erfordert klare gesetzliche Regelungen, die sich, wie am Beispiel der Sprachgesetze Quebecs gesehen, ihrerseits aber immer nur auf konkrete Ausdrucksformen der verschiedenen kulturellen Gruppen beziehen können und damit deren Eigenständigkeit (im Sinne der primären Andersheit) zwangsläufig auf bestimmte Besonderheiten (sekundäre Andersheit) reduzieren. Um einer solchen Reduktion zu begegnen, muss jede Form der Anerkennung vorläufig bleiben und laufend erneuert und verändert werden. Anerkennung ist nur im wechselseitigen Austausch zwischen den verschiedenen Gruppen und in kontinuierlicher Entwicklung möglich.
1.2 Transkulturalität
In den 1990er Jahren hat Wolfgang WelschWelsch, Wolfgang den Begriff der Transkulturalität in den deutschsprachigen Raum eingeführt und für eine kritische Reflexion des Kulturbegriffs herangezogen.1 Der Begriff geht auf Fernando OrtizOrtiz, Fernando zurück, der ihn bereits um 1940 dazu verwendete, den kulturellen Wandel auf Kuba zu beschreiben.2 Später wurde er, zunächst vor allem in Amerika, in verschiedenen Disziplinen aufgegriffen.3
WelschWelsch, Wolfgang übernimmt den Begriff der Transkulturalität, um die kulturelle Wirklichkeit der Gegenwart zu beschreiben, die, so Welsch, durch die Auflösung der Einzelkulturen geprägt ist. Das Leben des Einzelnen ist nicht so sehr durch seine kulturelle Herkunft als vielmehr durch die ökonomische Situation, durch Bildungschancen, politische Gestaltungsmöglichkeiten, die Freiheit des Glaubens, ökologische Rahmenbedingungen und viele weitere Faktoren bestimmt, die allesamt nicht kulturspezifisch sind, sondern in den verschiedenen Kulturen gleichermaßen virulent sind. In allen Kulturen stellen sich heute ähnliche Probleme, und immer häufiger lassen sich Antworten auf diese Probleme nur noch gemeinsam finden. Das führt zu einer Angleichung der Kulturen aneinander. Zugleich aber beobachten wir einen starken Differenzierungsprozess innerhalb der Kulturen. Früher als verbindlich erachtete Lebensformen weichen einer Vielzahl individueller Lebensstile, die längst auch Praktiken anderer kultureller Traditionen integrieren. So wird etwa die christliche Verwurzelung der meisten europäischen Kulturen keinesfalls nur durch den Abfall vom Glauben und eine sich stark verbreitende ›Unmusikalität‹ in Glaubensfragen (Max Weber) relativiert; vielmehr treten immer häufiger neben den christlichen Glauben auch andere Glaubensformen, die aus anderen Kulturen übernommen und in den Lebensentwurf von Menschen integriert werden, die in überwiegend christlich geprägten Gesellschaften leben. Noch viel offensichtlicher wird die Durchmischung der Kulturen mit Blick auf alltäglichere Phänomene, etwa die Essgewohnheiten, die Musik, die Literatur und den Sport. Ganz selbstverständlich hören wir heute afrikanische Musik (bezeichnender Weise unter dem Titel der ›Weltmusik‹), lesen lateinamerikanische Literatur und treiben asiatische Kampfsportarten. Die Durchlässigkeit der Kulturen wird durch Migration und globale Kommunikation immer weiter vorangetrieben. Keine Kultur kann es sich heute noch leisten, sich gegen andere abzuschotten und ihre eigenen Traditionen gegen äußere Einflüsse zu verwahren. Welsch spricht davon, dass kulturelle Authentizität heute zu Folklore verkommen ist. In jeder Kultur sind Lebensformen und -praktiken aller Kulturen zu finden. Diversifizierung der Einzelkulturen und Angleichung der verschiedenen Kulturen stellen die zwei Seiten ein- und desselben Prozesses dar: Dieser Prozess besteht in der Auflösung der traditionellen und traditionsbezogenen Kulturen zugunsten einer diversifizierten und transkulturellen Globalität. Der Einzelne gewinnt seine Identität nicht mehr vorrangig aus seiner kulturellen Herkunft, sondern setzt sie, so Welsch, aus einer Vielzahl von Komponenten ganz verschiedenen kulturellen Ursprungs zusammen.
Es ist WelschWelsch, Wolfgang wichtig zu betonen, dass ein solch transkulturelles Modell nicht nur besser geeignet ist, die gegenwärtige Situation zu beschreiben, sondern darüber hinaus auch in seinem normativen Anspruch vertretbar ist. Es befreit den Einzelnen aus kulturellen Zwängen und löst die Kulturen aus der abwehrenden Konkurrenz, in der sie Welsch zufolge traditionell zueinander standen (obwohl Welsch keinesfalls leugnet, dass es gelegentlich auch früher schon einen fördernden Austausch zwischen den Kulturen gegeben hat; nur war dies nicht die Regel und hat schon gar nicht das Selbstverständnis der Kulturen geprägt).
WelschWelsch, Wolfgang grenzt seine Konzeption der Transkulturalität strikt gegen jene von Multi- und Interkulturalität ab, denen er beiden vorwirft, an einem alten, traditionsbezogenen Kulturbegriff festzuhalten. Um diesen alten Kulturbegriff zu veranschaulichen, greift Welsch auf die HerderHerder, Johann G. entlehnte Metapher der Kugeln zurück. Demnach sind Kulturen kugelartig – in sich ruhend und nach außen abgeschlossen. Eine solche Vorstellung (die freilich so von Herder selbst gar nicht vertreten wurde) geht davon aus, dass jede Kultur ihr eigenes Wesen besitzt, das sich in allen Lebensformen dieser Kultur zeigt. Dieses traditionelle Kulturmodell ist deshalb das einer homogenen, substantiell kaum wandelbaren und eben deshalb in hohem Maße traditionsbezogenen Kultur. Zudem wird ein solch kugelartiges Kulturverständnis häufig mit einem einzelnen Volk in Verbindung gebracht, so dass die Zugehörigkeit zu einer Kultur damit korreliert, einem bestimmten Volk anzugehören. Schließlich sind die kugelartigen Kulturen auf ihr Wesen als dem eigenen Mittelpunkt bezogen und grenzen sich gegen andere Kulturen radikal ab. Daraus resultieren zahlreiche Konflikte. Welsch versteht die Konzeption der Interkulturalität nun als den Versuch, diesen Konflikten durch einen Dialog der Kulturen zu begegnen. Die Kulturen sollen trotz ihrer vehementen Abgrenzung gegeneinander lernen, sich wechselseitig zu respektieren und in Frieden miteinander zu leben. Ganz ähnlich versteht er auch Multikulturalität als das geregelte Nebeneinander verschiedener, voneinander getrennt bleibender kultureller Einheiten innerhalb einer Gesellschaft. Freilich, so ehrenhaft das Bestreben, Konflikte zu vermeiden, auch ist, kranken Welsch zufolge sowohl Interkulturalität als auch Multikulturalität daran, dass sie an einem traditionellen Kulturverständnis festhalten, das den Gegebenheiten der Gegenwart nicht mehr entspricht und ihren Anforderungen nicht genügen kann.
Das Konzept der Transkulturalität scheint die kulturelle Situation der Gegenwart auf den ersten Blick in der Tat adäquat zu beschreiben. Wir sind heute nicht mehr auf eine kulturell einheitliche Lebensform festgelegt; im Gegenteil, wir legen großen Wert auf einen individuellen Lebensstil und greifen bei der Gestaltung dieses Lebensstils ganz selbstverständlich auf Errungenschaften anderer Traditionen zurück. Schon der zweite Blick freilich sollte uns ein wenig vorsichtiger werden lassen. Was uns in Nord- und Mitteleuropa selbstverständlich zu sein scheint, gilt in anderen Gegenden nicht unbedingt in gleicher Weise. Schon im südeuropäischen Raum ist die Bindung an Traditionen ungleich stärker als im Norden. Und doch mag man die transkulturelle Beschreibung grosso modo für den gesamten Westen, einschließlich Nordamerikas gelten lassen. Aber leben die Menschen in islamisch geprägten Ländern auf gleiche Weise transkulturell? Wir unterstellen zumeist, dass sie das anstreben, und wundern uns dann, wenn religiös geprägte Parteien, die sich auf eine bestimmte Tradition stützen, in einer demokratischen Wahl an die Macht kommen. Wie steht es mit Schwarzafrika, mit Ostasien, mit Lateinamerika? Lassen sich die Unterschiede zwischen den Lebensformen in diesen Gegenden tatsächlich auf individuell verschiedene Stile reduzieren? Sicherlich, das Internet verbindet das afrikanische Dorf mit der japanischen Metropole, aber liegen die Unterschiede deshalb wirklich nur noch in der Differenz zwischen Dorf und Stadt, zwischen arm und reich begründet? Viel nahe liegender ist es anzunehmen, dass sich weiterhin die Lebenserfahrungen der nächsten Umgebung prägend auf die Gestaltung individueller Lebensstile auswirken. Diese Lebenserfahrungen freilich ändern sich in unserer globaler werdenden Welt. Insofern ist WelschWelsch, Wolfgang durchaus zuzustimmen in seiner Diagnose eines Wandels der Kulturen. Nur bedeutet ein solcher Wandel nicht die Auflösung konkreter, geschichtlich geprägter Lebenskontexte – und eben das sind die Kulturen.
Vor allem aber ist die Konzeption der Transkulturalität keineswegs voraussetzungslos: Die transkulturelle Gesellschaft setzt ganz ähnlich wie die multikulturelle einen liberalen, wertneutralen Rechtsstaat voraus, der die Gleichberechtigung der diversen Lebensformen und -stile sichert. Es sei darum nochmals an TaylorsTaylor, Charles Wort vom Liberalismus als einer »kämpferischen Weltdeutung« erinnert.4 Transkulturell kann eine Gesellschaft nur werden, wenn dies die Richtung ist, in die sich eine Kultur entwickelt. Transkulturalität ist dann aber eben auch nur so etwas wie ein kultureller Stil.
Aus philosophischer Sicht stellen sich freilich noch ganz andere Fragen. Die Vorstellung einer Auflösung der Kulturen zugunsten einer Pluralität von Lebensformen, die sich aus Komponenten verschiedener Traditionen zusammensetzen, offenbart ein Kulturverständnis, das gerade im Licht von WelschsWelsch, Wolfgang Kritik am traditionellen Kulturbegriff höchst fragwürdig erscheint:
Philosophisch gesehen liegt der entscheidende Schritt vom traditionellen zum transkulturellen Kulturbegriff, so wie WelschWelsch, Wolfgang beide darstellt, in der Auflösung einer als homogen und auf ihr eigenes Wesen ausgerichtet vorgestellten Entität zugunsten der Verflechtung, Durchmischung und Wechselbeziehung zwischen heterogenen und wandelbaren Lebensformen. Die Kulturen sind dieser Vorstellung zufolge nicht durch unveränderbare Wesensgehalte, sondern durch konkrete Lebensformen und Lebenspraktiken bestimmt. Die Lebensformen wandeln sich mit der Zeit und sie können sich kulturübergreifend mischen. Schon innerhalb einer Kultur treten ganz verschiedene Lebensformen in einen lebendigen Austausch untereinander und bedingen dadurch Heterogenität schon auf der Ebene des Individuums. So ist es viel zutreffender, jemanden als heterosexuell, vermögend, kinderlieb, fußballbegeistert und Liebhaber des No-Theaters zu beschreiben, denn ihn als Asiaten oder Japaner zu bezeichnen. Nicht die Herkunft, sondern die gelebte Praxis bestimmt, wer der Einzelne ist. Der Gedanke bleibt aber auf halbem Wege stehen, wenn man statt der Kulturen nun die verschiedenen Lebensformen als wesenhaft bestimmt versteht. Dann wäre die eben beschriebene Person zwar nicht durch das Wesen der asiatischen Kultur, wohl aber durch die Wesensgehalte von Heterosexualität, Reichtum, Kinderliebe, Fußball und No-Theater geprägt. Gegenüber dem von Welsch als traditionell bezeichneten Kulturverständnis wäre damit eine größere Auswahl an Lebensformen gewonnen, an der Traditionsbezogenheit der verschiedenen Lebensformen aber würde sich nichts ändern. Der Einzelne würde nicht mehr in die große Schublade des ›Asiatisch-seins‹ passen, er würde dafür aber in eine Vielzahl kleinerer Schubladen gesteckt. An die Stelle der kulturellen Kugeln träten lebensformende Kügelchen.