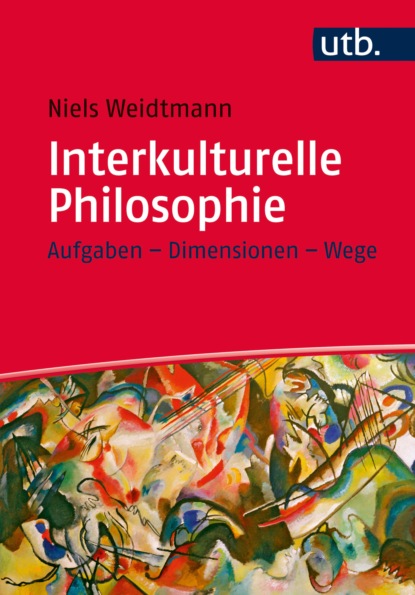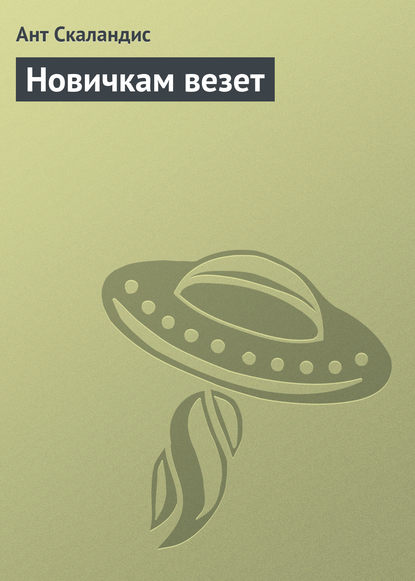- -
- 100%
- +
Die Annahme einheitlicher Lebensformen aber widerspricht der Wirklichkeit der Phänomene massiv. Kinderliebe ist nicht gleich Kinderliebe. Die Beziehung zu Kindern hat sich in den letzten hundert Jahren stark gewandelt (und sie war auch davor keinesfalls unveränderlich). Kinder haben heute einen anderen gesellschaftlichen Stand, als dies noch vor hundert Jahren der Fall war. Unsere ganze Gesellschaft ist zunehmend auf Jugend ausgerichtet; wir achten sehr viel mehr auf die Kindesentwicklung als früher; die Familienstruktur ist eine andere geworden und vieles andere mehr. Zudem stellt sich die Liebe zu Kindern bei der einen Person u.U. ganz anders dar als bei der anderen. Kinderliebe kann dazu führen, selbst viele Kinder haben zu wollen; sie kann aber ebenso gut zu politischem Engagement für die Rechte und das Wohl von Kindern führen. Was Kinderliebe im Einzelnen bedeutet, hängt an der jeweiligen Person und an der historischen Situation und den aktuellen Gegebenheiten, in denen diese Person lebt. Was Kinderliebe genau bedeutet, bestimmt sich sehr viel mehr durch die von der einzelnen Person gelebte Praxis, als dass umgekehrt die Person durch das Wesen einer kinderlieben Lebensform geprägt wäre. Gleiches gilt selbstverständlich für alle anderen Lebensbereiche. Schon der Begriff der Lebensform weist darauf hin, dass es auf die gelebte Praxis und nicht auf das Wesen einzelner Lebensformen ankommt. Lebensformen können also keinesfalls aus einer anderen Kultur einfach übernommen und in die eigene integriert werden. Die Übernahme einer Lebensform bedeutet deren praktischen Vollzug und damit immer auch deren Vernetzung mit anderen Lebensformen, wodurch die Lebensform gleichsam neu kontextualisiert und dadurch eben immer auch angepasst und verändert wird. Die Freiheit des Einzelnen besteht eben nicht allein darin, sich seinen Lebensstil nach dem Baukastenprinzip aus verschiedenen Komponenten zusammenzusetzen, sondern vor allem darin, die verschiedenen Lebensbereiche individuell zu gestalten. Solche Freiheit ist zugleich Aufgabe; der Einzelne übernimmt Verantwortung für die Gestaltung seines Lebens – ein Zug, der in WelschsWelsch, Wolfgang Konzept der Transkulturalität merkwürdig unterbelichtet bleibt.
Die individuelle Lebensgestaltung findet allerdings nicht im luftleeren Raum statt, sondern muss sich den jeweiligen historischen und aktuellen Gegebenheiten stellen. Ich kann nicht beschließen, reich zu sein, wenn ich es nicht bin; ebenso wenig kann ich wählen, schwarz zu sein, wenn ich doch weiß bin. Wohl aber kann ich den Umgang mit Wohlstand und Hautfarbe gestalten, ich kann nach Wohlstand streben und ich kann mich für die Gleichberechtigung der Hautfarben einsetzen. Ob ich das tun werde, hängt dabei nicht allein von persönlichen Vorlieben, sondern immer auch von der jeweiligen geschichtlichen und konkreten Situation ab. In den Südstaaten der USA spielt die Hautfarbe eine viel größere Rolle als in Italien; und auch in den USA hat das Thema vor hundertfünfzig Jahren noch eine andere Brisanz gehabt als heute. Das wird Einfluss darauf haben, ob Hautfarbe für den Einzelnen eine Rolle spielt oder nicht. In der Kindererziehung kann man heute nicht einfach frei wählen, sein Heil in der körperlichen Züchtigung zu suchen, und das eben nicht nur deshalb nicht, weil das Gesetz es verbietet, sondern weil die Sittlichkeit dagegen steht. Wenn wir heute sagen, dass ›man Kinder nicht schlägt‹, dann ist dies keinesfalls bloße Traditionsgebundenheit, sondern in erster Linie eine sittliche Errungenschaft, der wir selbst uns verpflichtet fühlen. An diesem einfachen Beispiel wird deutlich, dass wir selbstverständlich Kinder unserer Zeit sind und uns über das geschichtlich gestaltete Lebensumfeld, in dem wir uns bewegen, nicht einfach hinwegsetzen können. Gestalten und verändern können wir es aber, und das auch durch Einführung von Lebensformen anderer Kulturen. Gestaltung der eigenen Kultur freilich ist etwas grundlegend anderes als deren Auflösung.5
Weitere Ungereimtheiten in WelschsWelsch, Wolfgang Ansatz seien hier nur angedeutet. So schließt Welsch aus der Zentriertheit des traditionellen Kulturmodells auf Ausschließlichkeit und Abgrenzung gegenüber anderen Kulturen. Ich will hier keinesfalls ein Kugelmodell der Kulturen verteidigen, aber die Problemlage ist doch sehr viel komplexer, als Welsch sie darstellt. So liegt die besondere Stärke des traditionellen Kulturverständnisses gerade in der integrativen Kraft der auf ein wesenhaftes Zentrum hin ausgerichteten Kultur. Fremdkulturelle Phänomene werden grundsätzlich auf dieses Zentrum bezogen und so in die eigene Kultur integriert. Dabei werden die fremdkulturellen Phänomene natürlich verändert und häufig genug auch einfach als unpassend oder irrelevant verworfen; sie bleiben aber nicht außerhalb der Kultur stehen, sondern werden auf die eine oder andere, zustimmende oder ablehnende Weise aufgenommen. Diese Form der Integration wird den fremdkulturellen Phänomenen häufig nicht gerecht, Vertreter anderer Kulturen fühlen sich missverstanden. Das integrierende Verstehen versteht aber nicht, dass es missversteht. Das Besondere des traditionellen Kulturverständnisses ist gerade diese Form der Universalität, alles, auch das Fremde, in der eigenen Perspektive zu sehen. Konflikte entstehen nicht durch Abgrenzung gegenüber anderen Kulturen, sondern umgekehrt gerade durch den Anspruch, alles, auch fremdkulturelle Phänomene, nach einer einheitlichen Struktur ordnen zu können. Während die Abgrenzung anderen kulturellen Lebensformen ja gerade ihren eigenen Raum belassen würde, führt der Universalitätsanspruch des traditionellen Kulturverständnisses zur Ausgrenzung einer Vielzahl von Lebensformen innerhalb der eigenen Kultur. Das Problem ist nicht so sehr, dass sich eine weiße gegen eine schwarze Kultur abgrenzt, sondern dass die weiße Kultur die schwarze aufnimmt (die schwarze Bevölkerung in den USA hat ihre Wurzeln schließlich im Sklavenhandel), dann aber ausgrenzt. Ähnliches gilt für die innerkulturelle Vielfalt von Lebensformen. Die heterosexuelle Gesellschaft grenzt sich eben keinesfalls einfach gegen eine homosexuelle ab, sondern grenzt diese aus. Für solche Aus- statt Abgrenzung gibt es viele weitere Beispiele. Der Universalanspruch, den jede einzelne Kultur für sich erhebt, macht eine Verständigung zwischen den Kulturen einerseits sehr viel schwieriger; andererseits darf man solchen Universalanspruch nicht vorschnell aufgeben, bildet er doch auch die entscheidende Grundlage für die Möglichkeit, Kritik aneinander zu üben. Gibt man den Universalismus zugunsten eines Relativismus auf, dann verliert man damit die Rechtfertigung, anderen kulturellen Lebensformen kritisch zu begegnen. Das ist sicherlich nicht die Absicht des transkulturellen Kulturverständnisses. Im Gegenteil, die Pluralisierung der Lebensformen soll die gegenseitige Kontrolle und Kritik gerade befördern. Das geht aber eben nur, wenn die universale Geltung bestimmter Rahmenbedingungen vorausgesetzt wird. Diese Rahmenbedingungen liegen in so etwas wie einer liberalen Rechtsstaatlichkeit (s.o.), und die entspringt selber einer »kämpferischen Weltdeutung«. Transkulturalität bleibt eine universalistische Konzeption.
Schließlich sei auf die unklare Rolle hingewiesen, die dem Subjekt in der transkulturellen Konzeption zukommt. WelschWelsch, Wolfgang betont immer wieder, dass es in der transkulturellen Gesellschaft Aufgabe des individuellen Subjekts ist, seine eigene Identität aus einer Vielzahl von Komponenten (gemeint sind verschieden kulturelle Lebensformen) zusammenzustellen. Das suggeriert, dass wir es zunächst mit einem a-kulturellen und damit letztlich a-sozialen Subjekt zu tun haben, das sich im Laufe seines Lebens eine den eigenen Vorlieben entsprechende Identität bastelt. Aber was soll das sein – ein a-kulturelles, gar a-soziales Subjekt? Das reale, leiblich verfasste menschliche Wesen ist jedenfalls schon aus biologischen Gründen immer ein soziales Wesen. Gemeint sein kann deswegen nur ein vorgängiges, ein transzendentales Subjekt; ganz allgemein die Vernunft. Aber woher gewinnt ein solches Subjekt seine Vorlieben? Und wieso unterscheiden sich die Vorlieben dann von Mensch zu Mensch? Das ergibt keinen Sinn. Dass die Konzeption der Transkulturalität dennoch von einem allgemeinen Subjekt ausgeht, sieht man aber daran, dass sie auf der Idee basiert, dass der Einzelne frei ist, global unter allen kulturellen Lebensformen die für ihn passenden auszuwählen. Die Motivation dieser Wahl darf darum natürlich nicht ihrerseits kulturell beeinflusst sein. Darum muss in der transkulturellen Konzeption so etwas wie ein absolutes, d.h. von jeglicher Kultur losgelöstes, a-kulturelles Subjekt angenommen werden. Tatsächlich ist jede Wahl der Lebensform aber abhängig von der konkreten Situation, in der sich der Einzelne befindet; sie ist abhängig von den Lebenserfahrungen, die der Einzelne macht; und sie ist abhängig vom Einfluss anderer, von deren Vorbildcharakter oder auch abschreckendem Beispiel, von deren Erfahrungen und Erzählungen. Es gehört, um nur ein einziges Beispiel zu nennen, zur westlichen Kultur des 21. Jahrhunderts, sich ebenso gut für eine buddhistische wie eine christliche oder auch ganz gegen jegliche Glaubenshaltung entscheiden zu können. Das war nicht immer so und das ist nicht überall so. Und wir stoßen damit auch keinesfalls überall auf Zustimmung. Deswegen aber andere Kulturen als rückständig zu betrachten, entspricht kaum dem auf Diversifizierung bedachten Selbstverständnis der Transkulturalität.
Zusammenfassung
Das Paradigma der Transkulturalität, so ließe sich zusammenfassend sagen, versucht der Realität moderner, durch Migration und kulturelle Durchmischung geprägter Gesellschaften gerecht zu werden. Es löst die Vorstellung zusammenhängender Kulturen zugunsten einer Vielzahl voneinander unabhängiger Lebensformen auf, die – so die Vorstellung – individuell frei kombiniert werden können. Tatsächlich können wir heute in einer europäischen Gesellschaft leben, aber zugleich dem Buddhismus anhängen; wir können Deutsch sprechen, uns aber Chinesisch ernähren; wir können zugleich Fußballfan sein und Taekwondo üben. Das Paradigma der Transkulturalität scheitert aber daran, dass die verschiedenen Lebensformen eben nicht unabhängig voneinander bestehen, sondern wechselseitig Einfluss aufeinander ausüben. So wie die Lebensformen, die ich individuell wähle, irgendwie zueinander passen müssen, will ich nicht in eine multiple Persönlichkeit zerfallen, so müssen auch die Lebensformen einer Gesellschaft langfristig einigermaßen zusammen passen. Natürlich ist es möglich, Lebensformen anderer Kulturen aufzugreifen, sie werden dann aber aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgerissen und in einen neuen gesetzt; und das hat Auswirkungen auf die einzelne Lebensform. Ich kann heute also tatsächlich auch als Europäer und in Europa lebend Buddhist sein, »[d]och ein europäischer Buddhist bleibt ein Europäer, der sich zum Buddhismus bekehrt hat«.1 Das Paradigma der Transkulturalität verkennt, dass Kulturen keine Entitäten sind, schon gar keine essentialistischen, sondern stattdessen so etwas wie die jeweils konkrete geschichtliche Gestalt des Zusammenspiels zahlreicher Lebensformen darstellen. Umgekehrt sind auch die Lebensformen nicht essentialistisch und gerade deswegen auch nicht frei verfügbar; was eine Lebensform ausmacht, hängt wesentlich am kulturellen Kontext, in dem sie gelebt wird.
1.3 Interkulturalität
Der Begriff der Interkulturalität bezieht sich auf jenes ›Zwischen‹ von Kulturen, das in der Begegnung und im Austausch der Kulturen sichtbar wird. Interkulturell werden die Kulturen grundsätzlich von diesem Zwischen her verstanden, das jenseits der Kulturen liegt und diese deshalb zu einer Orientierung über ihr Eigenes hinaus bewegt. Interkulturalität betont darum von Beginn an die innere Dynamik, die allen Kulturen zueigen ist und die sich nirgendwo so deutlich erweist wie im Kontakt zu anderen Kulturen. Dieser Kontakt ist es, der Kulturen lebendig erhält: die Kritik aneinander ebenso wie das Lernen voneinander. Interkulturalität zielt deshalb nicht primär auf ein Modell für das Verstehen anderer Kulturen, sondern versucht demgegenüber, auf die Selbstverantwortung und die Lebendigkeit von Kulturen aufmerksam zu machen, die jedes von außen herangetragene Modell irgendwann sprengen müssen.
Einen Austausch zwischen Kulturen gab es vermutlich immer, mal friedlicher, häufiger weniger friedlicher Natur. In vielen Fällen hat solcher Austausch die Entstehung von neuem befördert und den Wandel der Kulturen begünstigt. Dabei ist ein solcher Austausch auch über Epochengrenzen hinweg möglich, wie etwa in der islamischen Welt, als zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert ein großer Teil der verfügbaren griechischen Literatur ins Arabische übersetzt wurde und die Entwicklung der arabischen Wissenschaften und eines arabisch-islamischen Staatswesens nachhaltig beeinflusst hat. Umgekehrt gilt, dass sich eine Kultur, die von der Außenwelt abgeschnitten ohne irgendwelche externen Einflüsse lebt, sehr viel schwerer tut, Gewohntes in Frage zu stellen und Neues auszuprobieren. Faktisch kennen wir solch annähernde Isolation nur von wenigen sehr kleinen Naturvölkern, bei denen der Druck zu Veränderung schon wegen der geringen Größe und dem darum vergleichsweise stabilen, wenn auch kargen Ressourcenangebot niedrig ist. Freilich gibt es selbst hier Austausch zwischen benachbarten Gruppen. Kulturen leben vom Austausch. Das Zwischen ist lebensnotwendig, es ist konstitutiv für die stetige Erneuerung und damit das Fortbestehen von Kulturen.
Das am häufigsten gegen den Begriff der Interkulturalität vorgebrachte Argument zielt darauf ab, dass die Rede von einer Inter-Kulturalität voneinander getrennte, für sich existierende Kulturen voraussetze; andernfalls mache es keinen Sinn, von so etwas wie einem Zwischen zu sprechen.1 Die Voraussetzung voneinander getrennter, für sich existierender Kulturen aber berge die Gefahr, Kulturen zu essentialisieren, d.h. ihnen ein unveränderbares Wesen zuzuschreiben, das sie von anderen Kulturen radikal unterscheidet. Ein solches Kulturverständnis erlaube keinerlei Wandel und leugne zudem letztlich die Möglichkeit einer Verständigung zwischen den Kulturen. Tatsächlich ist dieser Kritik darin zuzustimmen, dass ein essentialistisches Kulturverständnis weit an der Realität vorbeigeht. Kulturen verändern sich und nehmen Einflüsse von außen auf; auch kann der Einzelne in eine andere Kultur eintauchen und diese kann zu seiner eigenen werden. Falsch ist dagegen die Annahme, Interkulturalität setze klar voneinander getrennte, kugelartig abgeschlossene Kulturen voraus. Im Gegenteil, der Begriff der Interkulturalität macht gerade darauf aufmerksam, dass die Kulturalität einer Kultur nur vom Zwischen her zu verstehen ist. Eine Kultur hängt konstitutiv am Zwischen und dem Austausch mit anderen Kulturen, für die eben dasselbe gilt. So ist das Zwischen der eigentliche Lebensquell der Kulturen; damit ist auch klar, dass eine Kultur niemals zu so etwas wie der Verwirklichung ihrer selbst gelangt, kann dieses Selbst doch immer bloß eine Momentaufnahme der Auseinandersetzung mit jenem Zwischen sein und ist damit also selber stetigem Wandel unterworfen. Das Aufmerken auf die interkulturelle Dimension eröffnet uns deshalb ein ganz neues und tieferes Verständnis von Kultur: Nicht nur verändert sich jede Kultur über die Zeit, vielmehr ist sie ihrem Wesen nach Veränderung, Wandel und Austausch. Sie ist, um es in der Begrifflichkeit von LévinasLévinas, Emmanuel auszudrücken, die WaldenfelsWaldenfels, Bernhard für interkulturelle Fragestellungen fruchtbar gemacht hat, zu keinem Zeitpunkt mehr als der Versuch einer »Antwort« auf den aus dem Zwischen der Kulturen kommenden »Anspruch«.2 Der Anspruch selbst entzieht sich der Kultur grundsätzlich, und so entzieht sich ihr auch die Richtung ihrer eigenen Entwicklung – und damit das, was man vormals das Wesen genannt hat. Interkulturell verstanden sind die Kulturen also keinesfalls als absolut differente Wesen voneinander getrennt. Ein solches Verständnis greift viel zu kurz, es verdinglicht die Kulturen und versteht die Pluralität der Kulturen als ein Nebeneinander voneinander getrennter Entitäten. Ein solches Nebeneinander freilich setzt immer schon so etwas wie einen gemeinsamen Raum voraus. So entpuppt sich der Relativismus, der interkulturellem Denken gelegentlich vorgeworfen wird, als bloße Kehrseite jenes Universalismus, in dessen Namen der Vorwurf erhoben wird. In Wirklichkeit ist die Sachlage viel spannender: Die andere Kultur ist von der eigenen nicht durch einzelne Errungenschaften, Gewohnheiten oder Überzeugungen unterschieden; dafür wäre ein gemeinsamer Vergleichsrahmen notwendig. Die andere Kultur ist gar nichts anderes als die eigene Kultur, sie ist dasselbe – nur anders. Sie ist dasselbe anders und entzieht sich deshalb jedem denkbaren Vergleich. Die Erfahrung des Fremden, darauf macht Waldenfels aufmerksam, ist die der Anwesenheit des Abwesenden. Die andere Kultur zeigt sich als sich entziehende. Der Widerspruch, der darin liegt, lässt sich nur dadurch auflösen, dass man das verdinglichende Verständnis von Kulturen aufgibt und schon die eigene Kultur als lebendig, d.h. als sich stetig erneuernd und über sich hinausstrebend verstehen lernt. ›Dasselbe‹, das eine andere Kultur auf andere Weise ist, ist dann kein ›Etwas‹, sondern lediglich das Zwischen der Kulturen, aus dem heraus sich alle Kulturen gleichermaßen konstituieren.
Diese Betonung der Prozeduralität und grundsätzlichen Unabgeschlossenheit von Kulturen spiegelt sich in den methodischen Ansätzen interkultureller Philosophie wider. KimmerleKimmerle, Heinz versteht Interkulturalität dialogisch, wobei im Dialog keine Informationen ausgetauscht, sondern Zwischenräume ausgelotet werden.3 Das Hören-können geht dem Verstehen-können voraus. WimmerWimmer, Franz M. erweitert den Dialog zum »Polylog« und macht damit darauf aufmerksam, dass der Austausch zwischen Kulturen auf mehreren Ebenen und zwischen mehreren Kulturen zugleich verläuft.4 Entscheidend ist dabei freilich immer, dass die konstitutive Dimension des Austausches gesehen wird: Die Kulturen gehen aus dem Polylog verändert hervor, ja sie werden darin erst zu dem, was sie eigentlich sind – nämlich nicht dies oder das, sondern Selbstgestaltungen der menschlichen Lebenswirklichkeit.
Das Zwischen, das die Kulturen trennt, ist selbst nichts anderes als ihr Bezogensein aufeinander. Das Zwischen spannt keinen eigenen Raum aus, es hat kein eigenes Sein. Damit macht gerade das Zwischen darauf aufmerksam, dass die Kulturen durch nichts getrennt sind. Sie sind dasselbe, nämlich die jeweils andere Kultur, dies aber auf ihre je eigene Weise. Die Kulturen stehen interkulturell verstanden also nicht neben- oder gar gegeneinander und lassen sich darum auch einem multi- oder transkulturellen Paradigma grundsätzlich nicht einfügen. Interkulturell verstanden sind die Kulturen keine unterschiedlichen Interpretationen und Gestaltungen von Welt, die man gegebenenfalls miteinander vermitteln könnte, sondern Interpretationen und Gestaltungen der anderen Kulturen; die freilich ihrerseits auch nichts anderes sind, so dass jede einzelne Kultur den gelebten Versuch darstellt, Kultur überhaupt zu gestalten. In jeder einzelnen Kultur stehen alle Kulturen zugleich auf dem Spiel – und mit ihnen die Menschheit und die Menschlichkeit im Ganzen. In der interkulturellen Begegnung geht es deshalb zunächst weniger um Verstehen und Anerkennung als dem zuvor um wechselseitige Kritik und den Versuch, das, was in den Kulturen auf dem Spiel steht, in keiner einzigen scheitern zu lassen.
An dieser Stelle werden die Arbeiten von StengerStenger, Georg wichtig, der darauf aufmerksam macht, dass der Gedanke einer Konstitution der Kulturen aus dem Zwischen nur dann konsequent ist, wenn die Welthaltigkeit dieses Konstitutionsprozesses gesehen wird.5 Versteht man die Geburt bzw. Erneuerung einer Kultur aus dem Zwischen lediglich im Sinne der Konstitution eines umfassenden Horizontes, in dem Welt erscheint, dann wird das, was sich in den verschiedenen Kulturen je anders zeigt bzw. in ihnen je anders realisiert ist, als allen Kulturen gemeinsame Welt aufgefasst. Damit fällt der Gedanke zurück auf das Nebeneinander verschiedener Entitäten, die sich innerhalb einer gemeinsamen Welt durch ihre jeweilige Interpretation dieser Welt voneinander unterscheiden. Unter der Hand wird der Kulturbegriff damit wieder substanzialisiert und man bewegt sich wieder im Spannungsfeld von Universalismus und Relativismus. Welt, so Stenger, gibt es nicht jenseits der kulturellen Verständigung über sie. Welt ist selbst jener Verstehenszusammenhang, der jeweilig kulturell-historisch ausgebildet wird. Interkulturalität wird zu »Intermundaneität«.6 Allerdings muss man auch hier wieder aufpassen: Versteht man Stengers Analyse der Interkulturalität als einer Begegnung von Welten in dem Sinne, dass hier voneinander getrennte, für sich existierende Welten aufeinander stießen, ist nichts gewonnen. Der Hinweis auf den Weltcharakter von Kulturen erinnert dagegen gerade daran, dass im interkulturellen Austausch kein Allgemeines verhandelt, sondern die Wirklichkeit der Kulturen gestiftet wird. Aufgabe einer interkulturellen Philosophie ist es, diese Bedeutung der interkulturellen Dimension offen zu legen. Die Philosophie gewinnt damit eine genuin praktische Bedeutung. Damit wird auch deutlich, dass die interkulturelle Dimension die Philosophie im Ganzen betrifft und herausfordert, dass interkulturelle Philosophie also nicht lediglich ein Teilgebiet der Philosophie ist.
1.3.1 Ein spielerisches Verständnis von Kultur
In der interkulturellen Dimension werden wir auf die Lebendigkeit der Kulturen aufmerksam. Damit wandelt sich auch der Kulturbegriff selbst. Das soll im Folgenden kurz dargestellt werden.1
Kulturen sind keine starren Entitäten, die sich um ein unveränderliches Wesen herum gruppieren. Schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts verwendete Samuel von Pufendorf den Begriff der Kultur, um mit ihm die Gesamtheit der Tätigkeiten einer Gesellschaft zu bezeichnen. Die Tätigkeiten des Menschen, also sein Verhalten und seine Handlungen, sind nicht an das Wesen der Kultur gebunden, sondern entspringen der freien Entscheidung des Einzelnen. Und doch sind sie nicht völlig beliebig, sondern beziehen sich auf konkrete Handlungssituationen und sind überdies von Erfahrungen aus ähnlichen Situationen beeinflusst. Nicht in jeder Situation ist jede beliebige Handlung sinnvoll. Grundsätzlich möglich vielleicht schon; da wir mit unseren Handlungen in aller Regel aber etwas erreichen wollen, die Handlungen also an einem Handlungsziel orientiert sind, wählen wir unsere Handlungen so, dass sie auch das gewünschte Ergebnis zeitigen. So gibt die jeweilige Handlungssituation entscheidende Parameter vor, an denen wir uns bei der Ausführung unserer Handlungen orientieren. Das tut sie vor allem dadurch, dass sie unser Handeln in einem Handlungsfeld situiert. Ein solches Handlungsfeld könnte beispielsweise das Fußballspiel sein. In einem Fußballspiel treten viele verschiedene Situationen auf, in denen ganz unterschiedlich gehandelt werden muss. All diese Situationen aber sind durch vorangehende Handlungen auf dem Platz hervorgerufen; die situationsbedingten Handlungen reagieren also auf den Verlauf des Fußballspiels, führen es weiter oder geben ihm eine bestimmte Wendung. Jede Bewegung eines Spielers nimmt die Bewegungen der Mitspieler, die aktuellen ebenso wie die vorangegangenen, auf und bezieht sich auf sie. Offensichtlich wird das beim Lauf und Pass in den freien Raum, die ohne ihren Bezug aufeinander sinnlos wären. Aber auch ganze Spielverläufe haben einen, wenngleich sehr viel schwächer ausgeprägten, inneren Zusammenhang. So lässt das Engagement einer Mannschaft in aller Regel spürbar nach, wenn das Spiel als entschieden wahrgenommen wird. Wer ein Spiel ›lesen‹ kann, hat einen Sinn für diesen inneren Zusammenhang. Handlungen beziehen sich auf Handlungen, sowohl auf vorangegangene wie auf antizipierte. Die jeweilige Handlungskonstellation ist dabei das, was wir Situation nennen. Sie ist es, an der wir uns bei der Ausführung einer Handlung orientieren. Jede Handlung bezieht sich auf eine solche Handlungskonstellation, gleich ob diese einfach oder komplex ist. Nur in dieser Beziehung ist eine Handlung sinnvoll und nur von dieser Beziehung her kann sie verstanden werden. Wir müssen, wenn wir von Handlungen sprechen, also eigentlich immer die Handlungsfelder mitdenken. Freilich ist es nicht so, dass die Handlungsfelder einseitig die Handlungen bestimmen; die Beziehung zwischen Handlungen und Handlungsfeld ist eine wechselseitige. Die eine Ebene macht ohne die andere keinen Sinn. Die Handlungsfelder sind letztlich nichts anderes als die Art und Weise, wie sich die verschiedenen Handlungen aufeinander beziehen; sie werden durch das Zusammenspiel der einzelnen Handlungen überhaupt erst konstituiert. Und doch sind sie ihrerseits entscheidend für die Sinnhaftigkeit der einzelnen Handlung. So bedingen sich Handlungen und Handlungsfelder wechselseitig, weshalb es auch keinen Sinn macht, die Handlungsfelder auf Regeln oder gar so etwas wie ein inneres Wesen reduzieren zu wollen. Was ein Handlungsfeld ist und wie es auf die Ausführung von Handlungen Einfluss nimmt, das wird überhaupt erst im Wechselspiel von Handlungen und Handlungsfeld herausgespielt.