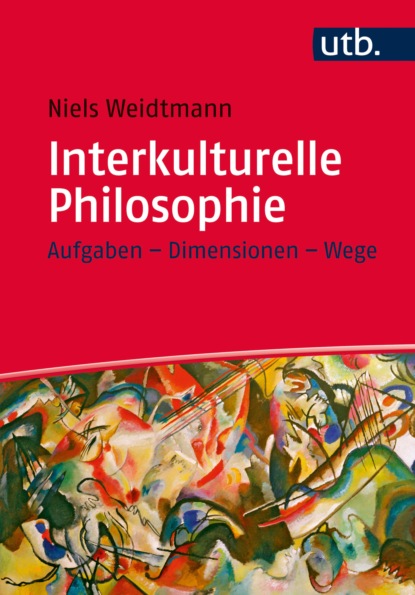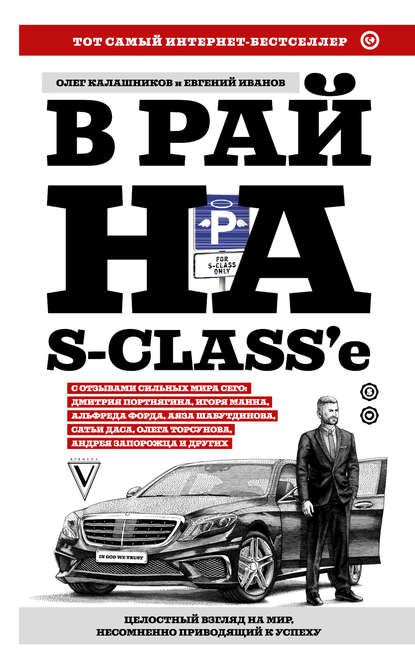- -
- 100%
- +
Eine Betonung anthropologischer Konstanten findet sich bei zahlreichen Autoren. WireduWiredu, Kwasi etwa spricht von der »biological foundation of universal norms«, also der biologischen Begründung von Normen.5 Auch MallMall, Ram A. stützt seine These von der »Überlappung der Kulturen« u.a. durch den Verweis auf anthropologische Gemeinsamkeiten und vergleicht die kulturellen Überlappungen mit der Genetik des Menschen. Auch auf genetischer Ebene finden wir erhebliche Variation zwischen den Menschen bei grundsätzlich sehr weitgehender Übereinstimmung.6
Ein Universalismus, der sich mit Blick auf die interkulturelle Situation auf anthropologische Konstanten beruft, wirft nun allerdings mehr Fragen auf, als er beantwortet. Was ist durch den Verweis auf die biologische Ähnlichkeit der Menschen eigentlich gezeigt? Offenbar nur dies, dass die Menschen verschiedener Kulturen trotz manch kultureller Differenz biologisch vergleichbar sind. In Bezug auf anthropologische Konstanten macht denn auch die Feststellung HolensteinsHolenstein, Elmar Sinn, dass einzelne Merkmale innerhalb einer Kultur zumeist mindestens ebenso stark variieren wie zwischen verschiedenen Kulturen.7 Die interkulturelle Situation ist nun aber nicht dadurch gekennzeichnet, dass die Menschen unterschiedlicher Kulturen verschiedene biologische Merkmale für sich reklamieren würden. Es gibt heute auch keine ernstzunehmende Theorie mehr, die das behauptete. Eine solche wäre rassistisch; und tatsächlich gab es vor allem im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Rassentheorien, die versuchten, die Menschen nach biologischen Merkmalen in mehrere Untergruppen zu gliedern. Carl von LinnéLinné, Carl v. (1707–1778), der uns heute als Begründer der biologischen Systematik bekannt ist, unterteilte die Menschen in vier Gruppen, denen er neben den für sie spezifischen Hautfarben auch besondere Temperamente zuordnete. Eine ähnliche Einteilung findet sich auch bei KantKant, Immanuel (1724–1804); bei ihm kommt außerdem die Zuschreibung unterschiedlichen Talents hinzu.8 Die politischen Irrwege, die wenigstens zum Teil durch Rassentheorien begründet worden sind, sind hinlänglich bekannt. Sie reichen von der Rechtfertigung des Kolonialismus und der Sklaverei, über die Rassentrennung, wie sie etwa in den USA bis in die sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein üblich war, bis hin zu den nationalsozialistischen Vernichtungslagern. Die interkulturelle Situation ist nun aber gerade nicht durch vermeintliche Differenzen auf der biologischen Ebene gekennzeichnet. Solche Differenzen gibt es, sie bestehen aber, wie uns die Genetik lehrt, weniger zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen als eher innerhalb einzelner Gruppen. Die interkulturelle Situation zielt dagegen auf kulturelle Differenzen, nicht auf biologische. In gewisser Weise ist die biologische Vergleichbarkeit der Menschen untereinander sogar eine Voraussetzung für die Feststellung kultureller Differenzen. Denn dass sich biologisch verschiedene Wesen möglicherweise auch auf der kulturellen Ebene unterscheiden, ist von vergleichsweise geringem Interesse. Viel spannender wäre es da schon, kulturelle Gemeinsamkeiten bei biologisch deutlich voneinander zu unterscheidenden Lebewesen zu finden (z.B. bei verschiedenen Spezies oder gar Gattungen). In diese Richtung gehen denn ja auch die artvergleichenden Forschungen in der Entwicklungspsychologie und der bereits erwähnten evolutionären Anthropologie.9 Die interkulturelle Situation konfrontiert uns nun aber mit kulturellen Differenzen, und die lassen sich nicht über biologische Gemeinsamkeiten vermitteln. Um ein Beispiel zu nennen: Das Besondere des Menschen ist nicht, dass er isst, sondern wie er isst. Darin, dass sich die Nahrungsaufnahme beim Menschen vom Fressen über das Essen bis hin zum Speisen entwickelt hat, unterscheidet sich die Nahrungsaufnahme des Menschen von der anderer Tiere. Die Überhöhung des Fressens zum Essen und Speisen ist ein kultureller Akt, und zwar ein besonders wichtiger in der menschlichen Entwicklung. Die Menschen feiern die Nahrungsaufnahme geradezu; darin deutet sich an, dass sie die für sie so lebenswichtige Nahrung immer auch als ein Geschenk erfahren, etwas, auf das sie angewiesen sind, das sie aber nicht ohne Unterstützung der Natur zur Verfügung hätten. Das Essen ist deshalb schon früh in der Menschheitsgeschichte mit religiösen Aspekten verknüpft worden. Hinzu kommt die soziale Funktion des Essens. Wir teilen das Essen – und damit unsere eigene Lebensgrundlage – mit anderen, darin liegt das tiefe Bekenntnis der Angewiesenheit aufeinander. Bis heute ist das gemeinsame Essen die vermutlich wichtigste soziale Institution in allen Kulturen. Fremde werden willkommen geheißen, indem sie zum Essen eingeladen werden. Usw. Die Kultur macht hier also den Unterschied zu anderen Tieren aus, nicht die Biologie. Aber nun ist auch Essen und Essen nicht dasselbe. Es kommt sehr darauf an, was gegessen wird; manche Nahrungsmittel gelten in einigen Kulturen als heilig, in anderen nicht. Das bekannteste Beispiel dafür ist die ›heilige Kuh‹ in Indien. Aber es gibt auch in anderen Kulturen zahlreiche Nahrungstabus. Manche davon sind religiös begründet, so etwa das Schweinefleischverbot im Judentum und Islam, andere nicht, wie etwa die Ächtung des Hundeverzehrs in Europa und den Vereinigten Staaten. In einigen kleineren Kulturen gibt es sogar Nahrungstabus für Pflanzen. So dürfen beispielsweise die erwachsenen männlichen Mitglieder des Stammes der Hua auf Papua-Neuguinea keine roten Gemüsearten und Früchte essen, weil diese mit der weiblichen Menstruation in Verbindung gebracht werden.10 Weiterhin gibt es Vorschriften, wie und wo gegessen wird – auf dem Boden sitzend oder am Tisch (auf dem das Essen wie auf einem Opferaltar dargereicht wird), aus gemeinsamen Schalen und Töpfen oder von getrennten Tellern – und wie sich der Dank über die Mahlzeit ausdrückt. Christlich interpretiert haben wir beim Essen Teil am Leib Christi, wodurch uns immer wieder von neuem deutlich wird, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist so nicht auf andere Religionen übertragbar. Es ist aber auch nicht einfach ein vernachlässigbares Detail, das hinter der allgemein-menschlichen Gemeinsamkeit der kulturell überhöhten Nahrungsaufnahme zurücktritt. Vielmehr hängt an der jeweiligen kulturellen Bedeutung des Essens das gesamte Selbst- und Weltverständnis der Menschen. Die verschiedenen Esskulturen als bloße Marotten abzutun, hieße das Wesen des Menschen zu verkennen. Der Mensch ist wesenhaft frei in dem ganz grundlegenden Sinne, dass er sich seine eigenen biologischen Voraussetzungen immer erst noch kulturell aneignet, ihnen nicht einfach ausgeliefert ist, sondern sie auf eine neue Stufe hin übersteigt. So hat der Mensch z.B. nicht einfach einen Körper, sondern muss ihn sich im Laufe seines Lebens aneignen, ihn zu seinem eigenen Körper machen. Dieser Aneignungsprozess ermöglicht es dem Menschen, dem Körper einen eigenen Sinn zu geben, etwa im Tanz, in dem vermutlich überhaupt erst so etwas wie eine Identität von Körper und Person erfahren wird. Der Mensch greift weit über sein biologisches Sein hinaus und verleiht diesem dadurch erst seinen Sinn. Ganz so, wie die kulturelle Welt des Menschen eine bedeutungsvolle ist, so eignet sich der Mensch auch sein biologisches Sein als ein sinnvolles an. Dabei erhebt sich nicht nur der menschliche Geist über die Natur, auch die Natur selbst wird durch den Menschen erhöht. Dann aber können kulturelle Entdeckungen nicht mehr durch anthropologische Konstanten relativiert werden.
Ein Universalismus, der sich auf anthropologische Konstanten beruft, bewegt sich in einer Dimension, die den Menschen als biologisches Wesen begreift und gegebenenfalls durch geeignete biologische Merkmale von anderen Tieren abgrenzt. Er ist gegenüber jeder Form von Rassismus und anderer biologischer Ausgrenzung im Recht. Die Menschen bilden eine gemeinsame Spezies und sind so gesehen alle gleich. Auch gelten selbstverständlich die Naturgesetze überall. Allerdings verkennt diese Form des Universalismus das kulturelle Wesen des Menschen, das darin liegt, seiner eigenen Biologie nicht einfach ausgeliefert zu sein, sondern sich diese – ebenso wie die gesamte Natur – im Laufe des Lebens erst anzueignen und darin zu überformen.
Die Einheit der Vernunft
Philosophisch sehr viel interessanter ist ein Universalismus, der sich auf die Einheit der Vernunft beruft und den Menschen als vernünftiges Wesen begreift. Demnach ist der Mensch seinem Wesen nach durch Vernünftigkeit ausgezeichnet. Das grenzt ihn einerseits gegenüber anderen Tieren ab und benennt andererseits zugleich die wesentliche Gleichheit aller Menschen. Schon PlatonPlaton (428–348 v. Chr.) versteht den Menschen als durch den vernünftigen Seelenteil (logistikón) ausgezeichnet, weil sich dieser auf die Ideen richten und sich ihrer erinnern kann (Anamnesis). AristotelesAristoteles (384–322 v. Chr.) spricht vom Menschen als einem zoon logon echon, lateinisch animal rationale. Trotz mancher Anfechtung bleibt der Gedanke der allgemeinen Vernünftigkeit des Menschen über alle Epochen hinweg zentraler Bestandteil des philosophischen Verständnisses vom Menschen. In der Neuzeit ist es vor allem KantKant, Immanuel (1724–1804), der die Vernunftkonzeption zu einer Hochform bringt. Er spricht davon, dass der Mensch ein »mit Vernunftfähigkeit begabtes Tier (animal rationabile)« sei, das »aus sich selbst ein vernünftiges Tier (animal rationale) machen kann«.1
Das möchte ich kurz erläutern: KantKant, Immanuel zeigt, dass die Erkenntnis, die wir von der empirischen Welt haben, grundsätzlich aus zwei ganz verschiedenen Komponenten zusammengesetzt ist. Da sind zum einen die Sinnesdaten, die von den Dingen ausgehen und auf unser Erkenntnisvermögen treffen; und da ist zweitens eben dieses Erkenntnisvermögen selbst, das mit den Sinnesdaten umgehen, sie ordnen und richtig aufeinander beziehen können muss, um in ihnen tatsächlich mehr als bloße Daten, nämlich konkrete Dinge erkennen zu können (schon AristotelesAristoteles verwendet den Begriff der Konkretion, um die aus Form und Material zusammengesetzte Einzelsubstanz zu bezeichnen2). Man kann sich das an einem ganz einfachen Beispiel verdeutlichen: Nehmen wir an, wir blicken auf einen Tisch, dann erreichen uns zahlreiche Sinnesdaten, die, sobald sie auf das Erkenntnisvermögen treffen, nicht mehr räumlich voneinander unterschieden sind. Um in den Sinnesdaten einen Tisch erkennen zu können, müssen diese also zunächst räumlich getrennt und geordnet werden. Vom Raum selber aber gehen keinerlei Sinnesdaten aus, er ist für uns nicht unabhängig von der räumlichen Anordnung der Dinge erfahrbar. Kant schließt daraus, dass die räumliche Ordnung der Sinnesdaten eine Leistung des Erkenntnisvermögens ist. Der mögliche Einwand, die Sinnesdaten könnten indirekt etwas über ihre räumliche Anordnung verraten, beispielsweise durch die zeitliche Verzögerung ihres Auftreffens auf das Erkenntnisvermögen oder durch die Intensität ihres Signals, läuft ins Leere, weil die Interpretation solch versteckter Informationen eine Vorstellung von Raum schon voraussetzt. Raum und auf gleiche Weise auch Zeit sind Formen, Kant spricht von den Anschauungsformen, mit deren Hilfe das Erkenntnisvermögen die Flut von Sinnesdaten sortiert und ordnet. Aber auch auf einer höheren Verständnisebene ist das Erkenntnisvermögen gefordert. Die räumlich und zeitlich geordneten Sinnesdaten müssen zusammengefasst und aufeinander bezogen werden. Das Erkenntnisvermögen muss wissen, welche Daten zusammengehören, um Gegenstände erkennen zu können. Diese Synthesis leisten die Einbildungskraft und die Verstandesbegriffe, das sind die Kategorien. Zu ihnen gehören beispielsweise Begriffe der Quantität wie Einheit und Vielheit, aber auch Begriffe der Relation wie Substanz und Kausalität (außerdem Begriffe der Qualität und der Modalität).3 Die Kategorien lassen sich ebenso wenig wie die Anschauungsformen in der Erfahrung finden, und doch sind sie genau wie jene in aller Erfahrung vorausgesetzt. Kant spricht mit Blick auf die Anschauungsformen und die Kategorien deshalb von den »Bedingungen der Möglichkeit« aller Erfahrung. Solche Bedingungen nennt er transzendental. Sie sind Vermögen a priori im Unterschied zu den Sinnesdaten, die der Erfahrung entstammen und von Kant darum als a posteriori bezeichnet werden. Die Erkenntnis, die wir von der empirischen Welt haben, ist also zusammengesetzt aus Sinnesdaten auf der einen und Leistungen des Erkenntnisvermögens (Anschauungsformen und Verstandsbegriffe/Kategorien) auf der anderen Seite. Ohne die Leistungen des Erkenntnisvermögens und speziell des Verstandes blieben wir blind, wie Kant sagt. Wir erkennen deshalb niemals, wie die Dinge »an sich« sind, sondern immer nur, wie sie uns bzw. unserem Erkenntnisvermögen gegeben sind und wie sie aufgrund der Leistungen des Erkenntnisvermögens zur Erscheinung kommen: »Die Ordnung und Regelmäßigkeit also an den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein und würden sie auch nicht darin finden können, hätten wir sie nicht oder die Natur unseres Gemüths ursprünglich hineingelegt.«4
Nun entspringen die Leistungen von Anschauung und Verstand wie gesagt gerade nicht der Erfahrung, vielmehr liegen sie dieser als ihre Bedingungen zugrunde. Das ist der für unser Anliegen, einen Universalismus der Vernunft zu rechtfertigen, entscheidende Punkt. Das Erkenntnisvermögen geht der Erfahrung voraus und ermöglicht sie, es kann also nicht selbst erfahren werden. Das bedeutet auch, dass das Erkenntnisvermögen nicht selbst wieder den Bedingungen aller Erfahrung und Erkenntnis unterliegt. Es ist ein unbedingtes Vermögen (im Unterschied etwa zum Vermögen, Auto zu fahren, das grundsätzlich auf Erfahrung angewiesen ist). Als unbedingtes Vermögen ist das Erkenntnisvermögen aber auch unabhängig von inter-individuellen Unterschieden, es ist ein universales Vermögen. Zwar gibt es zwischen einzelnen Menschen erhebliche Unterschiede in der Fähigkeit zu Erkenntnis, diese gehen aber nicht auf prinzipielle Unterschiede des Erkenntnisvermögens zurück (vielmehr ist das Erkenntnisvermögen in der Feststellung solcher Unterschiede ja selbst wiederum vorausgesetzt), sondern beruhen zum einen auf der unterschiedlich großen Neigung, das Erkenntnisvermögen einzusetzen, zum anderen auf der unterschiedlich großen Einsicht in die Struktur der Erkenntnis. Das ist der Grund dafür, dass Erziehung und Aufklärung möglich und nötig sind. Und noch ein zweiter Punkt ist wichtig, um die Einheit der Vernunft richtig zu verstehen: Die Synthesisleistungen des Verstandes werden ihrerseits zusammengefasst vom »Ich denke«, das »alle meine Vorstellungen begleiten können« muss.5 Nur wenn die verschiedenen Erkenntnisse auf das »Ich denke« hin bezogen werden können, lassen sie sich als zusammengehörig erkennen. Dieser Zusammengehörigkeit aller Erkenntnis auf der Seite des Subjekts entspricht auf der Seite der Erkenntnisobjekte die Zusammengehörigkeit alles Erkannten in der Welt. Die Welt freilich kann nicht selbst erkannt werden, aber sie ist eine Idee, die die Vernunft notwendigerweise haben muss, soll sinnvolle Erkenntnis überhaupt möglich sein. So wie die Vernunft auf Seite des Subjekts einheitlich ist, so richtet sie sich auf Seite des Objekts auf die Einheit der Welt. Darin erst ist sie eigentlich universal.
Aufgrund ihrer Universalität verleihen die Leistungen des Erkenntnisvermögens der Erfahrung Objektivität. Darin besteht die Kantische »Revolution der Denkungsart«.6 Zugleich steht das Erkenntnisvermögen für die prinzipielle Gleichheit der Menschen. Diese Gleichheit kann aber nur deswegen so bedeutsam sein, weil der Mensch seinem Wesen nach vernünftig ist. Das Wesen des Menschen erschöpft sich nun aber nicht in seiner Erkenntnisfähigkeit. Vielmehr ist der Mensch darum seinem Wesen nach vernünftig, weil er sich qua Vernunft über alle Bedingtheit der Erfahrungswelt, also auch über seine eigene Bedingtheit als in der Erfahrungswelt Lebender hinwegzusetzen vermag. Qua Vernunft unterliegt der Mensch keinen Bedingungen, sondern ist frei. Über alle Bedingtheit hinwegsetzen kann sich der Mensch nun aber nicht in der Erkenntnis (wegen deren Zusammengesetztheit); die Unbedingtheit äußert sich darum vornehmlich im freien Willen. Der freie Wille wiederum zeigt sich dann, wenn sich der Mensch in dem, was er tut, nicht durch Neigungen und Wünsche, sondern allein von der Vernunft leiten lässt. Das Handlungsgesetz der »reinen praktischen« Vernunft bestimmt KantKant, Immanuel bekanntlich im kategorischen Imperativ: »Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Princip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.«7 Die Universalität der Vernunft wird gerade an der Pflicht, die Kant im kategorischen Imperativ formuliert, deutlich: Unbedingt und frei ist der menschliche Wille nur dann, wenn seine Maxime zur allgemeinen Gesetzgebung taugt.
Wenn wir einmal beiseite lassen, dass KantKant, Immanuel die Ausbildung der Vernunftfähigkeit zur tatsächlichen Vernünftigkeit abhängig von geographischen und klimatischen Bedingungen v.a. bei den Europäern realisiert sah (s. Anm. 16), dann vermag die Vernunftkonzeption Kants in der Tat einen Universalismus zu begründen. Aufgrund ihrer Teilhabe an der einen universalen Vernunft sind die Menschen ihrem Wesen nach alle gleich, sie unterliegen denselben Pflichten und haben dieselben Rechte, nämlich niemals instrumentalisiert, sondern immer als Zweck an sich behandelt zu werden. Auf dieser Grundlage entwirft Kant denn auch das Ideal des »Weltbürgertums«, dessen Ausbildung zum »ewigen Frieden« zwischen den Völkern führen würde.8 Gemessen an der Einheit der »reinen praktischen« Vernunft sind kulturelle Differenzen zwischen den Völkern zweitrangig. Kulturelle Differenzen sind geographisch, klimatisch und historisch bedingt. Sie können der Ausbildung der tatsächlichen Vernünftigkeit des Menschen, dem »Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« wie Kant sagt,9 mehr oder weniger förderlich, ja sogar hinderlich sein, an der Einheit der Vernunft und der prinzipiellen Vernunftfähigkeit des Menschen ändern sie nichts.
Die kantische Begründung der Vernunft ist bis heute extrem wirkmächtig geblieben. Das Denken KantsKant, Immanuel steht auch heute noch bei vielen Vertretern universalistischer Ansätze im Hintergrund. Tatsächlich ist durch Kants Kritik der Vernunft, die eine Trennung von auf Erkenntnis gerichtetem Verstand und reiner theoretischer ebenso wie praktischer Vernunft vornimmt, viel gewonnen. Vor allem die Einsicht in die Freiheit des Menschen, die sich gerade darin verwirklicht, dass er sich unter das sittliche Gesetz stellt. Freiheit und Verantwortung des Menschen gehören unmittelbar zusammen. Dennoch ist die kantische Position heute allenfalls noch in angepasster Form haltbar. Das liegt zum einen an der historischen Erfahrung des Schreckens, wie wir sie im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Diese Erfahrung hat zu grundsätzlichen Vorbehalten gegenüber der Annahme einer grundsätzlich sittlich orientierten Vernünftigkeit des Menschen geführt. Zum anderen aber ist Kant schon von seinen Zeitgenossen dafür kritisiert worden, die Vernunft des Menschen gleichsam von der Welt entkoppelt zu haben. Die Universalität der Vernunft ist weltlos und folglich auch a-historisch, und sie verkennt die Notwendigkeit einer sprachlichen Vermittlung. Ich werde darauf in Kapitel 3 näher eingehen; im Folgenden stelle ich kurz einen Ansatz vor, der versucht, die Einheit der Vernunft zu retten und doch zugleich die genannte Kritik aufzunehmen.
Habermas’ Diskurstheorie
Ganz in diesem Sinne spricht HabermasHabermas, Jürgen in dem bereits erwähnten gleichnamigen Aufsatz von der »Einheit der Vernunft in der Vielheit ihrer Stimmen«. Die Vernunft, das haben schon HerderHerder, Johann G. (1744–1803) und Wilhelm von HumboldtHumboldt, Wilhelm v. (1767–1835), beide Zeitgenossen KantsKant, Immanuel, gezeigt, findet in der Sprache ihren Ausdruck. Sie ist sozusagen nicht frei zugänglich, sondern sprachlich vermittelt. Umgekehrt bedeutet das, dass die Sprache das Denken beeinflusst, eine Einsicht, die im 20. Jahrhundert zum so genannten »linguistic turn« und zur Sprachkritik geführt hat. Habermas schließt an diese Einsicht an, hält zugleich aber an der Einheit der Vernunft fest: »Denn Konzepte wie Wahrheit, Rationalität oder Rechtfertigung spielen in jeder Sprachgemeinschaft, auch wenn sie verschieden interpretiert und nach verschiedenen Kriterien angewendet werden, dieselbe grammatische Rolle.«1 Die Vernunft drückt sich in den verschiedenen Sprachen durchaus verschieden aus; auch fehlt der eine verbindliche Maßstab, nach dem zu entscheiden wäre, welchem Ausdruck die Menschen folgen sollten. Vielmehr muss um die Vernunft gerungen werden. Das immerhin bleibt möglich, schließlich sind die verschiedenen Sprachen allesamt Ausdrucksweisen der Vernunft. Habermas verortet die Vernunft freilich anders als Kant nicht mehr im einzelnen Subjekt (die Vorstellung von der Vernunft des Einzelnen ist durch die Erfahrungen der Nazi-Herrschaft nachhaltig erschüttert), sondern im Diskurs. Vernunft realisiert sich intersubjektiv. Die Begründung diskursiver Vernunft ist (im Anschluss an den Begründer der Diskurstheorie Karl-Otto ApelApel, Karl-Otto) letztlich eine pragmatische: Die Möglichkeit rationalen Argumentierens muss nämlich immer schon unterstellt werden, sonst würde es gar keinen Sinn machen, irgendwelche Geltungsansprüche zu erheben. Wenn wir etwas als wahr behaupten, dann erheben wir damit einen Geltungsanspruch, nämlich konkret den Anspruch, dass es sich so verhält, wie wir sagen.2 Habermas zufolge muss sich dieser Geltungsanspruch im Diskurs nun argumentativ bewähren. Er schlägt darum ein Konsensmodell der Wahrheit vor. Nur wenn prinzipiell alle, die am Diskurs teilnehmen könnten, diesem Geltungsanspruch auch zustimmen würden, ist die Behauptung tatsächlich wahr. Die Wahrheit von Aussagen – und damit sozusagen die Universalisierbarkeit eines vernünftigen Ausdrucks – hängen am Konsens aller. Habermas spricht deshalb von der »kommunikativen Vernunft«.3
Der Diskurs unterliegt dabei einigen Bedingungen. Zum einen ist vorausgesetzt, dass die Diskursteilnehmer mit dem, was sie sagen, bestimmte Geltungsansprüche verbinden, das sind zum einen die Verständlichkeit des Gesagten und zum anderen, abhängig davon, ob sich der Diskurs auf die objektive, die soziale oder die subjektive Realität bezieht, der Anspruch auf objektive Wahrheit bzw. normative Richtigkeit und subjektive Wahrhaftigkeit. Zudem setzt HabermasHabermas, Jürgen eine »ideale Sprechsituation« voraus, die durch gleiche Chancen zur Beteiligung am Diskurs, die Möglichkeit, alle Geltungsansprüche gleichermaßen kritisch zu prüfen, Herrschaftsfreiheit und Aufrichtigkeit der Sprecher gekennzeichnet ist. Unter diesen Bedingungen ermöglicht der Diskurs Verständigung und Einigung unter dem »eigentümlich zwanglosen Zwang des besseren Argumentes«.4 Tatsächlich wird es eine solch ideale Sprechsituation in der Realität nicht geben, das behauptet auch Habermas nicht, aber der Diskurs muss sich doch wenigstens an ihr orientieren.
Das habermasHabermas, Jürgen’sche Diskursmodell demokratisiert gleichsam den Gebrauch der Vernunft. Jeder Geltungsanspruch muss rational begründet werden und kann nur dann als eingelöst gelten, wenn alle ihm zustimmen. Das bedeutet keinesfalls, dass Habermas Geltungsansprüche für verhandelbar hält und der Etablierung von Mehrheitsmeinungen das Wort redet. Im Gegenteil, ein Geltungsanspruch ist so lange nicht universalisierbar, so lange er nicht von allen rational nachvollzogen werden kann. Habermas spricht Mehrheiten in einer Gesellschaft explizit das Recht ab, ihre eigene kulturelle Lebensform zur Leitkultur zu erheben.5 Die Forderung, alle gleichberechtigt in den Diskurs mit einzubeziehen, weitet er mit der Zeit über die eigene Sprachgemeinschaft hinaus auf grundsätzlich alle Menschen aus. Die Rationalitätsstandards des Diskurses sind nicht an die jeweilige Sprache und Kultur gebunden. Gmainer-PranzlGmainer-Pranzl, Franz hat deutlich gemacht, dass Habermas damit einen wesentlichen Beitrag zur Problemstellung interkultureller Philosophie zu leisten vermag.6 Allerdings droht die Voraussetzung allgemeiner Rationalitätsstandards des Diskurses, so Gmainer-Pranzl, das für interkulturelle Fragestellungen so wichtige Phänomen des Fremden zu verkennen. Fremd ist etwas nicht deswegen, weil es vorläufig unbekannt und unverstanden bleibt, sondern weil es sich grundsätzlich dem verstehenden Zugriff entzieht und gerade als derart entzogen erfahren wird.7 Gmainer-Pranzl sieht nun in Habermas Beschäftigung mit der Religion eine Möglichkeit, auch das Phänomen des Fremden in der Diskurstheorie unterzubringen. Säkulare Rationalität und Religion anerkennen sich wechselseitig, jedenfalls solange wie die säkulare Rationalität keine befriedigenden Antworten auf die entscheidenden religiösen Fragen zu geben vermag. Solche Anerkennung geschieht aus Einsicht in die Berechtigung der religiösen Fragestellungen bei gleichzeitiger Erkenntnis der eigenen Unfähigkeit, befriedigende Antworten zu geben. Sie zielt also gerade nicht darauf ab, die Differenz zwischen säkularer Rationalität und Religion aufzulösen.