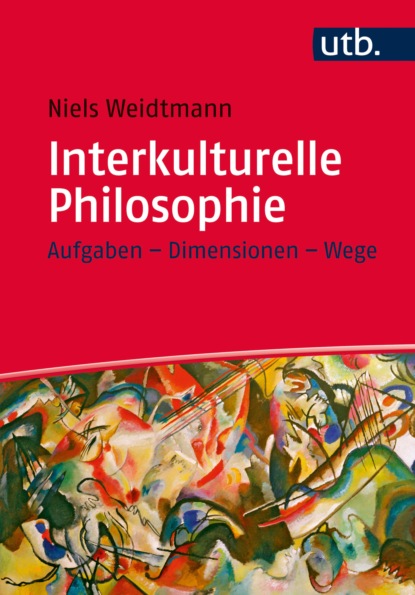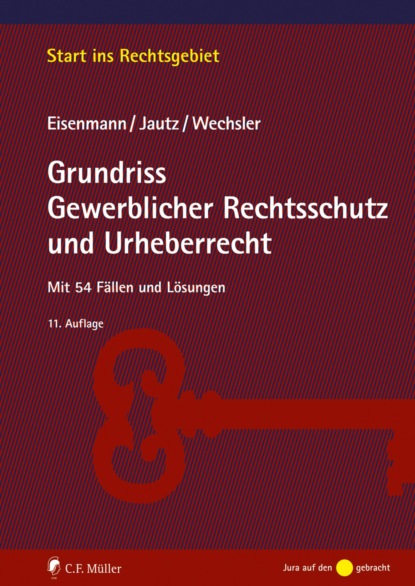- -
- 100%
- +
Die habermasHabermas, Jürgen’sche Diskurstheorie scheint überall dort im Recht zu sein, wo tatsächlich allgemeine Rationalitätsstandards des Diskurses vorausgesetzt werden können. Selbst dann, wenn der eigene epistemische Status der Religion anerkannt wird, muss dies aus rationaler Einsicht geschehen. Damit hängt die Diskurstheorie wie KantsKant, Immanuel Philosophie auch an der Voraussetzung der Einheit der Vernunft. Die aber muss sich dann auch konkret feststellen lassen, sie muss sich gleichsam empirisch bewahrheiten. Habermas geht genau in diese Richtung, indem er Vernunft intersubjektiv begründet. Freilich stellt sich dann nicht nur die Frage, weshalb sich die Menschen de facto so schlecht über Geltungsansprüche verständigen können, sondern auch das ganz grundsätzliche Problem, wie man jemandem begegnen soll, der entweder die Rationalitätsstandards des Diskurses nicht anerkennt oder aber gleich ganz verweigert, überhaupt am Diskurs teilzunehmen. Diskurstheoretisch lässt sich mit solchen Personen nichts anfangen, sie stellen sich gleichsam selbst ins Abseits. Das aber bedeutet nichts anderes, als dass der »zwanglose Zwang des besseren Arguments« seine Zwanglosigkeit einbüßt. Wer sich nicht auf vernünftige Weise am Diskurs beteiligt, der scheidet als gleichberechtigter Gesprächspartner aus. Das gilt auch für die Religionen. Den Religionen kann nur dann ein eigener epistemischer Status zuerkannt werden, wenn sie ihrerseits die Berechtigung eines säkularen Rationalismus aus rationalen Gründen anerkennen. Die Religionen müssen also selbst vernünftig sein, und das im Sinne des diskurstheoretischen Vernunftbegriffs.
Damit verkennt die Diskurstheorie aber die interkulturelle Situation, in der das gewachsene Vernunftdenken der europäisch-westlichen Tradition ja gerade herausgefordert wird. Natürlich wird keiner einzelnen Kultur Vernunft abgesprochen, das Spannende an der interkulturellen Situation aber ist gerade, dass die Vernunft nicht in ihrer kulturübergreifenden Einheit vorausgesetzt wird, sondern umgekehrt die verschiedenen Vernunfttraditionen angesichts der interkulturellen Situation auf ihre jeweilige Geschichtlichkeit aufmerksam werden. Ob es so etwas wie eine Einheit der Vernunft überhaupt gibt oder je geben kann, das steht in der interkulturellen Situation in Frage und darf nicht schon vorausgesetzt werden. Wir werden weiter unten sehen (vg. Kap. 2.2 und 2.3), dass die Einheit der Vernunft im 20. Jahrhundert schon in der europäischen Tradition in Frage gestellt wird. Vernunft kann nie einfach vorausgesetzt werden, sondern steht selber in jedem Moment mit auf dem Spiel.
Der Universalismus bleibt in bestimmten Dimensionen im Recht. So etwa, wie oben bereits angemerkt, wenn wir den Menschen als biologisches Wesen betrachten. Auch ist es unstrittig, dass logische Gesetze ihre Gültigkeit nicht dadurch verlieren, dass sie in kulturellen Kontexten ausgesprochen und angewandt werden, denen sie möglicherweise nicht selbst entstammen. Der Geltungsbereich von Logik ist so wenig wie der der Naturgesetze lokal oder historisch begrenzt; er ist aber wie die Naturgesetze auch auf eine bestimmte Dimension begrenzt. Die Naturgesetzte gelten in der natürlichen Dimension (für kulturelle Phänomene gelten sie immer nur insoweit, wie diese Phänomene ihrerseits auf die natürliche Dimension reduziert werden – so kann z.B. das kulturelle Phänomen des Essens und Speisens selbstverständlich auch in der natürlichen Dimension betrachtet werden), die logischen Gesetze in einer Dimension logischen Argumentierens und Handelns (die meisten Phänomene lassen sich unter logischen Gesichtspunkten betrachten, das bedeutet aber nicht, dass sie dadurch im Ganzen erfasst wären – so z.B. die Religionen).
Was universalistische Ansätze zumeist verkennen, ist freilich ihre eigene Herkunft. Gmainer-PranzlGmainer-Pranzl, Franz etwa schreibt, »Universalität stell[e] den entscheidenden Anspruch und zugleich die permanente Krise interkultureller Philosophie dar«.8 Das stimmt, aber es stimmt nur in einer ausgezeichneten Dimension, nämlich für das europäische Vernunft- und Philosophieverständnis, das sich durch die interkulturelle Situation herausgefordert sieht. Aus der Sicht anderer Traditionen stellen sich die Herausforderungen der interkulturellen Situation ganz anders dar. Das heißt nicht, dass an die Stelle des Universalitätsstrebens in anderen Traditionen die Befürwortung eines Relativismus tritt. Relativismus setzt Universalität immer schon voraus und erscheint deshalb nur vor dem Hintergrund universalistischen Denkens als eine (freilich abzulehnende) Alternative. Das universalistische Denken aber steht für die ursprünglich griechische Entdeckung der Vernunft (Logos) »als die Form, in der der Geist dem individuellen Menschen einwohnt«.9 Während der Geist als Einheit stiftendes Prinzip JaspersJaspers, Karl zufolge um die Achsenzeit (800–200 v. Chr.) an verschiedenen Orten weitgehend unabhängig voneinander entdeckt worden ist, zeichnet sich die griechische Entdeckung durch die Teilhabe des Einzelnen an dieser Einheit aus (»die Einheit der Vernunft in der Vielheit ihrer Stimmen«, s.o.). HeldHeld, Klaus hat beschrieben, wie sich auf der Grundlage der Entdeckung dieses Zusammenspiels von Einheit und Vielheit bei den Griechen die wesentlichen Grundpfeiler der europäischen Kultur ausgebildet haben, nämlich zum einen die Wissenschaft und zum anderen die Demokratie.10 Beide sind, das gehört zu dieser Entdeckung und zum europäisch-westlichen Denken dazu, nicht auf Europa beschränkt geblieben. Nun ist ein ähnlicher Gedanke beispielsweise in der ostasiatischen Tradition zwar keinesfalls unmöglich oder auch nur ungedacht, wohl aber nicht von derselben entscheidenden Wichtigkeit. Im ostasiatischen Denken kann die individuelle Teilhabe an der Einheit schon deswegen keine bestimmende Rolle spielen, weil das Individuum auf die Ebene des Selbst und noch weiter auf die Ebene des selbstlosen Selbst rückbezogen wird, von der aus gesehen die Unterscheidung bzw. das Zusammenspiel von Einheit und Vielheit als abgeleitete und nachrangige Feststellungen erscheinen. Universalität ist nur in europäischer Perspektive das Grundproblem interkultureller Philosophie.
Abgrenzung vom Relativismus
Der entscheidende Gegner eines jeden universalistischen Ansatzes ist das Gespenst des Relativismus. Relativistische Positionen bergen immer die Gefahr, im wahrsten Sinne des Wortes haltlos zu werden, weil sie keinerlei verbindliche Vorgaben, Normen oder auch nur Verständigungsmöglichkeiten mehr akzeptieren. Dadurch aber droht alles beliebig und interkulturelle Verständigung schlicht unmöglich zu werden. HabermasHabermas, Jürgen wendet sich an verschiedenen Stellen gegen RortyRorty, Richard, dem er trotz einer gewissen Nähe zu seinem eigenen Modell der kommunikativen Vernunft einen letztlich unhaltbaren Relativismus vorwirft. Rorty unterstellt vernünftiger Argumentation anders als Habermas keinen universalen Geltungsanspruch, sondern schränkt diesen auf spezifische (kulturelle) Kontexte ein. Innerhalb gegebener Kontexte geht auch Rorty von der Ausbildung eines Konsens aus; die Möglichkeit einer Ausweitung dieses Konsens auf andere Kontexte und die damit verbundene mögliche kulturübergreifende Geltung aber bestreitet Rorty.
Vor allem für die universalistische Argumentation, die sich auf anthropologische Konstanten beruft, ist es typisch, dass sie sich mit dem Verweis auf die Notwendigkeit, die universale Geltung der Menschenrechte zu akzeptieren, gegen einen strikten Kulturrelativismus verwahrt. Würden die Weltansichten und das Handeln der Menschen in der Welt ihren Sinn tatsächlich ausschließlich relativ zu den einzelnen Kulturen gewinnen, dann wäre keine Verständigung über die Menschenrechte möglich. Was in der einen Kultur gilt, müsste in der anderen keinesfalls ebenso gelten. Die Verbindlichkeit eines vernünftigen Menschenrechtsdiskurses würde einer Form von Beliebigkeit weichen, was mit Blick auf die Menschenrechte einer contradictio in adjecto, einem Selbstwiderspruch, gleichkäme – so die Argumentation.1 Natürlich erheben die Menschenrechte zu Recht einen universalen Geltungsanspruch. Auch hier aber muss man sehr genau die Dimensionen unterscheiden. Auf einer Ebene, auf der der Mensch als biologische Spezies betrachtet wird und damit alle kulturellen Differenzen von selbst entfallen, lassen sich eben auch nur bestimmte Rechte einfordern. Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung etwa oder das Recht auf Eigentum gehören eher nicht dazu. In der Gewährleistung dieser Rechte aber liegt ein großer kultureller Gewinn. Ich werde darauf in Kapitel 4 etwas ausführlicher eingehen.
Tatsächlich ist der Kulturrelativismus nur eine Kehrseite universalistischer Ansätze. Der Relativismus heißt so, weil er all das, was im Universalismus als allen Menschen gemein angenommen wird, in eine Relation zu den einzelnen Kulturen setzt. Das führt dazu, dass die Universalien in den verschiedenen Kulturen unterschiedlich aufgenommen und interpretiert werden. Die oben genannten anthropologischen Konstanten ebenso wie der gemeinsame Kern menschlicher Vernunft bedeuten dem Kulturrelativismus zufolge in den unterschiedlichen Kulturen verschiedenes. Aus den verschiedenen Bedeutungen der Universalien folgt, dass die Werte und Überzeugungen der Kulturen ebenso nur relativ zur jeweiligen Kultur gelten. Um seine relativistischen Annahmen zu rechtfertigen, muss dieser Ansatz freilich die Universalien immer schon voraussetzen. Gäbe es keine Universalien, dann könnten sie auch nicht kulturell unterschiedliche Bedeutungen annehmen. Umgekehrt setzt auch der Universalismus streng genommen relativistische Annahmen immer schon voraus. Gäbe es keine kulturell unterschiedenen Weltansichten, Werte, Überzeugungen und Vernunftgestalten, dann könnte der Universalismus auch nicht die universelle Geltung von Universalien begründen. Ohne Differenzen keine Universalien, ohne Universalien keine Differenzen.
2.1.2 Komparative Philosophie
Die komparative oder vergleichende Philosophie teilt wesentliche philosophische Voraussetzungen mit dem Universalismus, verfolgt aber ein ganz anderes Ziel. Sie ist weniger an der Offenlegung gemeinsamer Grundlagen, als vielmehr zunächst an der Herausarbeitung der Differenzen zwischen verschiedenen philosophischen Traditionen interessiert, um erst in einem zweiten Schritt darauf zu reflektieren, was ihnen gemein ist. WohlfartWohlfart, Günter beruft sich bei der Festlegung dieser Priorität auf KantKant, Immanuel, der mit Blick auf die Gewinnung von Begriffen gesagt hat, man müsse (in dieser Reihenfolge) »komparieren, reflektieren und abstrahieren« können.1 Komparative Philosophie versucht also in erster Linie einmal die Differenzen deutlich zu machen, die sich zwischen einzelnen Ansätzen und Denkern verschiedener Traditionen auffinden lassen. Das ist freilich keinesfalls der Überzeugung geschuldet, die philosophischen Traditionen teilten keine Gemeinsamkeiten. Eine solche Überzeugung würde die Vergleichbarkeit von Traditionen grundsätzlich in Frage stellen, würde man doch sprichwörtlich ›Äpfel mit Birnen‹ vergleichen. Der Erkenntnisgewinn wäre gleich null, würde der Vergleich doch nichts beitragen können zu einem besseren Verständnis der einzelnen miteinander verglichenen Denkansätze. Umgekehrt gilt aber eben auch, dass die Konzentration auf Gemeinsamkeiten nur dann von Interesse ist, wenn dem zuvor die Differenzen offen liegen. Ohne ein gutes Verständnis der Differenzen würde die Aufdeckung von Gemeinsamkeiten zu einer Selbstverständlichkeit verkommen. Die Konzentration auf Unterschiede dient also dem Erkenntnisgewinn.
Das Stichwort Erkenntnisgewinn weist auf die besondere Stellung der komparativen Philosophie im Kanon der verschiedenen Ansätze und Methoden interkultureller Philosophie hin. Der komparativen Philosophie geht es anders als etwa dem dialogischen Ansatz nicht primär um Verständigung, anders als dem Polylog nicht darum, Stimmen anderer Kulturen zu Wort kommen zu lassen, und anders als den universalistischen Ansätzen nicht um die Verteidigung einer einheitlichen Grundlage aller Kulturen. Es geht ihr schlicht um die Vergrößerung unseres Wissens sowohl von der eigenen wie von anderen philosophischen Traditionen. Und das nicht zu dem Zweck, den eigenen, zu einem guten Teil durch die eigene kulturelle Tradition geprägten Horizont zu erweitern und so die eigene »Weltansicht« (W.v. HumboldtHumboldt, Wilhelm v.) zu verändern, sondern aus wissenschaftlichem Interesse. Die komparative Philosophie wirft deshalb einen möglichst objektiven Blick sowohl auf die fremde als auch auf die eigene Philosophie, die mit der fremden verglichen wird. Die verschiedenen Philosophien werden überhaupt erst dadurch vergleichbar, dass sie objektiv in den Blick genommen werden, ist das Forschersubjekt doch notwendiger Weise sehr viel tiefer in die eigene Tradition verstrickt als in die fremde. Der objektive Blick setzt den Rahmen, innerhalb dessen die miteinander zu vergleichenden Philosophien neutral untersucht werden können.
Der vergleichende Ansatz eröffnet damit auch die Möglichkeit zur Kritik. Zunächst die Kritik an einem allzu selbstgefälligen Eurozentrismus, der, wie ElberfeldElberfeld, Rolf eindrucksvoll beschreibt, dazu geführt hat, die philosophischen Traditionen anderer Kulturen lange Zeit – und häufig bis in die Gegenwart hinein – kaum wahrzunehmen.2 Komparative Philosophie macht dagegen überdeutlich, dass es in anderen Traditionen zahlreiche Denker und Denkansätze gibt, die den europäisch-westlichen mindestens adäquat sind. Philosophie kann aus diesem Grund heute nicht mehr auf vergleichende Ansätze verzichten. Es ist von hier aus gesehen völlig unverständlich, wie es sein kann, dass nicht-westliche Traditionen in den Curricula der Philosophiestudiengänge immer noch so gut wie nicht vorkommen. ConnollyConnolly, Tim führt das darauf zurück, dass die Denker aus anderen kulturellen Traditionen nicht als Philosophen und ihre Ansätze nicht als Philosophien akzeptiert werden.3 Komparative Philosophie steht, um vergleichen zu können, in der Not, ein klar definiertes Verständnis von Philosophie zugrunde legen zu müssen. Dieses Philosophieverständnis wird von Kritikern dann oft als zu breit kritisiert; ihrem eigenen engeren Philosophieverständnis zufolge aber können die anderen Traditionen nicht als Philosophien gelten. Das hat in der Vergangenheit oft dazu geführt, dass an die Stelle einer ernsthaften Auseinandersetzung mit anderen Traditionen der Streit darüber getreten ist, ob diese Traditionen zu Recht als Philosophie bezeichnet werden können oder nicht. Bekannt sind die bis heute anhaltenden Diskussionen um den Status ostasiatischer Traditionen: Handelt es sich dabei eher um philosophische oder doch um religiöse Traditionen? Noch vehementer wurde der Streit in Bezug auf Schwarzafrika geführt.4 Schon wegen der fehlenden schriftlichen Überlieferung und der damit verbundenen Schwierigkeit, die Autorschaft überlieferten Denkens eindeutig zu bestimmen, ist den schwarzafrikanischen Traditionen lange Zeit ein eigenes philosophisches Denken abgesprochen worden. Stellvertretend sei HochkeppelHochkeppel, Willy zitiert:
»Afrikanisches Philosophieren? Nimmt man die immer weitere Kreise schlagenden Diskussionen darüber schon für die Sache selbst, dann gibt es afrikanisches Philosophieren. Inhaltlich aber, substantiell, ist so etwas wie afrikanische Philosophie nicht in Sicht, nicht einmal, wenn man den ohnehin nachgiebigen Philosophiebegriff ins Beliebige ausdehnte.«5
Um dem Dilemma, entweder einen zu weiten oder aber einen zu engen Philosophiebegriff zugrunde zu legen, zu entgehen, entlehnt ConnollyConnolly, Tim Wittgensteins Begriff der »Familienähnlichkeit«. Demnach sind die verschiedenen philosophischen Traditionen nicht einfach verschiedene Formen der einen (europäisch-westlichen) Philosophie, sondern unterschiedliche denkerische Traditionen, die sich allesamt so ähnlich sind, dass sie vergleichbar werden und aufgrund dieser Vergleichbarkeit der Einfachheit halber alle als Philosophien bezeichnet werden. Connolly zufolge lassen sich die verschiedenen Traditionen also nicht vergleichen, weil sie alle einer zuvor festgelegten Definition von Philosophie entsprechen, sondern umgekehrt lassen sie sich als Philosophien bezeichnen, weil sie vergleichbar sind.
Das klingt vernünftig, wird dadurch doch vermieden, die verschiedenen Traditionen alle an ein und demselben Philosophiebegriff zu messen, der notgedrungen der eigenen Tradition entstammen muss. ConnollyConnolly, Tim plädiert also auch hier ganz im Sinne der komparativen Philosophie für eine Objektivierung. An die Stelle des aus einer einzelnen Tradition entlehnten Maßstabs (in Gestalt eines vorgegebenen Philosophiebegriffs) treten objektive Vergleichskriterien. So wird auch die eigene, zumeist europäisch-westliche Philosophie, zu einer Stimme, die Einsichten ausdrückt, die in anderen Traditionen auf vergleichbare, aber eben doch unterschiedene Weise ausgedrückt werden.
Freilich stellt sich sogleich die Frage nach den besonderen Vorentscheidungen, die mit dem Schritt zur Objektivierung in jedem Vergleich immer schon getroffen sind. Was ist durch den objektiven Blick immer schon vorausgesetzt? Zunächst einmal ganz offensichtlich eben dies, dass das Subjekt außen vor bleibt; was freilich nichts anderes heißt, als dass uns als Subjekte die zu vergleichenden Philosophien nicht unmittelbar betreffen, sie uns nicht wirklich etwas angehen. Nun könnte man widersprechen und sagen, dass wir etwa in den Naturwissenschaften und der medizinischen Forschung doch ganz selbstverständlich mit einem möglichst objektiven Blick arbeiten und uns die Forschungsergebnisse, etwa ein bestimmter Krankheitserreger oder das Mittel gegen ihn, sehr wohl dennoch etwas angehen. In der Philosophie geht es aber um anderes. Wenn ich mich beispielsweise mit einem bestimmten ostasiatischen Denken beschäftige, das versucht, das Ich im Selbst und dieses wiederum im selbstlosen Selbst zu gründen, dann nehme ich diesen Ansatz von Beginn an nicht wirklich ernst, wenn ich glaube, meine eigene Subjektivität aus dieser Beschäftigung heraushalten zu können. Über die Gründung des Ich im Selbst lässt sich nicht objektiv (im Sinne einer Ausklammerung des Subjekts) forschen. Tatsächlich sind Ich und Selbst auch nicht vergleichbar, jedenfalls dann nicht, wenn man die Gründung des Ich im Selbst mitmacht.
Etwas allgemeiner ließe sich sagen, dass komparative Philosophie grundsätzlich einen gemeinsamen Boden voraussetzen muss, auf dem stehend verschiedene Philosophien verglichen werden. Dieser gemeinsame Boden ist das wissenschaftlich objektive Interesse, das die zu vergleichenden Philosophien auf methodisch definierte Weise in den Blick nimmt. Die Methode besteht dabei anders als bei empirischen Wissenschaften nicht darin, alle außer einer oder einigen wenigen Variablen konstant zu halten, sondern vor allem in der Voraussetzung, die verschiedenen Philosophien mit den gleichen epistemischen Mitteln untersuchen zu können. Kantisch gesprochen bleiben die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis von den zu vergleichenden Philosophien unberührt. Sie werden vorausgesetzt. Damit aber ist eben nicht nur vorausgesetzt, dass sich verschiedene Philosophien grundsätzlich vernünftig erschließen lassen müssen, sondern darüber hinaus angenommen, dass die vernünftigen Mittel, die zur Erschließung der verschiedenen Philosophien gebraucht werden, dieselben sind. Die Vernunft selbst steht in der komparativen Philosophie also gar nicht in Frage. Nun ist Philosophie aber von alters her immer auch Vernunftforschung oder, richtiger, Selbsterforschung der Vernunft. Wie aber soll sich die Selbsterforschung der Vernunft sinnvoll untersuchen lassen, wenn immer schon ein bestimmtes Vernunftverständnis vorausgesetzt ist? Hier kommt quasi durch die Hintertür ein universalistischer Ansatz ins Spiel, der freilich nicht offensiv vertreten, sondern im Namen der Wissenschaftlichkeit stillschweigend vorausgesetzt wird (es ist nicht verwunderlich, dass es dementsprechend auch Ansätze komparativer Philosophie gibt, die dem Relativismus das Wort reden). Das ist in einer bestimmten Dimension völlig richtig, auch die komparative Philosophie bleibt deshalb auf ihre Weise im Recht. In dieser Dimension geht es um die Sammlung von Kenntnissen und das Erklären von Unterschieden, es geht in ihr dagegen nicht um Verstehen, Dialog oder Erfahrung. Es handelt sich folglich um eine sachliche Dimension. Die Sachen, um die es in dieser Dimension geht, sind die verschiedenen Philosophien. Komparative Philosophie interessiert sich dafür, die Philosophien anderer Traditionen kennen zu lernen, sie reflektiert aber in den seltensten Fällen auf die Begegnung von Kulturen selbst, die ja eine Vorbedingung für die Wahrnehmung der anderen Philosophien ist. Die Philosophie weitet ihr Arbeitsfeld in der komparativen Philosophie auf andere Kulturen aus; sie wird darin aber nicht selber interkulturell.
ElberfeldElberfeld, Rolf macht am Beispiel der komparativen Ethik allerdings darauf aufmerksam, dass die komparative Philosophie nicht notwendiger Weise auf der rein sachlichen Ebene stehen bleiben muss. So verweist er auf das von HalbfassHalbfass, Wilhelm vorgeschlagene »dialogische Vergleichen«, das versucht, unterschiedliche Ethiken in ein Gespräch miteinander zu bringen.6 ConnollyConnolly, Tim unterscheidet zudem vier große Richtungen komparativer Philosophie: Universalismus, Pluralismus (gemeint ist Relativismus), Konsenstheorie und globale Philosophie.7 Die letztgenannte globale Philosophie geht über das Vergleichen hinaus darin, dass sie eine Interaktion der verschiedenen Philosophien und die gemeinsame Herausbildung einer globalen Philosophie propagiert. Das klingt gut, zumal damit erstmals ein Hinweis auf die Dynamik und Wandelbarkeit von Philosophien gegeben wird. Philosophien sind ja keine statischen Denkraster, sondern entwickeln sich – auch im Austausch mit anderen Philosophien – beständig weiter (wobei Weiterentwicklung nicht Fortschritt bedeuten muss). Freilich verbleibt eine solche Interaktion in der Perspektive komparativer Philosophie trotz allem in einer sachlichen Dimension. Die Interaktion wird nämlich so verstanden, dass die verschiedenen Philosophien mit Blick auf ein spezifisches Sachproblem unterschiedliche Lösungen oder Verständnisse bereitstellen, aus denen in komparativer Einstellung die beste gewählt werden kann. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass nicht nur die Antworten, die verschiedene Philosophien auf ein Sachproblem geben, verschieden ausfallen können, sondern dem zuvor schon das Sachproblem selbst möglicherweise ganz unterschiedlich aufgefasst wird. Der komparative Ansatz bleibt auf diesem Auge eigentümlich blind. Er verkennt die geschichtlichen Dimensionen, die in jeder Philosophie mitschwingen und die es schwierig machen, einzelne Einsichten ohne weiteres auf andere Traditionen zu übertragen.
Der universalistische Tenor komparativer Philosophie kann deshalb trotz anders lautender Absicht dazu führen, die Philosophien anderer Traditionen an europäisch-westlichen Rationalitätsstandards zu messen. So spricht beispielsweise WireduWiredu, Kwasi von einer »cross-cultural evaluation«8 des Denkens auf der Grundlage universaler Rationalitätsstandards. Er sieht in der rationalen Prüfung von Einsichten anderer philosophischer Traditionen eine entscheidende Aufgabe komparativer Philosophie. Solche Prüfung ermöglicht es, Wiredu zufolge, die vermeintlich philosophischen Errungenschaften der verschiedenen Traditionen in zwei Gruppen zu unterteilen: Die eine Gruppe kann universale Gültigkeit beanspruchen; die andere kann das nicht und vermag deshalb auch nicht, Eingang in die Gestaltung einer transkulturellen Welt zu finden.
2.1.3 Polylog
Den Begriff des Polylog hat WimmerWimmer, Franz M. in die interkulturelle Philosophie eingebracht.1 Polylog bedeutet im Griechischen Vielstimmigkeit, womit freilich das wirre Durcheinander des bloßen Geredes gemeint ist. Dagegen setzten die Griechen die Einheit des Logos (der Vernunft), der die verschiedenen Stimmen auf ihre gemeinsame Grundlage verpflichtet. Wimmer hat den Begriff des Polylog aufgegriffen und auf die interkulturelle Situation bezogen. Er will die interkulturelle Vielstimmigkeit nun aber gerade nicht auf eine ihr zugrunde liegende Einheit reduzieren, sondern versteht den Polylog als einen offenen Austausch, in dem um den gemeinsamen Logos erst gerungen werden muss. So versteht er seinen polylogischen Ansatz denn als einen Schritt über bloß komparative Philosophie und die Aufklärung »mit dem Mittel einer voraussetzungslosen Wissenschaft« hinaus.2 Wenn er in seiner »Minimalregel« fordert, »keine philosophische These für gut begründet [zu halten], an deren Zustandekommen nur Menschen einer einzigen kulturellen Tradition beteiligt waren«,3 dann deshalb, weil er die Pluralität der Logoi ernst nimmt. Ein gemeinsamer Logos ist in erster Linie das Ergebnis des Austausches und erschöpft sich nicht darin, Voraussetzung für die Teilnahme am Polylog zu sein. Und doch gilt, dass sich am Polylog sinnvollerweise nur derjenige beteiligen kann, der zum gemeinsamen Logos auch etwas beizutragen hat. Der Polylog, so wie Wimmer ihn versteht, setzt deshalb neben der Pluralität der Logoi deren Fähigkeit voraus, zu einem gemeinsamen Logos beizutragen. Damit rückt er in deutliche Nähe zu HabermasHabermas, Jürgen’ Diskurstheorie. Der Polylog lässt sich geradezu als eine Anwendung der Diskurstheorie auf die interkulturelle Situation verstehen. Schon Habermas beschränkt den Diskurs nicht auf die europäisch-westliche Gesellschaft, sondern bindet grundsätzlich alle Menschen ein. Wimmer formuliert mit dem Polylog nun gleichsam den besonderen Fall eines interkulturellen Diskurses und fordert, jeden Geltungsanspruch kulturübergreifend zur Prüfung zu stellen. Es geht ihm nicht nur darum, grundsätzlich alle Menschen in den Diskurs einzubinden, sondern er betont die Notwendigkeit, endlich auch die Stimmen jener Völker zu hören, die in Zeiten von Kolonialismus und Eurozentrismus lange unterdrückt waren. Damit rückt das Ideal der Herrschaftsfreiheit der Sprechsituation in den Mittelpunkt. Wimmer spricht ausdrücklich von einem »gewaltfreien, entkolonialisierten Diskurs«.4 Auch legt er entscheidenden Wert darauf, nicht allein den »zwanglosen Zwang des besseren Arguments« (s.o.) gelten zu lassen, sondern tatsächlich verschiedene Traditionen zu Wort kommen zu lassen. In einem späteren Text stellt Wimmer der negativen Formulierung der Minimalregel deshalb eine positive zur Seite: »Suche wo immer möglich nach transkulturellen Überlappungen von philosophischen Begriffen, da es wahrscheinlich ist, dass gut begründete Thesen in mehr als nur einer kulturellen Tradition entwickelt worden sind.«5 Darin spricht sich die Motivation, ehemals kolonialisierte und marginalisierte Völker und deren Traditionen als gleichberechtigte Gesprächspartner anzuerkennen, deutlich aus.