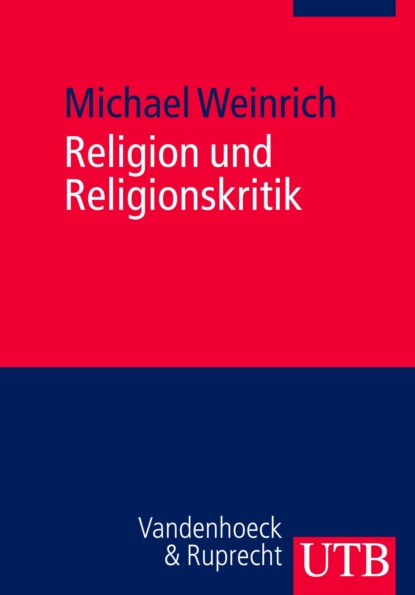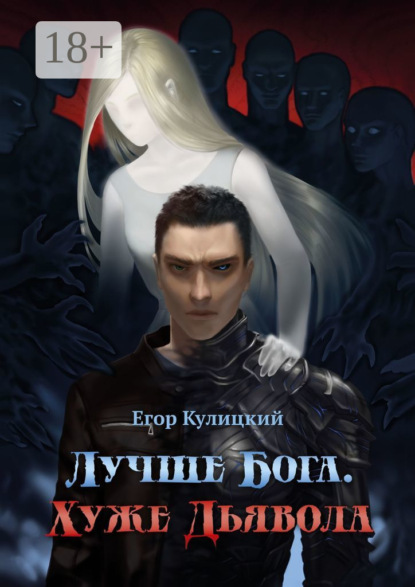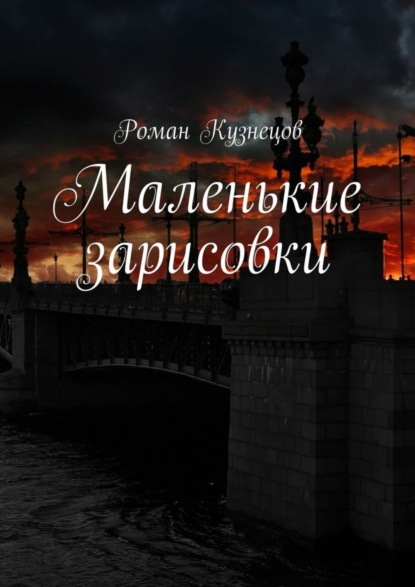- -
- 100%
- +
Um dem modernen Staatsbürger ein aufgeklärtes Verhältnis zur Religion zu ermöglichen, will Spinoza die traditionelle Theologie durch eine Religionsphilosophie bzw. eine Gottesphilosophie beerben. Der Weg des Glaubens führt zwangsläufig in Aberglauben und Götzendienst und somit in Unfrieden und Unfreiheit, solange er sich vor der Kritik der Vernunft immunisiert. Gott und Wahrheit sind identisch, sodass sich im wahren Denken Gott selbst artikuliert. Vermittels des Denkens kann der Mensch geradezu die grenzenlose Vollkommenheit Gottes repräsentieren. Dabei wird Gott mit dem Akt identifiziert, der im wahren Denken von Vollkommenheit und Unendlichkeit vollzogen wird. Jede Verknüpfung mit einer bestimmten Gestalt soll auf diese Weise ausgeschlossen werden, weil diese immer nur mit endlichen und somit ungöttlichen Vorstellungen vorgenommen werden könnte. Zugleich bedeutet diese Bestimmung auch eine Loslösung von den biblischen Zeugnissen und allen überkommenen Lehrtraditionen. Die Bibel muss zum Gegenstand historischer Kritik werden, um den in ihr enthaltenen Geist Gottes, wie er sich besonders bei den Propheten findet, herauszustellen. Die Schrift wendet sich in ihrer moralisch-praktischen|31◄ ►32| Bedeutung gleichsam an die ungebildeten Massen, indem sie „sich nach der Fassungskraft und den Anschauungen derer richtet, denen die Propheten und Apostel zu predigen pflegten, und zwar aus dem Grunde, damit es die Menschen ohne Widerstreben und mit ganzem Herzen annehmen möchten“.42
Spinoza verfolgt in seiner Philosophie die Vorstellung, dass es essenziell nur eine Substanz geben kann, die als Grund und Ursache für die ganze Wirklichkeit anzusehen ist. Ein streng verstandener Monotheismus wird mit dem cartesianischen Rationalismus verbunden, sodass schließlich Gott identisch wird mit dem in sich geschlossenen Kausalsystem der sich selbst erschaffenden und durch sich selbst geschaffenen Natur. Sowohl der Vorwurf des Pantheismus als auch der des Materialismus berufen sich auf diese Zuspitzung, treffen aber nicht das eigentliche Zentrum seines Anliegens. Alle Begriffe, die sich der Mensch von der Wirklichkeit in Ansehung ihrer Endlichkeit macht, kommen nicht über vage Vorstellungen hinaus, die als solche auch ständig zu revidieren sind.
Das gilt in besonderer Weise im Blick auf die menschlichen Gottesvorstellungen. Jeder Mensch passt Gott seinem jeweiligen Vorstellungsvermögen an. Die Bibel ist ebenfalls nur der Ausdruck des Vorstellungsvermögens einer weit zurückliegenden Zeit, der als solcher nur historische Bedeutung haben und für den gegenwärtigen Menschen keineswegs als verbindlich angesehen werden kann. Aktuell bleibt allein das zugrunde liegende Anliegen, für eine humane Gestaltung des Zusammenlebens zu sorgen. Der rechte Lebenswandel und die Tugend werden in der Bibel in anschaulich ausgeschmückter Verpackung vorgetragen; allerdings ist die sich um die moralische Belehrung rankende Vorstellungswelt einschließlich aller Vorstellungen vom Handeln Gottes für den Glauben nicht essenziell.
Was übrigens Gott oder jenes Vorbild des wahren Lebens ist, ob er Feuer, Geist, Licht, Gedanke usw. ist, gehört nicht zum Glauben, so wenig wie der Grund, aus dem er das Vorbild des wahren Lebens ist, ob deshalb, weil sein Sinn gerecht und barmherzig ist, oder weil alle Dinge durch ihn sind und handeln und infolgedessen auch wir durch ihn erkennen und durch ihn einsehen, was wahrhaft recht und gut ist. Es ist einerlei, was jeder davon hält. Es gehört ferner nicht zum Glauben, ob einer annimmt, daß Gott nach seinem Wesen oder nach seiner Macht allenthalben ist, daß er die Dinge aus Freiheit leitet oder nach Naturnotwendigkeit, daß er die Gesetze als Herrscher vorschreibt oder sie als ewige Wahrheiten lehrt, daß der Mensch aus freiem Willen oder aus der Notwendigkeit göttlichen Ratschlusses Gott gehorcht, und daß endlich die Belohnung der Guten und die Bestrafung der Bösen auf natürlichem oder übernatürlichem Wege erfolgt. Bei diesen und ähnlichen Fragen ist es in Ansehung des Glaubens gleichgültig, wie ein jeder darüber denkt, solange er nicht zu dem Schlusse kommt, sich eine größere Freiheit zu sündigen herauszunehmen oder Gott weniger gehorsam zu sein. Ja, vielmehr ist ein jeder, wie schon gesagt, verpflichtet, diese Glaubenssätze seiner Fassungskraft anzupassen und sie sich so auszulegen, wie er glaubt, daß er sie leichter, ohne jedes Bedenken und mit ganzem Herzen annehmen kann, um dann Gott aus ganzem Herzen zu gehorchen. (218 f.)
|32◄ ►33|
So sehr es ‚einerlei ist, was jeder davon hält‘, so wenig ist es offenkundig in das Ermessen des Einzelnen gestellt, sich möglicherweise auch gar nicht zum Glauben zu verhalten. Spinoza spricht von einer Pflicht, sich den Glauben so plausibel wie irgend möglich zurechtzulegen, wobei auch in Rechnung zu stellen bleibt, dass sich über die Zeiten hinweg die Vorstellungsweisen gründlich geändert haben, sodass der eingeräumten Freiheit durchaus eine eigene Gestaltungsmöglichkeit entspricht – wobei die Zielrichtung klar bleiben muss: Es geht um den Frieden der Gesellschaft im modernen Nationalstaat. In diesem Sinne spitzt Spinoza seinen Gedankengang zu:
Denn, wie ich schon bemerkt, geradeso wie einst der Glaube entsprechend der Fassungskraft und den Anschauungen der Propheten und des Volkes jener Zeit offenbart und niedergeschrieben worden ist, so ist auch jetzt noch jedermann verpflichtet, ihn seinen Anschauungen anzupassen, um ihn auf diese Weise ohne inneres Widerstreben und ohne Zaudern annehmen zu können. Denn ich habe gezeigt, daß der Glaube nicht so sehr Wahrheit als Frömmigkeit fordert und nur in Ansehung des Gehorsams fromm und seligmachend ist und daß infolgedessen jeder nur in Ansehung des Gehorsams gläubig ist. Nicht wer die besten Gründe für sich hat, hat deshalb notwendig auch den besten Glauben, sondern derjenige, der die besten Werke der Gerechtigkeit und der Liebe aufzuweisen hat. Wie heilsam und notwendig diese Lehre im Staate ist, damit die Menschen in Frieden und Eintracht miteinander leben, und namentlich wie viele Ursachen von Wirren und Verbrechen dadurch beseitigt werden, das überlasse ich jedem selbst zu beurteilen. (219)
Im Grunde werden der Staat bzw. die Inhaber der Regierungsgewalt zu den maßgeblichen Auslegern von Religion und Frömmigkeit, sodass auch umgekehrt gilt, dass sich die rechte Frömmigkeit in der Liebe zum Staat bzw. Vaterland zeigt. Und selbst dann, wenn sich die Inhaber der Regierungsgewalt als gottlos erweisen, hat niemand das Recht, gegen sie das göttliche Recht in Schutz zu nehmen. Spinoza kann pointiert sagen:
Sicherlich ist die Liebe zum Vaterland die höchste Frömmigkeit, die man zeigen kann. Denn fällt die Regierung weg, so kann nichts Gutes mehr bestehen, alles kommt in Gefahr, und bloß die Wut und die Gottlosigkeit herrschen zum größten Schrecken aller. Daraus folgt, daß jedes fromme Werk am Nächsten sogleich gottlos wird, wenn dem ganzen Staat daraus ein Schaden erwächst, und daß umgekehrt eine gottlose Tat gegen den Nächsten als frommes Werk anzusehen ist, wenn sie um die Erhaltung des Staates willen geschieht. So ist es z. B. eine fromme Tat, wenn ich dem, der mit mir streitet und mir den Rock nehmen will, auch noch den Mantel gebe. Sobald man sich aber sagen muß, daß diese Handlungsweise verderblich ist für die Erhaltung des Staates, so ist es im Gegenteil eine fromme Tat, jenen vor Gericht zu ziehen, selbst wenn er ein Todesurteil zu gewärtigen hätte. (289f.)
Hier wird man mich nun vielleicht fragen: wer wird denn, wenn die Inhaber der Regierungsgewalt gottlos sein wollen, von Rechts wegen die Frömmigkeit in Schutz nehmen? Sind diese auch dann als die Ausleger der Frömmigkeit anzusehen? ... Soviel ist sicher: wenn die Inhaber der Regierungsgewalt tun wollen, was ihnen beliebt, so ist es einerlei, ob sie das Recht in geistlichen Angelegenheiten haben oder nicht: alles, Weltliches wie Geistliches, wird ins Verderben stürzen; aber noch weit schneller wird das geschehen, wenn Privatleute in aufrührerischer|33◄ ►34| Weise das göttliche Recht beschützen wollen.... Ob wir nun die Wahrheit der Sache selbst oder die Sicherheit des Staates oder ob wir das Gedeihen der Frömmigkeit ins Auge fassen, jedenfalls müssen wir festhalten, daß auch das göttliche Recht oder das Recht in geistlichen Dingen von dem Beschluß der höchsten Gewalten ohne Einschränkung abhängig sein muß und daß nur diese seine Ausleger und Beschützer sind. Daraus ergibt sich, daß nur diejenigen Diener des göttlichen Wortes sind, die das Volk vermöge der Autorität der höchsten Gewalten die Frömmigkeit lehren, wie sie nach deren Entscheide dem öffentlichen Wohle angemessen ist. (294f.)

W. Bartuschat, Baruch de Spinoza, München 2006
W. Röd, Benedictus de Spinoza. Eine Einführung, Stuttgart 2002
4. John Locke
Der englische Philosoph John Locke (1632 – 1704) gilt sowohl als Begründer des Empirismus als auch der modernen liberalen Staatsauffassung unter der Maxime der Volkssouveränität.
Neben dem von Hobbes (→ § 2,2) und Spinoza (→ § 2,3) in den Vordergrund gestellten Motiv des Friedens und der Sicherheit hebt Locke nun auch mit entschlossener Emphase das Motiv der Freiheit hervor, deren Schutz der Regierung Grenzen auferlegt und die Forderung einer Gewaltenteilung aufscheinen lässt (voll ausgebildet erst bei Montesquieu). Zwar kann der Staat ausdrücklich nicht die Oberherrschaft über die Religion beanspruchen, aber zugleich sind die zu tolerierenden Religionsgemeinschaften zu Loyalität und sittlichem Wohlverhalten dem Gemeinwesen gegenüber angehalten. Zwei Aspekte gilt es besonders hervorzuheben: a) die staatsphilosophisch begründete Toleranzforderung und b) den besonderen Zugang zum Gottesglauben und somit zur Religion.
a) Locke fordert, dass eine Gesellschaft so verfasst sein müsse, dass sie in Frieden und Sicherheit zusammenleben kann. Im Mittelpunkt steht dabei die Forderung der Toleranz, ohne die es keinen haltbaren Frieden geben kann, verbunden mit einer konsequenten Trennung von Kirche und Staat.
Es ist nicht die Verschiedenheit der Meinungen (die nicht vermieden werden kann), sondern die Verweigerung der Toleranz (die hätte gewährt werden können) für die, die verschiedener Meinung sind, die alle die Tumulte und Kriege erzeugt hat, die es in der christlichen Welt wegen der Religion gegeben hat. Die Häupter und Leiter der Kirche, von Habsucht und unersättlichem Verlangen zu herrschen getrieben, haben die oft von maßlosen Ehrgeiz besessene Obrigkeit und das auf seinen Aberglauben jederzeit eitle Volk gegen die, die anders denken als sie, entflammt und aufgeregt, indem sie in ihrem Widerspruch mit den Gesetzen des Evangeliums und den Vorschriften predigen, daß Schismatiker und Häretiker um ihren Besitz gebracht und vernichtet werden müßten. Und so haben sie zwei Dinge, die an sich höchst verschieden sind, vermischt und verwirrt: die Kirche und das Gemeinwesen.43
|34◄ ►35|
Es ist eine gesellschaftliche und somit staatliche Aufgabe, die bürgerlichen Interessen zu schützen, worunter Locke versteht: „Leben, Freiheit, Gesundheit, Schmerzlosigkeit des Körpers und den Besitz äußerer Dinge wie Geld, Ländereien, Häuser, Einrichtungsgegenstände und dergleichen.“(13) Das Gewaltmonopol des Staates dient dem Schutz der bürgerlichen Rechte. Dabei fällt die Religion in die Freiheit des Bürgers, wobei sie sich selbst auch von jedem Zwang freizuhalten und auf die öffentliche Verehrung Gottes und den Erwerb des ewigen Lebens zu konzentrieren hat (vgl. 25 f.). In spekulativen Meinungen – so nennt Locke die Glaubensartikel – darf es weder von Seiten des Staates noch vonseiten der Religionsgemeinschaften irgendeinen Zwang geben, weil sie nicht in das Gebiet der menschlichen Macht fallen. Die Toleranz hat allein da ihre Grenze, wo die Existenz Gottes geleugnet wird, weil damit jede Verbindlichkeit infrage gestellt werde, durch welche die menschliche Gesellschaft zusammengehalten werde.
Von den Religionsartikeln sind einige praktisch, einige spekulativ. Obwohl nun beide in der Erkenntnis der Wahrheit bestehen, so beziehen sich doch diese bloß auf den Verstand, jene beeinflussen den Willen und das Verhalten. Daher können spekulative Meinungen und sogenannte Glaubensartikel, an die bloßer Glaube gefordert ist, keiner Kirche durch das Gesetz des Landes auferlegt werden. Denn es ist absurd, daß Dinge durch Gesetze eingeschärft werden sollten, die zu Stande zu bringen nicht in menschlicher Macht liegt. Zu glauben, daß dies oder das wahr ist, hängt nicht von unserem Willen ab... .
Ferner darf die Obrigkeit nicht das Predigen oder Bekennen von spekulativen Meinungen in einer Kirche verbieten, weil diese keinerlei Beziehungen auf die bürgerlichen Rechte der Untertanen haben. Wenn ein römischer Katholik glaubt, daß das, was ein andrer Brot nennt, wirklich der Leib Christi ist, so tut er dadurch seinem Nächsten kein Unrecht. Wenn ein Jude nicht glaubt, daß das Neue Testament Gottes Wort ist, so ändert er dadurch nichts an den bürgerlichen Rechten der Menschen. Wenn ein Heide beide Testamente bezweifelt, so darf er deswegen nicht als ein gefährlicher Bürger bestraft werden. Die Macht der Obrigkeit und die Besitztümer des Volkes können gleich sicher sein, ob nun einer diese Dinge glaubt oder nicht. Ich gestehe bereitwillig, daß diese Meinungen falsch und absurd sind. Aber es ist nicht die Aufgabe der Gesetze, für die Wahrheit von Meinungen, sondern für das Wohl und die Sicherheit des Gemeinwesens und der Güter und der Person jedes einzelnen Sorge zu tragen. So gehört es sich. (79f.)
Letztlich sind diejenigen ganz und gar nicht zu dulden, die die Existenz Gottes leugnen. Versprechen, Verträge und Eide, die das Band der menschlichen Gesellschaft sind, können keine Geltung für einen Atheisten haben. Gott auch nur in Gedanken wegnehmen, heißt alles dieses auflösen. Auch abgesehen davon können die, die durch ihren Atheismus alle Religion untergraben und zerstören, sich nicht auf eine Religion berufen, auf die hin sie das Vorrecht der Toleranz fordern könnten. Was andere praktische Meinungen, auch wenn sie nicht gänzlich von allem Irrtum frei sind, angeht, so kann es keinen Grund geben, sie nicht zu dulden, wenn sie nicht dahin zielen, eine Herrschaft über andere oder bürgerliche Straflosigkeit für die Kirche, in der sie gelehrt werden, einzuführen. (95)
In dem Text wird deutlich, dass Locke zwischen Heiden und Atheisten unterscheidet. Während die Atheisten das in Gott festgemachte Band des Zusammenhalts der Gesellschaft bestreiten und damit der Gesellschaft gleichsam ihren festen Rückhalt |35◄ ►36| entziehen, sind mit den Heiden diejenigen gemeint, die an andere als eben den christlichen oder den jüdischen Gott glauben.
b) Der besondere Zugang Lockes zur Religion hängt mit seinen philosophischen Grundentscheidungen zusammen, die ihn sowohl zum Begründer des englischen Empirismus als auch des aufklärerischen Rationalismus werden ließen. Alle Bewusstseinsinhalte werden durch äußere sinnliche oder innere Wahrnehmungen (Erfahrungen) hervorgerufen. Das Wissen um Gott ist dem Menschen nicht angeboren (wie bei Descartes oder Leibniz), aber unsere Vernunft führt uns „von der Betrachtung unserer selbst und dessen, was wir unfehlbar in unserer eigenen Beschaffenheit finden, zu der Erkenntnis dieser sicheren und offenkundigen Wahrheit, daß es ein ewiges, allmächtiges und allwissendes Wesen gibt.“44 Es handelt sich um ein Wissen, das „uns dann nicht entgehen kann, wenn wir uns nur mit unserm Denken ebenso darum bemühen wie um manche anderen Forschungen.“ (298) Auch wenn die biblische Überlieferung auf Offenbarung verweist, bleibt ihr Inhalt einer Prüfung nach bestimmten Kriterien der Vernunft ausgesetzt, die sich nicht einfach auf eine behauptete Autorität verlässt, sondern auf Klärung drängt. Nur so ist es möglich, ein klares Wissen von Gott zu erlangen. Ohne kritische Prüfung wird unsere Kenntnis über Gott „ebenso unvollkommen sein, wie die eines Menschen, dem man gesagt hat, die drei Winkel eines Dreiecks seien gleich zwei rechten, und der das auf Treu und Glauben hinnimmt, ohne den Beweis dafür zu prüfen. Er mag diesem Satz als einer glaubhaften Meinung zustimmen, hat aber keine Kenntnis von seiner Wahrheit, obwohl ihn seine Fähigkeit, sorgfältig angewandt, diese klar und einleuchtend machen könnte.“ (Bd. I, 101 f.) Die folgende Gedankensequenz legt dar, mit welchen Schritten Locke zu dem Gedanken vorstößt, dass die Vernunft als„natürliche Offenbarung“ anzusehen sei:
Erstens behaupte ich, daß kein von Gott inspirierter Mensch durch irgendwelche Offenbarung andern Menschen neue einfache Ideen mitteilen könnte, die sie nicht schon vorher auf Grund von Sensation und Reflexion besaßen... . Denn Wörter verursachen durch ihre unmittelbare Einwirkung auf uns keine anderen Ideen in uns als die ihrer natürlichen Laute; erst dadurch, daß sie gewohnheitsmäßig als Zeichen gebraucht werden, kommen sie dazu, in unserem Geist latente Ideen wachzurufen und wiederzubeleben, aber auch dann immer nur solche, die sich schon vorher da befanden. (Bd. II, 393 f.)
Zweitens behaupte ich, daß durch Offenbarung uns dieselben Wahrheiten enthüllt und überliefert werden können, die wir auch mit Hilfe der Vernunft und der auf natürlichem Wege erlangten Ideen entdecken können. So könnte Gott die Wahrheit irgendeines Satzes im Euklid ebensogut durch Offenbarung enthüllen, wie die Menschen durch den naturgemäßen Gebrauch ihrer geistigen Fähigkeiten von selbst dazu gelangen, ihn zu entdecken. Bei allen Dingen dieser Art ist die Offenbarung wenig vonnöten oder nützlich, weil Gott uns natürliche und sichere Mittel in die Hand gegeben hat, um zu ihrer Erkenntnis zu gelangen. Denn jede Wahrheit, die wir mit Hilfe der Kenntnis und Betrachtung unserer eigenen Ideen klar entdecken, wird für uns immer größere Gewißheit besitzen als die Wahrheiten, die uns durch überlieferte Offenbarung vermittelt werden. (395)
|36◄ ►37|
Alles, was Gott geoffenbart hat, ist sicherlich wahr; daran ist jeder Zweifel ausgeschlossen. Das bildet den eigentlichen Gegenstand des Glaubens. Ob aber etwas als göttliche Offenbarung anzusehen ist oder nicht, darüber muß die Vernunft entscheiden. Und sie kann dem Geist niemals erlauben, eine größere Augenscheinlichkeit zu verwerfen, um etwas weniger Einleuchtendes zu akzeptieren; auch kann sie ihm nicht gestatten, im Gegensatz zur Erkenntnis und Gewißheit an der Wahrscheinlichkeit festzuhalten. Dafür, daß eine überlieferte Offenbarung in dem Wortlaut, in dem sie uns übermittelt ist, oder in dem Sinne, in dem wir sie verstehen, göttlichen Ursprungs sei, kann es kein Zeugnis geben, daß so klar und gewiß wäre wie das der Prinzipien der Vernunft. Deshalb kann nichts, was den klaren, von selbst einleuchtenden Aussagen der Vernunft widerspricht und mit ihnen unvereinbar ist, beanspruchen, als Glaubenssache, mit der die Vernunft nichts zu tun habe, geltend gemacht oder anerkannt zu werden. (402f.)
Vernunft ist natürliche Offenbarung, durch die der ewige Vater des Lichts und der Quell aller Erkenntnis den Menschen denjenigen Teil der Wahrheit vermittelt, den er ihren natürlichen Fähigkeiten zugänglich gemacht hat. Offenbarung ist natürliche Vernunft, erweitert durch eine Reihe neuer Entdeckungen, die Gott unmittelbar kundgegeben hat und für deren Wahrheit die Vernunft die Bürgschaft übernimmt, indem sie ihren göttlichen Ursprung bezeugt und beweist. Wer deshalb die Vernunft beseitigt, um der Offenbarung den Weg zu ebnen, der löscht das Licht beider aus. Er handelt ebenso wie jemand, der einen Menschen überreden will, sich die Augen auszustechen, um durch ein Teleskop das ferne Licht eines unsichtbaren Sternes besser beobachten zu können. (406)
Wer sich darum nicht allen Maßlosigkeiten der Täuschung und des Irrtums ausliefern will, muß diesen Führer seines inneren Lichtes einer Prüfung unterziehen. Wenn Gott jemand zum Propheten macht, so vernichtet er deshalb noch nicht den Menschen in ihm. Er läßt dessen sämtliche Fähigkeiten in ihrem natürlichen Zustande, damit er fähig ist, zu beurteilen, ob die Inspirationen, die er erfährt, göttlichen Ursprungs sind oder nicht. Wenn Gott den Geist mit übernatürlichem Licht erhellt, so löscht er deshalb das natürliche Licht nicht aus. Wenn er will, daß wir der Wahrheit eines Satzes zustimmen sollen, so richtet er es entweder so ein, daß uns diese Wahrheit durch die gewöhnlichen Methoden der natürlichen Vernunft einleuchtet, oder aber er gibt uns zu verstehen, daß es sich um eine Wahrheit handele, der wir auf Grund seiner Autorität zustimmen sollen. Dann überzeugt er uns durch bestimmte Kennzeichen, bei denen sich der Verstand unmöglich irren kann, davon, daß diese Wahrheit von ihm stamme. Die Vernunft muß unser oberster Richter und Führer in allen Dingen sein. (414f.)

W. Euchner, John Locke zur Einführung, Hamburg 2004
5. John Toland
Der irische Philosoph John Toland (1670 – 1722) gilt als Begründer des Deismus, womit ein allein vernunftbegründetes Gottesverständnis im Horizont einer moralisch verstandenen natürlichen Religion bezeichnet wird.
Von den Religionsphilosophen und Gesellschaftstheoretikern der frühen Aufklärung wird der christliche Glaube vor allem unter dem Gesichtspunkt seiner Funktion für die menschliche Gemeinschaft betrachtet. Die praktische Notwendigkeit und die gesellschaftliche Nützlichkeit |37◄ ►38| werden zum kritischen Maßstab für die Bestimmungen des Glaubens und der den Konfessionen übergeordneten Religion. Konsequent versucht John Toland den von John Locke (→ § 2,4) eingeschlagenen Weg zu Ende zu gehen. Der von Toland geprägte Deismus betont die Schöpferrolle Gottes, wobei die Vernunft des Menschen als ein besonderes Werk dieser Schöpfung hervorgehoben wird, mit dem Gott den Menschen ausgezeichnet habe, um ihm dann auch die Schöpfung zur eigenen Gestaltung überlassen zu können. Gott selbst hat sich aus der Schöpfung weithin zurückgezogen, um den Menschen den Platz zu ihrer Selbstentfaltung zu überlassen.
Das Christentum wird auf der Linie seiner Übereinstimmung mit der Vernunft als praktische Lebensorientierung gegen den von den Kirchen und ihren Amtsträgern gestützten Aberglauben verteidigt. Die sittlich-religiöse Kraft des Christentums, wie sie in den biblischen Quellen noch offenkundig ist, sei im Laufe der Kirchengeschichte verunstaltet und durch heidnische Elemente überlagert und geschwächt worden. In all seinen wesentlichen Aspekten stimme das Christentum vollkommen mit der natürlichen Religion des Menschen überein, was sich in einer konsequent vernünftigen Betrachtung unabweislich aufzeigen lasse. Wo Locke lediglich eine vernünftige Bewertung erwartet, fordert Toland eine Begründung durch die Vernunft. Die Tradition hat vor der Vernunft den Wahrheitsbeweis zu erbringen, wenn sie Gültigkeit beanspruchen und als Wort Gottes gewürdigt werden will. Christianity Not Mysterious ist der Titel seiner wirkungsvollsten Publikation (1696), mit der er zeigen will, dass es im christlichen Glauben nirgends darum gehe, irgendwelche Geheimnisse anerkennen zu müssen. Diese Schrift wurde in Dublin öffentlich verbrannt und brachte Toland auch in London in Bedrängnis.
Im Gegensatz dazu sind wir der Ansicht, daß die Vernunft die eigentliche Grundlage aller Gewißheit ist, und daß nichts Offenbartes, mag es nun seine besondere Form oder seinen Inhalt angehen, von ihrer Prüfung mehr ausgenommen ist als die regelmäßigen Naturerscheinungen. So folgern wir denn in Übereinstimmung mit dem Titel dieser Abhandlung, daß im Evangelium nichts Widervernünftiges und nichts Übervernünftiges enthalten sei, und daß keine christliche Lehre eigentlich ein Mysterium genannt werden kann.
Und noch pointierter:
Was in der Religion geoffenbart ist, das muß und kann, da es überaus nützlich und notwendig ist, ebenso leicht verstanden und mit unseren allgemeinen Begriffen in Übereinstimmung gefunden werden, wie das, was wir von Holz, Stein, Luft, Wasser oder dergleichen wissen.45
Soll etwas für den Menschen verbindliche Bedeutung haben und aufrichtigen Glauben konstituieren, muss es seinem Begriffsvermögen uneingeschränkt zugänglich sein. So kann es etwa nicht angehen, dass Gott mit seinen Wundern die von ihm selbst geschaffenen Naturgesetze überspringe; vielmehr lassen sich – wenn auch nicht in jedem Falle – Erklärungen beibringen, die ohne einen Widerspruch von Natur |38◄ ►39| und göttlichem Wirken auskommen. Am deutlichsten tritt die annoncierte kritische Spannung im Umgang mit den biblischen Texten hervor: