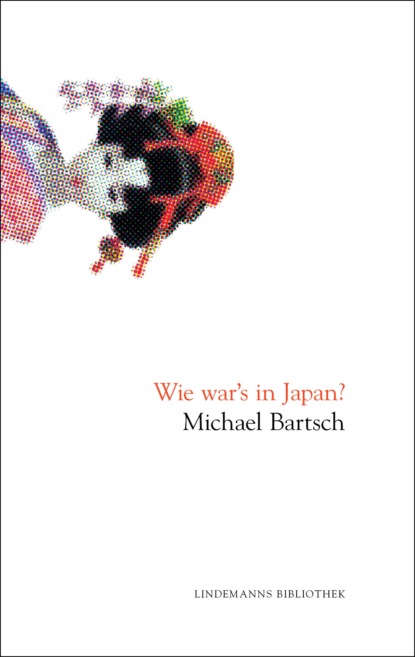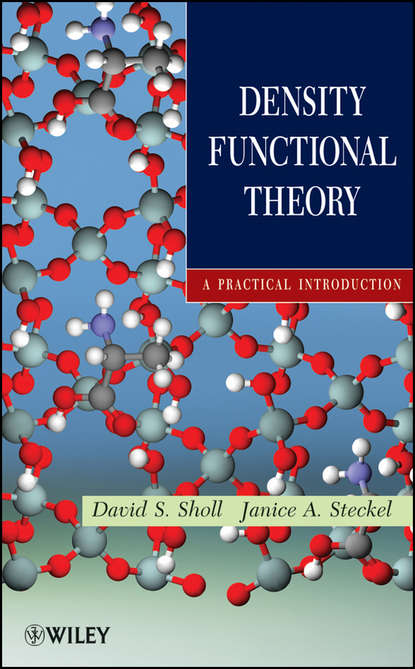Das Erwachen der Gletscherleiche
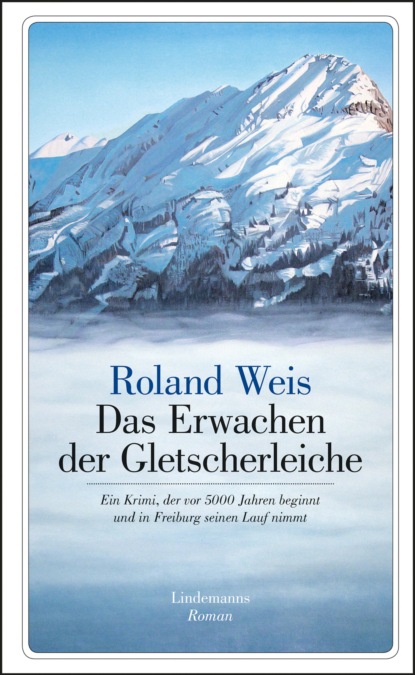
- -
- 100%
- +
„Ich glaube, links“, sagte Mona schließlich zögernd.
„Rechts“, widersprach Armin. Sie warf ihm einen kurzen Giftblick zu. Urs Rüthli registrierte es aus seinem Polizeiaugenwinkel, obwohl es aussah, als sei er ganz und gar in den Laptopbildschirm versunken.
„Ich habe hier Ihr Bild hochgeladen“, erklärte er jetzt und drehte den Laptop auf den Knien um, so dass die beiden einen Blick darauf werfen konnten.
„Na also, links“, triumphierte Mona.
„Hat irgend jemand von Ihrer Gruppe die Hand angefasst, irgendwie berührt?“
Mona schüttelte sich. „Was denken Sie. Das ist doch gruslig. Nie und nimmer!“
„Der Bergführer hat mit seinem Messer daran herumgekratzt“, erinnerte sich jetzt Armin, deutlich konstruktiver als zuvor. Inzwischen hatte er sich auch in einen der schwarzen Ledersessel bequemt. Er hatte kapiert, dass dieser schweizerische Polizeibeamte nicht mit ein paar schnellen, mürrischen Antworten abzufertigen war. Der machte den Eindruck, als würde er stoisch sein Programm durchziehen.
In der Tat war Rüthli keiner von der schnellen Sorte. Schon gar nicht bei einer Befragung. Wer wusste denn, wann und ob überhaupt jemals wieder er diese beiden Deutschen zu diesem Fall befragen konnte. Noch hatte er ihnen nicht eröffnet, dass die Leiche verschwunden war. Da würde er sich schon noch hinarbeiten. Zunächst einmal wollte er alles über die Bergtour und die Teilnehmergruppe wissen, über Bernie und die Amerikaner. Was haben sie gesprochen? Was haben sie an Kleidung und Ausrüstung getragen? Wann und wie haben sie sich kennengelernt? Wer ging vorne, wer in der Mitte, wer hinten in der Gruppe? Was genau hatte Bergführer Bernie nach dem Leichenfund getan? Mit wem hatte er telefoniert oder gefunkt? Wer hatte alles die Hand fotografiert? Wem hatten sie von dem Fund erzählt oder die Fotos gemailt?
Mona zögerte kurz bei dieser Frage, und selbstverständlich fiel dem unbestechlichen Rüthli dieses kurze Zögern auf.
„Na?“
„Ich überlege gerade“, redete Mona sich heraus, um Zeit zu gewinnen. Sollte sie wirklich verraten, dass sie die Fotos ans Institut geschickt hatte? An Professor Aschendorffer? Was, wenn ihr Handy beschlagnahmt wurde und die Kriminalpolizei all ihre Adressen und Mailkontakte rekonstruierte? Sie biss sich auf die Lippen. „Ich habe, ich glaube..., ich denke, das ist, ... das war ..., ich habe das schon herumgeschickt“, stammelte sie schließlich.
Rüthli wartete unerbittlich: „An wen alles?“
„Meine Mama“, gestand sie schließlich. „Vielleicht“, setzte sie dann sogleich einschränkend hinzu. „Ich glaube es.“ Sie setzte ein Gesicht auf, das hoffentlich als nachdenklich durchging. „Eine Kollegin, eine Freundin im Institut ...“, bot sie an.
„Name bitte!“, forderte Rüthli.
„Ach nein, doch nicht. Vielleicht war es auch ein Kollege. Einer von den Professoren.“ Sie warf einen hilfesuchenden Blick zu Armin.
„Hast du nicht noch in der Nacht mit deinem spinnigen Professor telefoniert?“, fragte er.
Ausgerechnet die Frage, die er auf keinen Fall hätte stellen dürfen.
Sie nickte zähneknirschend. „Der Professor, ah ja, ... äh, ja, das könnte sein. Dem habe ich das Bild geschickt.“
Rüthli ließ von seiner Tastatur ab und lehnte sich zurück. Er richtete einen prüfenden Blick auf Mona, der ihr Gewissen versengte. Wenn sie schon bei der kleinsten Notlüge zur Tomate mutierte, wie mochte man ihr dann ihre Mitwisserschaft an einem Leichendiebstahl ansehen? Verlegen richtete sie den Blick auf ihre Schuhspitzen.
„Wie heißt er doch gleich, dieser Professor?“ Rüthli fragte so freundlich wie ein Pfarrseelsorger.
Mona gab ihm die Personalien ihres Chefs. Rüthli lächelte aufmunternd. Gleich würde er aufstehen, Mona die Hand reichen, und alles wäre gut.
„Und dieser Professor, odder, der hat nicht zufällig eine Verwendung für tiefgefrorene Leichen?“ Rüthli fragte, als mache er einen Scherz. Aber er lauerte. Mona schlug die Hand vor den Mund. Sie schüttelte den Kopf. Eine Spur zu hektisch. „Nein! Nein!“
„Also nicht?“, versicherte sich Rüthli.
Jetzt brachte Mona immerhin ein säuerliches Lächeln zustande. „Nein, wirklich nicht.“
Rüthli tippte etwas in sein Laptop. Was schrieb er sich jetzt auf? Hatte sie sich etwa verraten?
Rüthli ließ eine kunstvolle Pause verstreichen. Er setzte sich auf der Sesselkante zurecht, strich sich mit den Händen über die Oberschenkel. Er lächelte. Er zupfte an seiner Uniformjacke und rückte sie am Kragen in Form. Er wandte seinen ganzen Oberkörper jetzt Mona zu und machte dabei ein Gesicht wie ein zufriedener Möbelverkäufer. Immer noch lächelte er. „Das interessiert Sie gar nicht, warum ich gefragt habe, ob der Professor sich für Leichen interessiert?“ Er legte nochmals eine quälende Pause ein. „Es ist nämlich so, dass jemand unsere Leiche gestohlen hat! Sie ist verschwunden!“
*
Die beiden Kettensägen stammten vom Hersteller Stihl und waren fast neuwertig. Es waren die größten im Handel erhältlichen Modelle, jeweils etwa 2000 Euro teuer. Beim Benzinkanister aus milchweißem Plastik handelte es sich um einen Allerweltsartikel, wie ihn jeder Baumarkt und jede Tankstelle feilbot. Der Trichter, der zum Umschütten des Benzins verwendet worden war, hatte eine Küchen- oder Gastronomievergangenheit, denn die Spurensicherung hatte neben den Benzin- auch deutliche Frittierölspuren daran festgestellt. Die große Blechkiste wimmelte wie alle anderen Beweisstücke ebenfalls von Fingerabdrücken, von denen aber kein einziger gerichtsbekannt war. Es handelte sich bei der Blechkiste um eine Alu-Transportkiste von beachtlichen Ausmaßen, 1,40 Meter lang, 80 Zentimeter breit und ebenso hoch. Urs Rüthli wuchs eine Grübelfalte auf der Stirnmitte, während er den Bericht der Spurensicherung über das Behältnis las. Inzwischen saß er wieder auf seinem baufälligen Drehstuhl am Schreibtisch in Chur und erledigte die Papierarbeit zu seinem Fall. Wie zu erwarten, fanden sich Kettensägenöl, Benzinspuren, Wasser und profaner Dreck an und in der Kiste. Auf ihrer Unterseite sammelten die Spürnasen noch einige Fasern einer groben Wolldecke ein. Es gab laut Untersuchungsbericht an und in dieser Kiste zusätzlich noch den Nachweis von Hammel-, Lamm-, und Kalbfleisch sowie von Mayonnaise und Joghurt. Feldweibel Rüthli hatte keine Fantasie, was das bedeuten konnte. Vielleicht ein Metzger? Aber was wollte der mit einer Leiche?
Hürzeler kam hereingestürmt. Die neueste Ausgabe der „Blick“ vor sich her wedelnd, als wolle er Fliegen vertreiben. „Tolle Story“, kündigte er an. „Hier schau!“ Er hatte die Seite schon aufgeschlagen und deutete auf den Aufmacher. Buchstaben so groß wie im Zentralorgan des Blindenvereins verkündeten: „Rätsel für Bergretter: Deutscher Ski-Doo schwimmt in der Flaz.“ Der Untertitel lautete: „Wollte die Deutsche Bergwacht etwas vertuschen? Fahrzeug stammt aus dem Schwarzwald. Behörden schweigen.“
Der Ski-Doo. Rüthli hatte ihn ganz vergessen. War das nicht ganz in der Nähe von ihrem Morteratsch-Fall gewesen? Hinter Samedan? Das war nicht mal zehn Kilometer von Pontresina entfernt. Der Polizeiposten Samedan bearbeitete den Fall, nicht die Kollegen von Pontresina. Das erklärte, warum Rüthli ihn aus den Augen verloren hatte. Und warum er nicht gleich auf die Idee gekommen war, das eine könnte mit dem anderen vielleicht etwas zu tun haben.
„Hürzeler“, bat er seinen Adjudanten laut um Aufmerksamkeit. Der kannte diesen Ton schon an Rüthli. Jetzt kam eine Prüffrage. Der Korporal stand unmerklich stramm. „Hürzeler, sag mir mal, wie du einen Leichnam vom Gletscher herab ins Tal transportieren würdest?“
„Mit dem Heli, odder?“
„Du hast aber gerade keinen Heli. Hubschrauber ist anderweitig im Einsatz. Was dann?“
Der Korporal grübelte. Die Schlagzeile „Rätsel für Bergretter: Deutscher Ski-Doo schwimmt in der Flaz“ lag vor ihm und heischte nach Aufmerksamkeit. Höchstwahrscheinlich hätte man einen kleinen, ferngesteuerten Modell-Ski-Doo vor seiner Nase herumfahren lassen müssen, um ihn auf die richtige Spur zu bringen. Jetzt war er noch nicht so weit. „Bin ich alleine?“, wollte er wissen.
„Nein!“ Du bist wahrscheinlich zu zweit, denn du hast zwei Kettensägen dabei“, half ihm Rüthli auf die Sprünge.
„Mit dem Akia könnt’s klappen, odder?“
Rüthli stöhnte entnervt. „Ja, könnte es. Gibt’s noch eine Möglichkeit?“ Er deutete mit dem Zeigefinger von seinem Schreibtischstuhl aus auf Hürzelers Zeitung, erhob sich, ging mit ausgestrecktem Finger die drei Schritte zu Hürzeler hinüber, und tippte mit Wucht den Finger auf die Blick-Schlagzeile. Hürzeler glotzte drauf.
„Du ..., du meinst ...?“
„Ja!“
„Mit dem Ski-Doo also. Das ist ja ein Ding.“ Jetzt war bei Hürzeler der Groschen gefallen. Er ließ sich auf seinen Stuhl fallen und studierte aufs Neue den Zeitungsartikel. Diesmal gründlich wie einen Gehaltsbescheid. Nicht dass ihm noch etwas entgangen war, was ihn der Vorgesetzte Feldweibel vielleicht fragen könnte.
Rüthli wollte zum Telefon stürmen, um sich mit dem Posten Samedan in Verbindung zu setzen. Da fiel sein Blick auf den Laborbericht, der immer noch aufgeblättert auf seinem Schreibtisch lag. Er hatte ihn noch gar nicht ganz zu Ende gelesen. Wo war er stehengeblieben? Beim Hammelfleisch in der Blechkiste.
Was gab es noch? Ah, ja, da war noch der Hinweis auf ein Papierfetzelchen. Was hatten die Laborratten herausgefunden? Rüthli las: „Es handelt sich um ein Stück Zigarettenpapier, 3,7 Zentimeter lang, 1,4 Zentimeter breit, das zur türkischen Zigarettenmarke Anadolu gehört. Minimale, nur mikroskopisch nachweisbare Tabakreste. Glimmspuren am linken äußeren Rand lassen darauf schließen, dass die Zigarette angeraucht, dann aber verloren oder weggeworfen wurde.“
Türkisches Zigarettenpapier am Tatort. Zufall? Oder ein Hinweis? Irgendwo in Rüthlis Hinterstübchen zuckte ein ferner Blitz. Da war doch was? Irgendein Gedanke, der mit einem türkischen Zigarettenpapierchen zu tun haben könnte. Das sollte ihn an irgendetwas erinnern, er ahnte, er spürte es. Doch es wollte ihm nicht einfallen. Unwillig schüttelte er den Kopf. Er griff zum Telefonhörer.
3
Aschendorffer schlug die Schwingtür zum Labor auf und marschierte mit vor Aufregung roten Flecken im Gesicht schnurstracks zum Platz von Dr. Frederike Biesthal. Das Laborröhrchen trug er mit ausgestreckter Hand wie eine brennende Kerze vor sich her. Sein offener weißer Kittel wehte ihm um die Kniekehlen. Die zwei Laboranten, die der Professor auf dem Weg zum Arbeitsplatz von Dr. Biesthal passierte, hoben erschrocken die Köpfe. Irgendwo huschte eine von Kaymals Töchtern durch die schmale Reihe zwischen den Labortischen und leerte Papierkörbe. Es war Aygül, die mit dem Leberfleck auf der linken Wange. Aschendorffer registrierte sie nicht. Unterhalb der Ebene seiner Laborleiter kannte er kein Personal. Laboranten waren austauschbare Nichtse. Sonstige Angestellte sowieso. Da gab es nur zwei Ausnahmen: Mona Hohner, von der seine gesamte Arbeits- und Büroorganisation abhängig war, und Hausmeister Meslut Kaymal. Letzterer war Aschendorffers Verbindung zur Realwelt, speziell zur Welt der Baumärkte und Schnellimbisse.
Dr. Frederike Biesthal hingegen gehörte zur ersten Welt, zur Welt der Wissenschaft und der Biogenetik. Das war die Welt, die Aschendorffer akzeptierte und mit der er kommunizierte. Wenn auch von oben herab. Biesthal war in dieser Welt die Stellvertreterin Aschendorffers am Instituts BioGen. In wissenschaftlichen Fragen war sie so ziemlich der einzige Mensch, den Aschendorffer überhaupt halbwegs akzeptierte, eine kühle Analytikerin, hochbegabt und hochsensibel. Seine übrigen Laborleiter, sowohl den Molekularbiologen Dr. Murji Amresh, als auch Dr. Harald Schröder (Onkologie und funktionelle Genetik) sowie Christopher Westphal (vaskuläre Biologie und Entwicklungsbiologie), hielt Aschendorffer für überbezahlte Amateure. Wenn sie mal wieder nach mehrmonatigen Versuchs- und Forschungsreihen über ihren Ergebnissen brüteten, ohne sie zu verstehen, griff er sich die Versuchsprotokolle, las binnen eines Nachmittags alles durch und verkündete dann in lässigem Triumph, welche Arzneimittel, Kosmetika oder Fleckenreiniger sie nunmehr mit den gefundenen Substanzen und Wirkungen marktreif machen konnten, oder wie man aus den herausgefilterten Genen glänzendere Tomaten, knackigere Gurken oder lausfreie Brokkoli züchten könne.
Nur Dr. Frederike Biesthal konnte mithalten. Manchmal jedenfalls. Als Wissenschaftlerin akzeptierte Aschendorffer die kühle und distanzierte Kollegin, als Frau vergötterte er sie geradezu. Allerdings wäre er niemals in der Lage gewesen, dies zu zeigen. Zu sehr fürchtete er sich vor ihrem schneidenden, schwertscharfen Frauenwesen. Wenn sie ihr klar konturiertes Kinn anhob, die Mundwinkel spöttisch herabzog und mit den Nasenflügeln zitterte, dann schlugen die Seismographen in der Erdbebenwarte von München aus. Wehe wenn sie lächelte. Ihre Opfer sahen sich einem scharfen Sägeblatt gegenüber. Und erst ihre kobaltblauen Augen. Ihre Blicke obduzierten ihre Gegenüber. Sie war äußerlich kalt wie Permafrost, unnahbar bis zur Arroganz und allergisch gegen auch nur die leiseste Anmache. Selbst der Inder Dr. Amresh, ein manchmal bis zur Naivität liebenswerter Frauenversteher, von Aschendorffer aufs Verächtlichste geringgeschätzt, durfte nicht einmal ungefragt einen Tee auftragen, wollte er nicht angezischt werden: „Was soll das Eingeschleime?“ Biesthals äußeren Attribute gaben keinerlei Hinweis darauf, wie sie so geworden sein könnte. Sie sah perfekt aus, wenn auch mit androgynem Einschlag, und sie besaß einen Hintern nach dem Geschmack von Meslut Kaymal. „Isse Bombe!“, pflegte er zu sagen. „Sexebombe!“ Aber auch Kaymal senkte den Blick, wenn Dr. Biesthal vorüberschritt, und ihren Planetenabwehrschutzschild um sich herum aufgebaut hatte.
Aschendorffer war platonisch in diese Frau verliebt, so wie man einst in Sophia Loren verliebt war. Bei Aschendorffer war diese Verliebtheit obendrein hoffnungslos, verklärt und feige. Feige, weil er es niemals gewagt hätte, seine Verehrung zu zeigen. Verklärt, weil alles heilig war, was außerhalb der Wissenschaft zwischen ihm und ihr geschah. Zum Beispiel, wenn sie ihn einmal am Arm berührte. Oder wenn er wegen eines nur schlampig geknöpften Laborkittels einen kurzen Blick auf Streifen ihres Oberschenkels erhaschte. Oder wenn sie die Arme hob, um ihr Haar zu knoten, und dabei ihre sauber rasierten Achselhöhlen präsentierte. Das waren heilige Momente, von denen Aschendorffer in all seinen Träumen zehrte. Was er hingegen niemals gewagt hätte, das war, sich Sex mit ihr vorzustellen. Insofern war seine Liebe platonisch. Für Sexfantasien hatte er Fräulein Mona; die war handfest, weltlich, real. Frederike Biesthal war überirdisch.
Wenn Aschendorffer ein privates Wort mit Frederike Biesthal wechseln sollte, was sich manchmal nicht verhindern ließ, so geriet er ins Stottern und schwitzte Bäche aus. Dann verknotete er die Hände unterhalb der Gürtelschnalle und fühlte sich bloßgelegt wie unter einem Kernspintomografen. Wenn das Gespräch hingegen dienstliche, wissenschaftliche Inhalte hatte, dann war er, wie bei ausnahmslos allen Gesprächspartnern, auch gegenüber Dr. Biesthal überheblich, schnoddrig, ungeduldig und um Längen überlegen.
Das Gespräch, das nun anstand, als er mit wehenden Kittelschößen und vorgestrecktem Laborröhrchen auf seine Stellvertreterin zustürmte, die hinter einem Specularmikroskop saß und sich Notizen über ihre Beobachtungen machte, war ein rein wissenschaftliches. Deshalb stotterte Aschendorffer auch kein bisschen.
„Frau Kollegin, Sie werden es nicht glauben ...“
Biesthal sah auf. Sie zog eine ihrer akkurat gezupften hellen Augenbrauen leicht nach oben. Die einzige sichtbare Gefühlsregung.
„Ich habe die Untersuchungsergebnisse für den Corpus aus dem Eis.“
„Den Sie gestohlen haben“, ergänzte Biesthal nüchtern.
„Den ich geborgen habe,“ korrigierte Aschendorffer. Er hielt Biesthal das Röhrchen unter die Nase. Sie ließ sich zu einer Regung auch der anderen Augenbraue herab: „Soll ich davon kosten?“
„Entschuldigen Sie.“ Er zog das Röhrchen wieder zurück. „Es war diese Gewebeprobe, die ich an der Hand des Leichnams genommen habe. Wollen Sie wissen, wie alt der Leichnam ist?“
„Sie werden es mir gleich sagen!“
„Erst habe ich vermutet, es handelt sich vielleicht um einen vermissten Bergsteiger, maximal um einen Soldaten aus dem letzten Weltkrieg. Aber es ist viel fantastischer.“
Aschendorffer sah sich verschwörerisch um. Als er sicher war, dass niemand mithören konnte, flüsterte er: „Fünfeinhalbtausend Jahre!“
Biesthal sah ihn verdutzt an. Jetzt zeigte ihr Gesicht doch ein gewisses Staunen. Ihr ungläubiger Blick richtete sich auf das Röhrchen, das der Professor immer noch umklammert hielt wie der Exorzist sein Kruzifix.
„Fünfeinhalb ...?“
Aschendorffer nickte eifrig. „Mehrfach überprüft! Ich habe Zellen und Knochengewebe.“
„Das ist unmöglich!“
„Wieso soll das unmöglich sein. Ötzi war genauso alt.“
„Mit dieser Probe haben Sie das herausgefunden?“ Sie deutete zweifelnd mit ihrem schlanken, feingliedrigen Zeigefinger auf das Röhrchen. Aschendorffer war wie immer fasziniert. Der Finger einer Göttin. Sie zog ihn, als sie den besoffenen Blick des Professors bemerkte, wieder zurück und verbarg die ganze Hand in der Seitentasche ihres Laborkittels. Sie besaß sehr wohl eine Ahnung davon, dass Aschendorffer sie vergötterte. Es war ihr lästig. Der Professor war schließlich kein richtiger Mann. Jedenfalls rein äußerlich nicht. Da gefiel ihr Dr. Amresh schon besser. Aber das hätte sie nie zugegeben.
„So ist es!“, bestätigte Aschendorffer.
Frederike Biesthal zweifelte keine Sekunde daran. Sie war es gewohnt, dass Professor Aschendorffer Recht hatte. Seine wissenschaftlichen Fähigkeiten waren atemberaubend, seine Methoden verblüffend, seine Ergebnisse revolutionär. Bei jedem anderen hätte sie Zweifel formuliert und darauf bestanden, dass er seine Untersuchungsmethode transparent machte. Bei Aschendorffer war das nicht nötig. Er war ein Genie und der Schulbuchwissenschaft um Lichtjahre voraus. Wenn er ansonsten auch ein vollkommener Idiot war, als Wissenschaftler musste man ihn bewundern.
„Ein zweiter Ötzi also?“
Aschendorffer nickte eifrig.
„Das macht den Fall nicht einfacher?“
„Wie? Wie meinen Sie?“
War er wirklich so weltfremd, sah er die Schwierigkeiten nicht voraus? „Sie haben diesen Leichnam gestohlen und illegal über die Grenze transportiert. Sie haben ihn heimlich in unser Institut gebracht und unten im Keller in die Tiefkühlkammer gelegt! Es ist Ihnen doch hoffentlich bewusst, dass man Sie dafür vor Gericht bringen kann. Wie wollen Sie auf dieser Basis wissenschaftliche Ergebnisse veröffentlichen?
„Wer sagt denn, dass ich irgendwelche Ergebnisse veröffentlichen will? Außerdem: Wem gehört eine Leiche, die 5500 Jahre im Eis gelegen hat? Die gehört niemandem. Höchstens dem, der sie findet.“
„Sie haben sie ja nicht einmal selbst gefunden.“
„Mona hat sie gefunden. Damit habe ich einen Anspruch!“
„Oh, je!“ Frederike Biesthal seufzte. Mit solch weltlichen Fragen durfte man Aschendorffer nicht kommen. Das ließ ihn unberührt. Sie sah es seinem entzückten Gesicht an. Es war das eines begeisterten Jungen, dem man endlich sein Wunschspielzeug geschenkt hatte.
„Was haben Sie nun vor?“
Aschendorffer lächelte selig. Biesthal wartete auf eine Antwort.
„Was wollen Sie nun tun?“, wiederholte sie. „Diesen Leichnam wieder zurückgeben?“
„Wo denken sie hin!“ Empört plusterte Aschendorffer seine Hühnerbrust auf. „Dieser Leichnam ist ein Geschenk an die Wissenschaft. Ich werde das einzig Wahre tun, was man mit solch einem Zeugen der Vergangenheit tun kann.“
Frederike Biesthal erwartete, dass Aschendorffer nun aufzählen würde, wie er Haut, Knochen, Mageninhalt, Haare, Kleidung und sonstiges Zubehör des Gletschermannes nach und nach aus dem Eis lösen und Stück für Stück untersuchen würde. „Sie tauen ihn auf“, schlug sie deshalb vor.
„Viel besser, viel besser!“, triumphierte Aschendorffer. Er hob das Laborröhrchen empor wie die olympische Fackel: „Auftauen? Das kann jeder.“ Er grinste diabolisch: „Ich werde ihn wieder zum Leben erwecken!“
*
Sie fuhren mit dem Aufzug nach unten ins zweite Kellergeschoss. Das geheime Herz von BioGen befand sich dort, eine dreifach gesicherte unterirdische Zone, zu der nur ausgesuchte Personen Zugang hatten. Neben Aschendorffer und Biesthal waren dies lediglich Amresh, Schröder und Westphal, Institutsleiter Föllstiegel, der aber ohne Not niemals diese Katakomben betreten würde, sowie Meslut Kaymal, der Generalschlüsselverwahrer, und seine sieben Töchter, die BioGen-Putzkolonne.
Im Aufzug sprachen sie nicht miteinander. Frederike Biesthal schaute streng, fast tadelnd. Sie verdaute noch Aschendorffers Ankündigung. Für ihn war die körperliche Nähe im Aufzug eine köstliche Qual, weshalb er weder denken, noch Biesthals Gesichtsausdruck interpretieren konnte. Er drückte sich in die hinterste Ecke. Biesthal kannte Aschendorffers Nöte. Sie hatte ihn durchschaut. Wieso sollte er anders sein, als andere Männer? Alle wollten sie den Frauen an den Rock. Nur in den Methoden unterschieden sie sich. Murji Amresh hielt sich für besonders schlau, weil er sich benahm, als sei er überhaupt kein Mann. Ihm immerhin erlaubte Frederike Biesthal eine gewisse Nähe, weil sie sich in seiner Gegenwart nie ernsthaft belästigt fühlte. Der steife Dr. Schröder spielte den Überkorrekten. Der selbstverliebte Dr. Westphal stolzierte wie ein Gockel und lebte in dem Irrglauben, wenn sich nur seine Hose beulte, würden die Frauen schon von alleine in Ohnmacht fallen. Und Aschendorffer gab den Trottel. Diese Masche war bei vielen Frauen zwar erfolgversprechend, bei Frederike Biesthal aber zog sie nicht. Sie wusste genau, was in seinem erigierten Männerhirn vor sich ging. Widerlich! Sie lächelte kalt, während der Aufzug sie nach unten trug. Der richtige Mann für sie war noch nicht geboren.
Es war nicht so, dass Frederike Biesthal keine Affären hatte. Durchaus gehörten Männerbekanntschaften zu ihren Freizeitbeschäftigungen. Mit Wissenschaftlern ließ sie sich allerdings aus Prinzip nicht ein. Dagegen liebte sie es, verheiratete Industriebosse, Manager, Banker oder Politiker anzukirren und geraume Zeit in ihr Bett zu lassen. Diese Kerle wurde man danach am schnellsten wieder los. Außerdem genoss sie es, vermeintlich starke und unbesiegbare Reiche und Mächtige zu besitzen und so lange mit emotionaler Kälte und körperlicher Raffinesse zu quälen, bis sie wahlweise in die Raserei oder Verzweiflung stürzten. In Wahrheit war sie eine verletztliche, empfindsame, von vielen Zweifeln und Ängsten verfolgte Frau, die gelernt hatte, ihre Empfindsamkeit hinter einer metallischen Schale aus Arroganz, Härte und Abweisung zu verbergen. Der perfekte Mann für sie musste sanft, verständnisvoll, schöngeistig und klug wie Dr. Murji Amresh sein, aber idealerweise auch männlich, stark und selbstbewusst, ohne sich aufzuspielen wie ein Pavian. Dieser Kombination war sie bisher noch nicht begegnet.
Aschendorffer war außerhalb jeglicher Erwägungen. Ein Hanswurst von Mann, völlig indiskutabel. Das erleichterte es gleichzeitig, ihn als Wissenschaftler hoch zu schätzen, um nicht zu sagen, zu verehren. Frederike Biesthal gestand es sich nicht gerne ein, aber mit seinem genialischen Wissen und Können stand Aschendorffer weltweit über allen Fachkollegen. Sie schenkte ihm einen sezierenden Blick. Wie er es wohl anstellen mochte, einer über fünftausend Jahre tiefgefrorenen Leiche wieder Leben einzuhauchen? „Haben Sie schon eine Idee, wie Sie das bewerkstelligen wollen?“, fragte sie, als der Aufzug mit sanftem Wippen den Kellergrund erreichte. Aschendorffer schrak zusammen. „Haben Sie schon eine Idee, wie Sie Ihre gestohlene Leiche wieder zum Leben erwecken wollen?“
„Sie ist gerettet, nicht gestohlen“, tadelte er. „Das ist ein Kinderspiel. Ich erkläre es Ihnen, wenn wir im Kühlraum sind.“
Hinter der Aufzugstür erwartete sie eine doppelwandige Stahltür. Ein Licht in der Mitte über der Tür leuchtete grün. Das verriet, dass sich Menschen im Inneren des Schutzbereichs aufhielten. Vermutlich eine oder mehrere der Kaymal-Töchter. Sie putzten regelmäßig die Räume und waren auch für die Fütterung der Labortiere zuständig. Aschendorffer schloss auf, Biesthal trat hinter ihm ein. Nun querten sie einen kleinen Vorraum, von dem eine Sicherheitsschleuse in die eigentlichen Forschungsräume führte. Aschendorffer presste seinen Zeigefinger auf eine fluoreszierende Leuchtfläche und bot gleichzeitig sein Auge einer kleinen Kamera dar, die geschäftig zu surren begann. Aus den Innereien der High-Tec-Tür erklang mit höflicher Computerstimme die Aufforderung: „Geben Sie eine Tonprobe.“