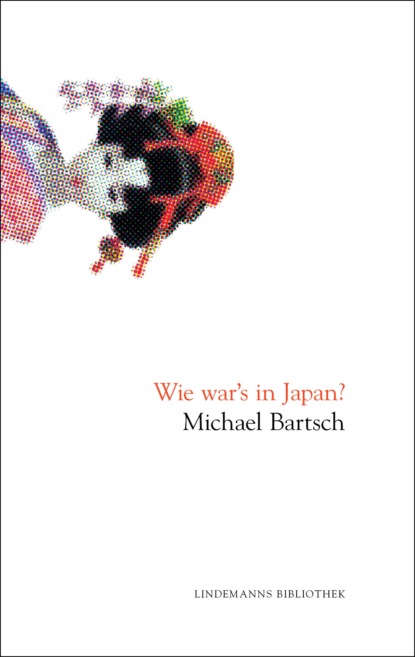Das Erwachen der Gletscherleiche
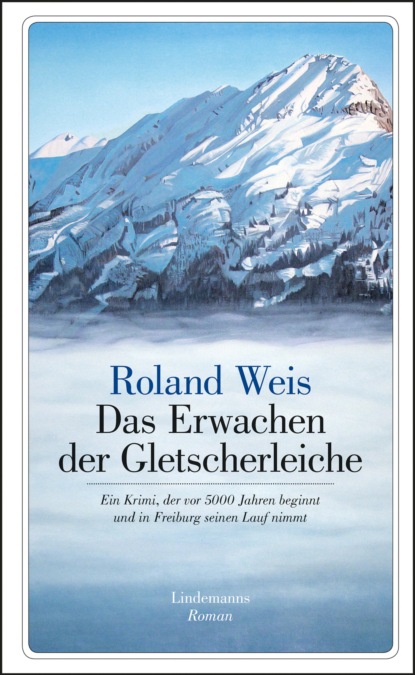
- -
- 100%
- +
Aschendorffer sagte ungeduldig: „Aschendorffer“.
Die Schiebetüren der Schleuse glitten zur Seite und versanken links und rechts in den dicken Schallschutzwänden. Aschendorffer hatte das Sicherheitssystem selbst konstruiert. Eine kleine Bastelarbeit nebenbei. Nur bei der korrekten Kombination von Fingerabdruck, Auge und Stimme gewährte die Schleuse Einlass.
Die Lichter gingen an. Sie befanden sich nun in einer Art Wasch- und Umkleideraum. Beide Wissenschaftler schlüpften in Sicherheitsanzüge, die sie sich über ihre Arbeitsgarderobe streiften. Kameras an der Decke zeichneten jede ihrer Bewegungen auf. Zur Pflichtausrüstung gehörten Gesichtsmasken, Sauerstoffmasken, die seitlich an den Gürteln baumelten, Handschuhe und für jeden der beiden Biogenetiker eine Art Fernbedienung, ein Gerät, mit dem sie sämtliche technischen Apparaturen in der Forschungszentrale in Gang setzen, steuern und auch wieder abschalten konnten. Ebenfalls ein kleines Ingenieurspielzeug, das Aschendorffer konstruiert hatte.
Aschendorffer sortierte mit fiebrig glänzenden Augen auf einem kleinen Edelstahlwägelchen, das er vor sich herschob, eine Reihe von Instrumenten und chromglänzendes Operationsbesteck. Frederike Biesthal folgte ihm durch einen langen Gang, der nach einer Seite hin offen war und den Blick in verschiedene Zellen freigab. Alles stand unter grellem, künstlichem Licht. Zwei der Kaymal-Töchter eilten mit ihren Putzutensilien vorbei.
In jeder der Laborzellen, keine größer als eine Doppelgarage, befanden sich verschiedene Versuchsanordnungen, köchelnde Glaskolben, rauchende Phiolen, vor sich hin gärende Säuren, Laugen und Lösungen, stinkende Sude, wohlriechende Essenzen, unter ultraviolettem Licht wuchernde Kletterpflanzen, rätselhafte Keimlinge, Pilzkulturen in den schillerndsten Farben, Moose, Algenkolonien, Kakteenlandschaften und die Vereinten Nationen aller Bakterienvölker. Sie erreichten eine Abteilung mit verkabelten, operierten, in Foltermaschinen eingespannten, missgebildeten, fehlgezüchteten und exotisch mutierten Kleinsäugetieren, Mäuse, Ratten, Hamster, Katzen, Zwergaffen und solche Vierbeiner, bei denen es schwer war, zu bestimmen, was sie einst einmal gewesen sein mochten. Aschendorffers Reich.
Der Professor deutete auf einen Käfig, in dem ein mit Elektroden gespicktes Kätzchen an einem Gestell fixiert war, auf dem unablässig Leuchtdioden oszillierten. Nebenan spuckte ein Drucker Endlosschleifen von Papier aus. „Da sehen Sie, ich weiß jetzt, wie ich es anstellen muss, damit die Katze und die Ratte miteinander kommunizieren können.“ Er deutete auf einen Kabelstrang, der aus dem Katzenkäfig hinaus in einen Computer führte, und von dort wieder austrat und jenseits im Rattenkäfig an eine ähnlich fixierte Ratte angeschlossen war. Auf dem Computerbildschirm sprangen Binärzahlen aus dem Off und bildeten lange, stetig wachsende Zahlenreihen, die solide blinkten. „Der Computer ist der Simultanübersetzer für beide Arten!“
Frederike Biesthal blieb stehen und betrachtete die Versuchsanordnung. Sie wusste von Aschendorffers skurrilen Experimenten. Es gab nichts, wofür er sich nicht interessierte. Aber ganz besonders hatten es ihm Lebewesen angetan. Zellmanipulationen, Genveränderungen, Bewusstseinssteuerung, Hirnforschung, neurologische Manipulationen, Aschendorffer probierte alles aus und verblüffte immer wieder mit bahnbrechenden Ergebnissen. Leider musste aufgrund der „kurzsichtigen, restriktiven Gesetzeslage“, wie er sich depektierlich auszudrücken pflegte, vieles in den Tresoren bleiben, weil sonst BioGen binnen kürzester Zeit von der Kriminalpolizei auf den Kopf gestellt und dicht gemacht werden würde.
„Wollen Sie etwa sagen, sie haben Katze und Ratte beigebracht, miteinander zu sprechen?“, fragte Biesthal, und ihre Stimme klang unter dem Mundschutz noch rauchiger als sonst.
„Miteinander zu denken, das würde es besser treffen“, präzisierte Aschendorffer. Er sprach, als ginge es um das Selbstverständlichste der Welt.
„Aber woher wissen Sie ...?“
„Was sie denken?“
„Ja, und dass sie sich überhaupt verstehen?“
Jetzt war Aschendorffer in seinem Element. „Ich beteilige mich selbstverständlich am Gespräch. Sehen Sie dort.“ Er zeigte auf eine gläserne Kabine, offenbar eine ehemalige Telefonzelle, umgebaut für Aschendorffers zweifelhafte Zwecke, in der ein Schalensitz montiert war, zu dem zahlreiche Drähte, Elektroden, Klemmen, Kopfhörer und sonstige Installationen führten. „Ich setze mich dort hinein, schließe mich an und höre mit. Besser gesagt, ich denke mit. Sie verstehen mich und ich verstehe sie. Ich nenne das Verfahren interspeziale bilinguale Transmission.“
Biesthal verzog ungläubig den Mund zu einem säuerlichen Lächeln. „Ist nicht Ihr Ernst?“ Aber sie wusste schon, als sie die Frage stellte, dass es selbstverständlich Ernst war. Aschendorffer machte niemals Scherze.
„Was reden ... äh, denken die ... die beiden Tiere so?“, fragte sie gezwungen.
„Sie denken Angst. Für mich finden sie keine Erklärung, ich mache ihnen Angst, wenn ich mit ihnen denke. Für sich selbst denken sie ans Fressen. Vorzugsweise. Die Katze denkt an ihre Mutter. Seltsam, nicht? Das hätte man nicht vermutet.“
Biesthal schüttelte sich. Sie war hart gesotten. In der Umgebung Aschendorffers sowieso. Aber hier wollte sie fürs Erste nicht mehr erfahren.
„Und wo ist denn nun Ihr Ötzi?“, lenkte sie ab.
Aschendorffer zog sie zur streng verriegelten Tür, die in die Kühlkammer führte. Während der Professor mit verschlüsselten Geheimcodes die Verriegelung löste, erklärte er: „Ich habe ihn noch nicht angerührt, er ist noch den vollkommen identischen Verhältnissen ausgesetzt, wie in den letzten 5500 Jahren im Eis.“
„Ah, verstehe!“
Sie betraten den Kühlraum. Der Gletschermann lag aufgebahrt auf einem in die Wand eingelassenen Podest, eingebacken in seinen kantigen Eiskäfig. Das war es aber nicht, was Aschendorffer und Biesthal nahezu synchron erschrocken zurückweichen ließ. Es war vielmehr der bis unter die Decke reichende Stapel gefrorener Brathähnchen, der eine ganze Seitenfront des Kühlraumes einnahm. Ein Brathähnchenklotz kullerte mit vernehmlichem Poltern vor ihre Füße.
„Was ist das?“ Frederike Biesthal konnte sich einen spöttischen Unterton nicht verkneifen. „Gehören die auch zum Fund?“
Aschendorffer stürzte zum Haustelefon, das draußen im Gang in die Wand eingelassen war.
„Kaymal, Sie Hornochse! Kommen Sie sofort runter in den Kühlraum“, hörte Biesthal ihren Chef brüllen. Wenig später stürmte Meslut Kaymal herein. Er hatte keine Minute gebraucht, wo auch immer im Gebäude er zuvor gewesen war. Als er die geöffnete Tür des Kühlraumes sah und die beiden Wissenschaftler zwischen den gefrorenen Hähnchen, legte sich sofort eine Maske der Zerknirschung auf sein Gesicht. „Oh jeh, oh jeh“, jammerte er.
„Was ist das?“, fragte Aschendorffer streng.
Kaymal schob die Unterlippe vor: „Isse Bratenhähnche.“
„Das sehe ich selber. Wo kommen sie her? Wem gehören sie? Wer hat sie hierher gebracht?“
Kaymal murmelte undeutlich ein Geständnis: „Habe ich gemacht. Wo solle hin die viele Bratehähnche aus Lieferwage? Müsse kalt bleibe.“ Er hob schuldbewusst die Schultern: „Isse Vorratslager. Kann jeden Tag eine Bratehähnche auftauen und Futter machen für die Ratten.“
Biesthal schaute irritiert, weil sie die Zusammenhänge nicht kannte.
„Und das übrige Zeugs? Die Gemüseschachteln? Die Fischstäbchen?“, fragte Aschendorffer.
„Musse nix Sorge mache“, beschwichtigte Kaymal. „Habe ich Bruder wo mache Kauflade in Stühlinger. Echt türkisch Spezialitäte.“
„Ich kenne einen türkischen Lebensmittelladen im Stadtteil Stühlinger“, entfuhr es Frederike Biesthal. „Ist das nicht an der Ecke zur Eschholzstraße?“
Kaymal grinste: „Isse meine Bruder.“
Aschendorffer schenkte ihm einen zweifelnden Blick. Das mit Kaymals Brüdern war so eine Sache. Er hatte für jeden Bedarf einen Bruder, man musste aufpassen.
„Was ist an Fischstäbchen eine türkische Spezialität?“, fragte Aschendorffer spitz.
„Musse du auftaue Fischestabe un ganz kleine Stücke mache. Isse dann Spezialitäte aus dem Mittelmeer. Verstehsch du?“
„Das Zeug muss trotzdem hier raus. Haben Sie keinen Bruder, der einen Brathähnchengrill betreibt?“
Kaymal überlegte kurz, dann wanderte ein Strahlen über sein Gesicht. „Doch! Da fallt mir einer ein. Morge vielleicht. Oder nächste Woche.“
„Hauptsache Sie schaffen das Zeug weg. Ich brauche den Platz. Und jetzt verschwinden Sie! Gehen Sie die Katzen füttern!“
Aschendorffer kickte einen Brathähncheneisklotz zur Seite und näherte sich auf Armlänge dem Gletschermann. Er schaute auffordernd zu Frederike Biesthal, die immer noch nicht verdaut hatte, dass ihr türkisches Spezialitätengeschäft im Stühlinger umdeklarierte Tiefkühlkost als anatolische Spezialität verkaufte. „Schauen Sie ihn sich an: ein Prachtexemplar, vollkommen erhalten.“
„Ich kann nicht viel erkennen“, mäkelte Biesthal, die jetzt ganz nahe an den Eisklotz herangetreten war. „Ja, die Hand kann man sehen, und dahinter einen Schatten im Eis. Ist das ein Fell? Vielleicht ist es ein Tier?“
„Unsinn!“, berichtigte Aschendorffer. „Das ist ein Mann in einem Fellumhang. Sehen sie hier, die Schultern. Hier, diese Form, das ist der Kopf. Ebenfalls mit einem Fellüberhang.“ Aschendorffer deutete mit einem Metallstab auf die Stelle im Eis, wo er den Kopf vermutete. „Und hier“, er ließ den Zeigestab bis ans andere Ende des Eisklotzes wandern, „das sind die Füße. Sie stecken in Fellschuhen.“
Frederike Biesthal bestaunte stumm das Exponat. Aschendorffers Kühlkammer barg eine wissenschaftliche Sensation. Daran bestand kein Zweifel.
„Und wie wollen Sie ihn ... äh ... zum Leben erwecken?“
Aschendorffer hob eine geöffnete Hand vor sich hoch wie ein Wanderprediger, der zum Segen ausholt: „Was glauben Sie, Frau Kollegin?“
Frau Kollegin! Das sagte er nur in Ausnahmefällen. Eigentlich immer nur dann, wenn er sich sicher war, dass er gleich einen unglaublichen wissenschaftlichen Triumph kundtun würde. Frederike Biesthal kannte diese Momente. Sie waren beängstigend. Und gleichzeitig magisch.
„Ich nehme an, Sie wollen ihn klonen? Oder rechnen Sie damit, dass sie zeugungsfähiges Sperma finden, wenn Sie ihn auftauen?“
Er ruckte überrascht mit dem Kopf: „Oh, an diese Möglichkeit habe ich gar nicht gedacht.“ Er zögerte kurz, als überlegte er. „Aber nein, das würde dauern bis wir einen Fötus hätten und dann einen Menschen, der erst noch erwachsen werden müsste.“ Er rieb sich über die Nase, als dächte er weiter darüber nach: „Und die Leihmutter?“ Sein Blick wanderte abschätzend an Frederike Biesthal hinunter bis zu ihren Zehenspitzen und wieder hinauf bis ans Kinn. Zog er sie etwa in Erwägung? Er streichelte zärtlich über den Eisblock: „Wäre nur eine halbe Sache. Wir hätten dann nicht diesen Steinzeitmenschen zum Leben erweckt, sondern lediglich eine genetische Kopie oder einen Nachfahren von ihm geschaffen. Völlig unbefriedigend. Das kann jeder.“
Frederike Biesthal, die sehr wohl den taxierenden Blick Aschendorffers bemerkt hatte und sich überlegte, ob sie dafür die Ohrfeige noch nachreichen sollte, sagte spitz: „Eine Leihmutter würden Sie ja wohl auch schwerlich finden, so wie Sie mit Frauen umspringen.“
Aschendorffer überhörte es. Später, wenn er alleine war, in seinen Träumen, würde er sich schmerzlich an diese spitze Bemerkung erinnern. Er verkündete in beiläufigem Ton: „Ich werde ihn auftauen und reanimieren.“ Zur Bekräftigung klopfte er mit der flachen Hand auf den Eisklotz.
Frederike Biesthal räusperte sich vorsichtig: „Wie?“
„Ich habe eine Nährlösung vorbereitet. Der Eisklotz kommt in eine Wanne und wird langsam aufgetaut, indem wir die Temperatur in der Wanne um etwa ein Grad pro Tag steigen lassen. In dem Maße, in dem das Eis zu Wasser wird, wird diesem Wasser die genau vorberechnete Dosis dieser Nährlösung zugeführt. Ich erläutere ihnen gleich, aus was sie besteht. Es ist bestechend einfach. Am Ende wird nach einigen Tagen der Leichnam komplett in seinem eigenen Schmelzwasser liegen. Das ist wichtig, weil wir wegen der möglichen Krankheitskeime und sonstigen Unwägbarkeiten kein Wasser aus der Gegenwart für die Herstellung der Nährlösung verwenden dürfen. Diese Nährlösung wird unseren Eismann nach spätestens 72 Stunden reanimieren. In der letzten Phase brauchen wir Elektroschocks. Zuerst werden die Organe wieder arbeiten, das Blut wird wieder zirkulieren, das Gehirn schaltet sich ein. Sobald die Lunge 20 Prozent ihrer früheren Funktionsfähigkeit erreicht, müssen wir zunächst künstliche Beatmung einsetzen. Das wird nur vorübergehend sein, denn das weitere Setup geschieht ziemlich schnell und der Mensch wird bald in der Lage sein, selbstständig zu atmen.“
Aschendorffer erzählte in fiebrigen, hastigen Sätzen. Der Professor erläuterte die chemische Zusammensetzung seiner Nährlösung. „Unlängst habe ich Labormäuse lebendig in eiskaltes Wasser getaucht und binnen weniger Minuten tiefgefroren. Sie hatten keinerlei Körperfunktionen mehr. Am nächsten Tag habe ich sie aus dem gefrorenen Eis wieder ins Leben zurück geholt. Mit meiner Nährlösung.“
Biesthal kniff skeptisch die Augen zusammen. Sie hatte dem wunderlichen Experiment beigewohnt und konnte sich bis heute nicht erklären, wie Aschendorffer es angestellt hatte. „Aber das waren Mäuse. Und es handelte sich nur um einen Tag, an dem sie ... nicht ... geläh... also irgendwie scheintot waren.“
„Sie waren tot!“, behauptete Aschendorffer spitz. Und das wissen Sie genau.“ Seine Stimme bekam einen herrischen, harschen Tonfall: „Sie haben das intellektuell nur noch nicht verarbeitet.“
„Ihre Arroganz ist unerträglich! Sie setzen die Gesetze der Natur nicht außer Kraft.“
Aschendorffer lachte theatralisch. „Die Gesetze der Natur sind dazu da, dass man sie nutzt. Es tut mir leid, wenn Sie bisweilen nicht folgen können.“
„Halten Sie sich zurück“, zischte Biesthal. Ihr Gesicht war rot geworden, eine Mischung aus Wut und Demütigung. Sie wusste, dass Aschendorffer Recht hatte. Das war das Hauptproblem, nicht Aschendorffers überheblicher Ton. Dieser Wahnsinnige hatte einfach mehr von den Zusammenhängen von Physik, Chemie, Biologie und Neurologie verinnerlicht, als jeder andere Mensch dieser Welt. Und er besaß keinerlei Skrupel, all sein Wissen und all seine Erkenntnis anzuwenden. Frederike Biesthal fand das ebenso abstoßend wie anziehend. Als Wissenschaftlerin faszinierten sie Aschendorffers Experimente. Als Mensch verabscheute sie sie.
„Sie wollen ein Mäuseexperiment an einem Menschen wiederholen“, versuchte sie eine zaghafte Intervention.
„Nur, dass dieser Mensch bereits tot ist. Wenn ich nichts unternehme, dann bleibt er tot. Er kann also nur gewinnen!“ Aschendorffers Logik war bestechend.
Er überlegte kurz und wälzte dabei die Zunge, so dass sich seine Lippen mahlend bewegten. Er musste abwägen, ob er Frederike Biesthal in sein Geheimnis einweihen sollte. Jetzt war er ohnehin schon so weit gegangen, da konnte er auch diesen letzten Schritt noch tun. Schließlich würde er Biesthals Hilfe brauchen, wenn er den Gletschermann in die Gegenwart holte. Biesthal würde still halten. Und mitmachen. Dazu reizte sie das ungeheuerliche wissenschaftliche Neuland viel zu sehr, welches sie mit seiner Hilfe betreten würde.
„Es gibt nicht nur das Mäuseexperiment!“, sagte Aschendorffer leise.
Frederikes Gesichtsfarbe wechselte von rot zu bleich.
„Ich habe es schon mit einem Menschen ausprobiert!“
„Das glaube ich nicht!“
„Fragen Sie Kaymal.“
Biesthal zuckte zusammen.
„Kaymal? ... Sie wollen doch nicht etwa behaupten...? Sie haben Kaymal ...?“
„Nein, nein!“, wehrte Aschendorffer ab. „Nicht Kaymal. Einen seiner Brüder.“
Aschendorffer hatte schon vor einigen Monaten einen Freiwilligen gesucht, um ihn unter Versuchsbedingungen tiefzufrieren und nach 48 Stunden wieder ins Leben zurückzuholen. Bei einem Angebot von 10.000 Euro hatte sich dieser Freiwillige schließlich unter Kaymals nie versiegender Auswahl von Brüdern gefunden.
Aschendorffer führte Biesthal in einen kleinen Technikraum, den er vollgestopft hatte mit Rechnern, Monitoren, Apparaturen aller Art, und führte ihr dort den Film vor, der das Experiment dokumentierte. Frederike Biesthal sah am Ende des Filmes einen nackten Türken dem leicht anrüchig aussehenden Sud entsteigen, der sich in der verkabelten und mit Drainageschläuchen aller Art verbundenen Edelstahlwanne angesammelt und als Nährlösung für die Versuchsperson gedient hatte. Der frisch Wiederauferstandene wurde im Video von einem strahlenden Aschendorffer gewogen, vermessen, abgehört und mit dem institutseigenen Computertomografen durchleuchtet. Er war quicklebendig und bester Dinge. Aschendorffer und das menschliche Versuchskaninchen gaben sich am Ende des Filmes die Hand und grinsten beide in die Kamera, die Kaymal geführt hatte.
„Was sagen sie jetzt?“
„Ich bin sprachlos.“
4
Bowolf wachte vom schrillen Gekreische der Weiber auf. In der gleichen Sekunde war er auch schon hellwach, warf das Fell von sich und sprang von seinem Lager auf. Binnen eines Lidschlags fand er die Orientierung. Das Dorf war in heller Aufregung. Die Hunde kläfften. „Rätiser, Rätiser!“, schrieen die Frauen, und ihre Stimmen waren voller Angst. Die Rätiser also, die Feinde. Ein Überfall. Bowolfs Bewegungen waren sicher und gingen fließend ineinander über. Er griff Bogen und Köcher, die am Mittelpfahl seiner Hütte hingen, schnappte sich die Steinaxt, warf sich den Fellmantel über und stürmte dann mit großen Sätzen wie eine Raubkatze aus der Hütte hinaus in den bitterkalten Winter.
Eine Hütte brannte bereits. Krieger liefen kopflos hin und her. Zwei Männer lagen mit eingeschlagenem Schädel auf dem Dorfplatz. Ihr Blut glänzte rot im frisch gefallenen Schnee. Überall weinende Kinder, heulende Frauen, jemand brüllte Befehle. Die Rätiser verschleppten Frauen aus Bowolfs Dorf. Bowolf überlegte nicht lange. Er war der Häuptling. Er jagte mit gezückter Streitaxt über den Dorfplatz und den leicht abschüssigen Pfad zum Seeufer hinunter. Dort wurde gekämpft. Dort waren die Feinde. Andere Männer liefen neben ihm. Wütend schrieen sie ihre Kampfrufe in die Nacht. Die Feinde antworteten mit Spott und Beschimpfungen.
Bowolf kam zu spät. Er sah es schon von Weitem. Die Feinde saßen bereits auf ihren Pferden, auf die sie ihre weiblichen Gefangenen gezerrt hatten, und galoppierten auf den zugefrorenen See hinaus.
„Hirjeka, hirjeka“, brüllte Bowolf den Kampfruf seines Stammes. Feine Atemwölkchen stiegen auf. Die Luft klirrte vor Kälte. Auf dem Weg zum See lag ein sterbendes Mädchen. Fialla, Stirnmanns zehnjährige Tochter. Die Rätiser hatten ihr die Kehle durchgeschnitten. Fialla gurgelte und spuckte Blut. Ihre Augäpfel quollen hervor, die Pupillen waren vollkommen verschwunden. Mit einem Arm schlug sie zweimal in den Schnee, dann war sie tot.
Panisch blickte Bowolf sich um. Wenn Fialla tot war, wo war dann Seta,Bowolfs jüngste Frau, die in der Hütte von Fialla übernachtet hatte?
Vom Ufer her klang das wütende Gebrüll der Krieger, die hinter den flüchtenden Feinden herliefen. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Zwischen den Kriegsrufen wehten die Klagelaute der Frauen durch die Nacht. Manche hatten sich befreit. Manche hatten ihren Widerstand mit dem Leben gebüßt, so wie Fialla. Das rasende Kläffen von Hunden mischte sich unter die Stimmen. Bowolf hastete zurück zum Dorf, hinüber zu den Pferchen, wo die wenigen Pferde des Stammes zusammengetrieben waren. Dem großen Ahnherrn sei Dank, die Tiere standen noch da und schnaubten kalte Nebel in den Nachthimmel.
Bowolf führte Mor, sein treues Pony, aus dem Gatter und schwang sich auf seinen Rücken. „Hirjeka“, rief er dem Mond zu, dann trieb er sein zähes Reittier zum See hinunter. Dem Feind hinterher. Am Ufer riefen ihm die Zurückgebliebenen zu: „Bowolf reite! Es sind zweimal zwei Hände. Stinkende Rätiser. Feige Rätiser.“
„Wieviel Gefangene?“, schrie Bowolf im Vorbeiritt und nahm die Antwort mit: „Eine Hand und zwei. Seta ist auch dabei!“
Der zugefrorene See trug Menschen und Tiere. Bowolf galoppierte. Bald überholte er die kleine Gruppe seiner Stammesgenossen, die zu Fuß hinter dem flüchtenden Feind her waren. Einer rief ihm zu: „Gangam ist ihr Anführer!“
Gangam also. Sein alter Feind. Er trieb das Pferd. Das Eis knirschte unter den Hufen. Immer wieder Gangam. Wie oft schon hatten sich ihrer beider Wege gekreuzt. Der Häuptling der Rätiser, die auf der anderen Seite des gelben Berges lebten, und er, Bowolf, der Häuptling der Mooka, die auf dieser Seite des Berges ihr Dorf und Jagdrevier hatten, sie waren Feinde auf Lebenszeit. Einmal überfielen die Mooka die Rätiser, dann wieder die Rätiser die Mooka. Sie stahlen sich wechselweise Vieh und Frauen und zündeten sich gegenseitig die Hütten an. Diese uralte Feindschaft hatte längst vergessene Ursachen und längst vergessene Täter und Opfer. Das alles lag in ferner Vergangenheit. Aber Krieg herrschte immer. Bis heute.
Normalerweise fanden die Überfälle nur im Sommer und frühen Herbst statt, wenn die Pässe schnee- und eisfrei und die schnelle Rückkehr ins eigene Jagdgebiet gewährleistet war. Waren die Rätiser im Herbst gar nicht auf ihre Seite des Berges zurückgekehrt? Hatten sie die ganze Zeit am See gelauert? Der See war groß. Er bot entlang seiner Ufer viele Verstecke. Es lebten nicht viele Menschen hier. Bowolfs Dorf war die größte Ansiedlung. Daneben gab es noch ein paar Familiensippen, die alleine lebten und zu keinem Stamm gehörten. Sie wohnten alle weit verstreut. Man brauchte mehr als einen Tag, um im Sommer zu Pferde den See einmal zu umrunden. Er war länglich wie ein Schlauch, oft versumpft und verlandet, als handele es sich um drei oder vier verschiedene, hintereinander liegende Seen, die nur durch den Fluss verbunden sind. In dem engen Tal, eingeklemmt zwischen der imposanten Gipfelkette des gelben Berges auf der südlichen und dem spitzen Massiv des Nairgadin auf der nördlichen Seite, füllte der See die größten Teile des Talgrundes aus.
Während Bowolf den treuen Mor weiter zum Galopp zwang, sah er vor sich im Sternenlicht die hüpfenden Konturen der Rätiser. Ihre Pferde waren schnell. Sie hatten den Raubzug gut geplant. Sie wussten, dass die Mooka ihr Dorf nicht ernsthaft bewachten, und dass die Pferde der Mooka auf der dem See abgewandten Seite des Dorfes standen. Sie hatten die Hütten der Weiber ausspioniert und dann schnell und geräuschlos getötet.
„Gangam, Gangam!“ Bowolf schnaubte in ohnmächtiger Wut immer wieder diesen Namen in die Nacht.
Töten, töten, töten. Unbedingte Mordlust kochte in Bowolf. Er wollte Gangams Blut trinken, sein Herz herausreißen, seine Eingeweide über einem Misthaufen ausstreuen, sein Gehirn ausschlürfen. Er wollte das Messer in Gangams Brust stoßen und dort herumdrehen und herumdrehen. Er wollte ihm mit bloßen Händen die Augen aus den Höhlen und die Zunge aus dem Schlund reißen. Er wollte ihm das Gemächt mit der Steinaxt vom Unterleib schlagen, ihn lebendig über glühenden Holzscheiten rösten. Er wollte ihn ertränken, erwürgen, erdolchen, zerquetschen, in viele Einzelteile zerhacken. Er wollte ihm Seta wieder entreißen. Niemand durfte es wagen, die Häuptlingsfrau zu rauben. Kein anderer Krieger durfte sie besitzen. Da wurde Bowolf zum Raubtier. Das endete mit dem Tod.
Er erreichte das andere Seeufer. Im klaren Licht der Sterne erkannte Bowolf die Spuren der Flüchtigen. Die Rätiser ritten in einer Reihe hintereinander. So konnte Bowolf ihre Zahl nur schwer schätzen. Zwei mal zwei Hände, so hatten ihm die eigenen Leute zugerufen. So viel? Und sie hatten die Frauen als Beute, eine Hand und zwei. Die Frauen der Mooka wüssten sich zu wehren. Sie würden jede Gelegenheit nutzen, die Flucht ihrer Entführer zu behindern. Sie würden versuchen, Zeit zu gewinnen. Wenn es möglich war, so würden sie vom Pferd fallen. Die Rätiser mussten also aufpassen und antreiben.
Keine Frage, Bowolf würde nachziehen und bald würde er die Flüchtigen einholen; vielleicht sogar noch in dieser Nacht, spätestens morgen. Wie sollte er dann vorgehen? Bisher hatten ihn seine Raserei und der mächtige Wunsch nach Rache angetrieben. Nun, da er am jenseitigen Seeufer stand und die Fährten im Schnee betrachtete, besann er sich. Dem Pferd schäumte das Maul. Bowolf war zu schnell galoppiert.