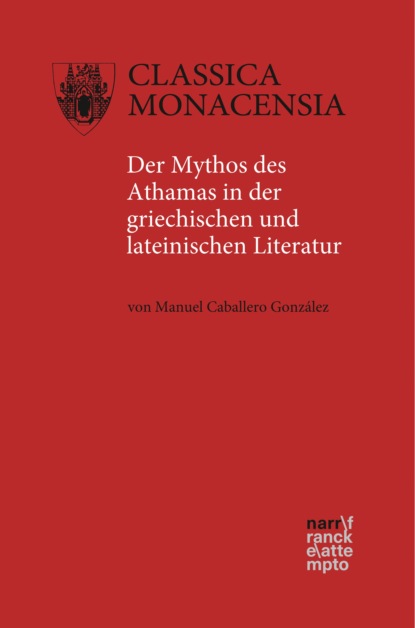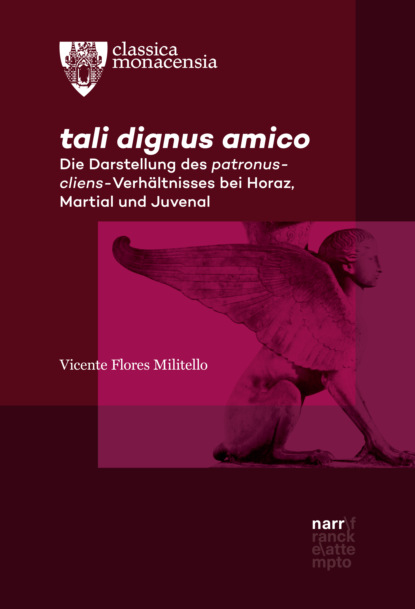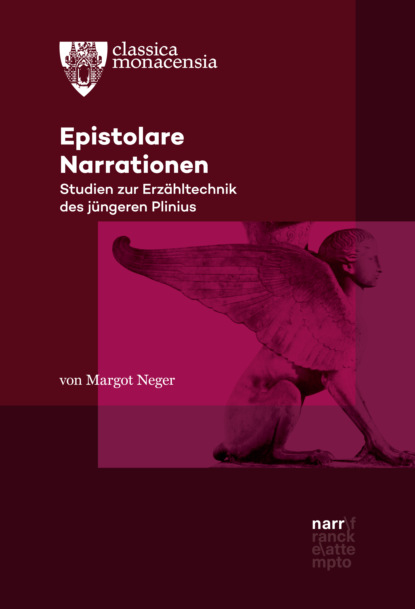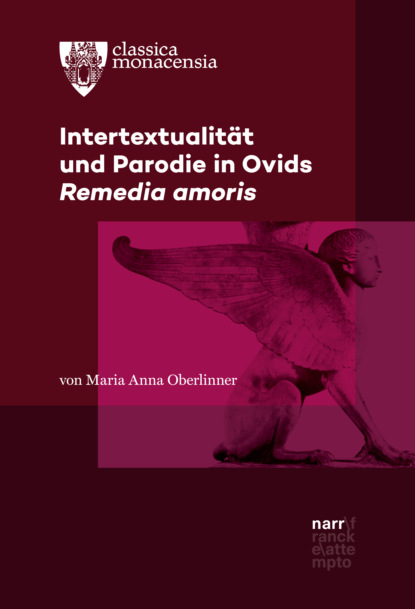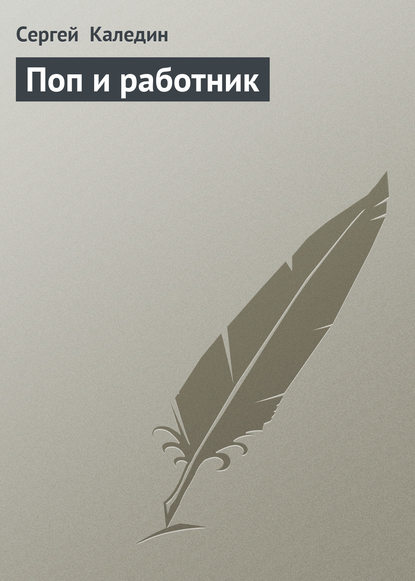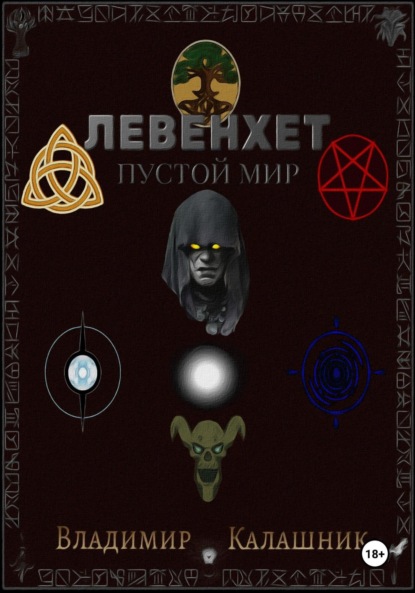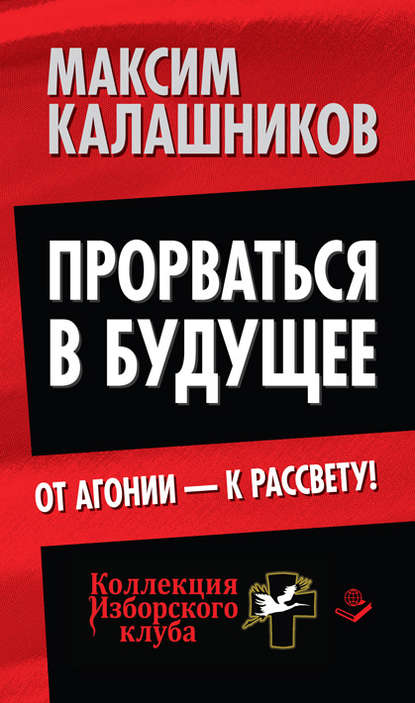Homer und Vergil im Vergleich
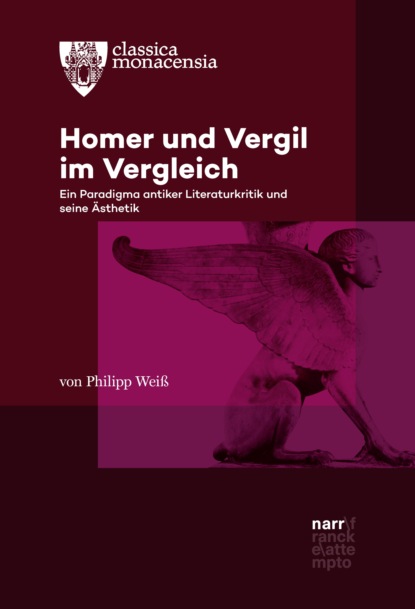
- -
- 100%
- +

Philipp Weiß
Homer und Vergil im Vergleich
Ein Paradigma antiker Literaturkritik und seine Ästhetik
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
[bad img format]
© 2017 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
www.francke.de • info@francke.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
ePub-ISBN 978-3-8233-0013-7
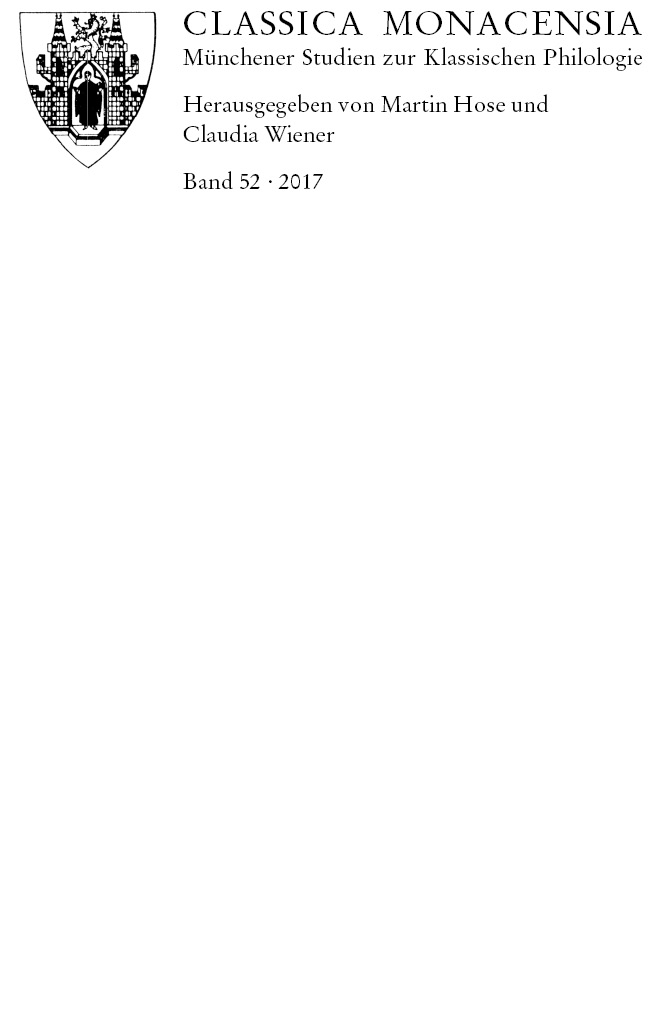
Die hier publizierte Studie hat im Dezember 2015 der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität München als Dissertationsschrift vorgelegen; die Disputation erfolgte am 28. Januar 2016.
Mein erster und wichtigster Dank gilt Prof. Dr. Claudia Wiener, die die Arbeit angeregt und mit großem Einsatz und Interesse betreut hat. Der Accessus ad Vergilium wurde mir durch sie bereits im Studium bereitet. Ihre Aufgeschlossenheit und ständige Gesprächsbereitschaft, verbunden mit enzyklopädischer Fachkenntnis und philologischer Akribie, waren die idealen und keineswegs selbstverständlichen Voraussetzungen für den Doktoranden, ein so umfangreiches Projekt innerhalb eines vertretbaren Zeitrahmens fertigzustellen. Prof. Dr. Martin Hose hat dankenswerterweise das Korreferat übernommen und wichtige Anregungen gegeben, die mir die Synthese der Ergebnisse erleichterten. PD Dr. Bianca-Jeanette Schröder und Prof. Dr. Susanne Gödde (FU Berlin) waren spontan dazu bereit, das Drittgutachten über die Dissertation zu erstellen bzw. als Kommissionsmitglied bei der Disputation zu fungieren. Ihnen allen danke ich herzlich für die Zeit und Mühe, die sie für mich investiert haben.
Ermöglicht haben mir die Umsetzung meines Dissertationsvorhabens in der Anfangszeit ein Doktorandenstipendium der Hanns-Seidel-Stiftung und von 2013 bis 2016 eine Anstellung als Doctoral Fellow an der Graduiertenschule Distant Worlds (LMU München), wo ich ein in gleicher Weise intellektuell anregendes wie auch zwischenmenschlich erfüllendes akademisches Klima vorgefunden habe. Einzelne Abschnitte und Thesen konnte ich bei Vorträgen und Tagungen in München (Forschungskolloquium an der Abteilung für Griechische und Lateinische Philologie, 2013), Salzburg (Volturnia, 2014) und Eichstätt (Tagung zur „Philologie auf zweiter Stufe“, 2015) vorstellen.
Allen Diskutanten, Kollegen und Freunden, besonders auch den Mitgliedern meiner Focus area bei Distant Worlds (Constructions of „the beautiful“), die mir ihre wertvollen Hinweise, Fragen, Anregungen und Kritik gegeben und z.T. einzelne Kapitel gegengelesen haben, sei an dieser Stelle aufrichtig gedankt. Nur wenige Namen sollen stellvertretend für viele weitere stehen: Dr. habil. Anna Anguissola (Pisa), Nadiya Eberts, Manuel Förg, Prof. Dr. Jens-Uwe Hartmann, Constanze Pabst von Ohain, Dr. Stefano Rocchi, Prof. Dr. Rolf Michael Schneider, Martin Schrage, Dr. Verena Schulz, Dr. Paolo Visigalli (Shanghai), Dr. Isabella Wiegand, Alexander Winkler. Einen besonderen Anteil an der Entstehung dieses Buches hat Ulrich Feckl.
Prof. Dr. Claudia Wiener und Prof. Dr. Martin Hose haben die Arbeit in ihre Reihe Classica Monacensia aufgenommen. Die Drucklegung wurde durch Zuschüsse der Graduiertenschule Distant Worlds und der FAZIT-Stiftung ermöglicht. Diesen Personen und Institutionen bin ich für ihre freundliche Unterstützung in den praktischen Belangen meines Publikationsprojekts eigens zum Dank verpflichtet.
Gewidmet sei dieses Buch den drei Menschen, die mich seit frühester Kindheit in vielerlei Hinsicht unterstützt und hinter mir gestanden haben, meinen Eltern Rosa Maria und Erwin Weiß, sowie meiner Tante Agnes Weiß (†22. September 2016).
München, April 2017
1. Einleitung
1.1 Die Verhandelbarkeit des Kanons: Vier spätantike Epigramme zur Einführung
In der Sammlung (spät-)antiker und frühmittelalterlicher Kleindichtung, die seit ihrer editorischen Bearbeitung durch Alexander Riese den Titel Anthologia Latina trägt, findet sich eine beträchtliche Anzahl von Gedichten über Vergil. In einigen von ihnen ist es den Autoren speziell um die Frage zu tun, welchen Platz der Dichter der Aeneis im Kanon der griechisch-römischen Literatur einnimmt. So in dem folgenden, unter dem Namen des Alcimus1 überlieferten Epigramm mit der Überschrift Virgilius (Anth. Lat. 674a 2Riese):2Anthologia Latina674a R.
Maeonium quisquis Romanus nescit Homerum, | Me legat, et lectum credat utrumque sibi. | Illius immensos miratur Graecia campos; | At minor est nobis, sed bene cultus ager. | Hic tibi nec pastor nec curvus deerit arator. | Haec Grais constant singula, trina mihi.
(„Ein jeder Römer, der den Mäonier Homer nicht kennt, soll mich lesen und glauben, dass er damit beide gelesen hat. Griechenland bewundert die unermesslichen Felder jenes Dichters – unser Acker hingegen ist kleiner, dafür aber gut gepflegt. Hier wirst du weder den Hirten noch den Pflüger mit krummem Rücken vermissen. Für die Griechen macht das alles nur ein einziges Werk aus, für mich drei.“)
Das Gedicht ist, worauf schon der Titel hinweist, als Ethopoiie gestaltet, eine in der Spätantike beliebte Form des Dichtens über Literatur.3 Vergil spricht also selbst: Er richtet sich an ein römisches Publikum, erhebt scherzhaft den Anspruch künstlerischer Gleichrangigkeit mit Homer – die Lektüre seiner Werke könne die Homerlektüre gleichsam ersetzen –, formuliert dann aber einen Unterschied zwischen sich und Homer hinsichtlich der leitenden ästhetischen Prinzipien – immensos … campos vs. cultus ager4 –, und bezieht außerdem Eklogen und Georgica in den Wettstreit mit Homer ein, der hier hauptsächlich als Dichter der Ilias in Betracht kommt (singula vs. trina). – In einem anderen Gedicht, ebenfalls dem Alcimus zugeschrieben, wird die Perspektive des Mantuaner Dichters durch den auktorialen Blickwinkel des Literaturkritikers ersetzt. Es trägt entsprechend den Titel De Virgilio und lautet (Anth. Lat. 740 2Riese):Anthologia Latina740 R.
De numero vatum si quis seponat Homerum | Proximus a primo tunc Maro primus erit. | At si post primum Maro seponatur Homerum, | Longe erit a primo, quisque secundus erit.
(„Wenn einer Homer aus der Zahl der Dichter streicht, dann wird Maro, der dem ersten am nächsten steht, der erste sein. Wenn man hingegen Maro hinter dem erstplatzierten Homer streicht, so wird, wer auch immer dann der zweite ist, im weiten Abstand hinter dem ersten abgeschlagen sein.“)
Anstelle der von Vergil im ersten Gedicht selbstbewusst beanspruchten Gleichrangigkeit steht hier die nüchterne Rechnung des Literaturkritikers, der mit der Autorität einer sich über die Jahrhunderte hin verfestigten communis opinio die Rangverhältnisse festsetzt: Vergil, der „ewige Zweite“, rangiert nicht weit hinter seinem erklärten Vorbild Homer, erhebt sich aber über alle anderen (griechischen und lateinischen) Dichter, die sich im gehörigen Abstand auf die hinteren Plätze verwiesen sehen.5 – Diese differenzierte Rangabstufung hatte bekanntlich Quintilian in seinen Lektüreempfehlungen für den angehenden Redner (inst. 10, 1, 46–131)6 unter Berufung auf Cn. Domitius Afer (cos. 39 n. Chr; †59 n. Chr.)7 in gleicher Weise definiert (inst.Quintilianinst. 10, 1, 86 10, 1, 86):
Utar enim verbis isdem quae ex Afro Domitio iuvenis excepi, qui mihi interroganti quem Homero crederet maxime accedere ‘secundus’ inquit ‘est Vergilius, propior tamen primo quam tertio’. Et hercule ut illi naturae caelesti atque inmortali cesserimus, ita curae et diligentiae vel ideo in hoc plus est, quod ei fuit magis laborandum, et quantum eminentibus vincimur, fortasse aequalitate pensamus. Ceteri omnes longe sequentur.
(„Ich will mich nämlich der gleichen Worte bedienen, die ich als junger Mann von Domitius Afer als Antwort erhalten habe, der zu mir auf meine Frage, wer nach seiner Meinung Homer am nächsten käme, sagte: ‘Der Zweite ist Vergil, jedoch dabei dem Ersten näher als dem Dritten.’ Und ja, beim Herkules, mögen wir auch hinter der himmlischen und unsterblichen Naturkraft ihres Dichters zurückstehen, so zeigt der unsere doch mehr Liebe und Sorgfalt – schon deshalb, weil er sich mehr hat mühen müssen, und das, was wir an hervorragenden Stellen an Abstand verlieren, gleichen wir vielleicht durch die Gleichmäßigkeit des Ganzen wieder aus.“ ÜS Rahn)
Natur (… illi naturae caelesti atque inmortali …) und Kultur (… curae et diligentiae …) sind hier als poetologische Prinzipien deutlich kontrastiert. Auch Alcimus geht von einem ähnlichen Begriffspaar aus, wenn er den „wohlbebauten Acker“ Vergils von Homers „gewaltigen Feldern“ abgrenzt (s.o.). Quintilian verknüpft mit Vergil und Homer zwei gegensätzliche Grundvorstellungen, die die Rezeption beider Dichter bis in die Neuzeit prägen sollten.8
Für Quintilian besteht grundsätzlich die Möglichkeit, einen dem homerischen vergleichbaren Grad an Vollkommenheit zu erreichen – ars und natura werden im zweiten Satz des zitierten Abschnitts nicht hierarchisiert. Allerdings ist für Vergil im Wettkampf mit Homer ein anderes Mittel angezeigt, nämlich eben diese ars, d.h. die gleichmäßige künstlerische Ausarbeitung (vgl. aequalitate) des ganzen Werks, wodurch allein der Vorsprung der homerischen Schöpfung mit ihren unübertrefflichen Einzelinspirationen (vgl. eminentibus) eingeholt werden kann.
Ein drittes Epigramm, wieder mit dem Namen des Alcimus verbunden, lotet ebenfalls die Möglichkeiten, Homer zu erreichen, aus. Es ist in einer Abschrift des Humanisten Claude Binet erhalten und trägt beide Dichternamen im Titel (De Vergilio et Homero; Anth. Lat. 713 2Riese):9Anthologia Latina713 R.
Maeonio vati qui par aut proximus esset, | Consultus Paean risit et haec cecinit: | Si potuit nasci, quem tu sequereris, Homere, | Nascetur, qui te possit, Homere, sequi.
(„Als man Apollo befragte, wer dem Dichter aus Mäonien gleich oder doch am nächsten komme, lachte er und gab folgenden Orakelspruch: ‘Wenn einer geboren werden konnte, dem du, Homer, folgen musstest, dann wird es wohl einer sein, der dir, Homer, folgen kann.’“)
Von Vergil ist in diesem Gedicht – anders als in der Überschrift suggeriert – nicht ausdrücklich die Rede. Zunächst hat es den Anschein, dass im zweiten Distichon einer traditionellen Vorstellung vom schlechthin nicht zu imitierenden Homer, der auch selbst keine Vorgänger gehabt hat, das Wort geredet wird: „Wenn es jemanden gegeben hätte, den du nachahmen konntest, so wird es auch künftig jemanden geben, der dich nachahmen können wird.“ Velleius Paterculus hatte – ins Negative gewendet – über Homer eine entsprechende Anschauung formuliert: in quo <scil. poeta> hoc maximum est, quod neque ante illum, quem ipse imitaretur, neque post illum, qui eum imitari posset, inventus est (Vell. 1, 5, 2).10 Doch sind die Worte Apollos, ihrer Natur als Orakelspruch entsprechend, doppeldeutig. Den Schlüssel gibt die zweifache Bedeutung von sequi: Das Verbum kann einerseits – wie im Schlusssatz des oben zitierten Quintilianabschnitts der Fall – die Nachfolge hinsichtlich des Ranges bezeichnen, andererseits aber auch eine intentionale literarische Bezugnahme auf einen Modelltext.11 Im Fall von Anth. Lat. 713 2Riese liegt ein Wortspiel nach Art einer distinctio vor. Die zweite, verrätselte Gedichthälfte lässt sich nämlich auch folgendermaßen paraphrasieren: „Falls es möglich ist, dass du, Homer, einmal den zweiten Platz einnehmen musst, dann wird wohl einer geboren werden, der dich nachahmen kann.“12 Die imitatio ist demnach geradezu die Bedingung, um die Überbietung des kanonischen Modells zu erreichen. Delphische Orakelsprüche behalten in der Regel recht, und zwar gerade in dem Sinn, der sich nicht auf den ersten Blick hin erschließt: Das Gedicht plädiert demnach mit der Autorität des Musengottes für eine Vorrangstellung Vergils vor Homer.13
Die drei Gedichte14 weisen entgegen der von Quintilian ex cathedra verkündeten Rangfolge eine erhebliche Variabilität im Urteil und in der Perspektive auf: Selbstbewusste Verkündigung der Überbietungsabsicht durch Vergil selbst (Anth. Lat. 674a 2Riese), schulmäßige Bestenliste mit Homer an unhinterfragt erster Stelle (Anth. Lat. 740 2Riese), ironisches Spiel mit den Bedingungen und Möglichkeiten von imitatio und aemulatio (Anth. Lat. 713 2Riese). Ermöglicht wurde eine derartige Dynamik durch das Doppelprinzip von Natur und Kultur, von dem der zitierte Passus aus der Institutio oratoria ausgeht: Je nach Gewichtung und Verhältnisbestimmung der beiden Parameter konnte man damit ja entweder die prinzipielle Unerreichbarkeit Homers begründen oder eben die Möglichkeit einer Einholung der natura durch ars. Indem Quintilian die Einschätzung der beiden Dichter an zwei unterschiedliche Kriterien knüpfte, machte er sein Urteil von der Definition und Relation eben dieser Kriterien abhängig.
Der Name des Alcimus führt schließlich noch zu einem letzten Text, der in knapper Form einen Vergleich dreier Dichter bringt, und damit den literaturgeschichtlichen Horizont der bisher behandelten Gedichte erweitert (Anth. Lat. 225 Shackleton Bailey):15Anthologia Latina225 Sh.-B.
Mantua, da veniam, fama sacrata perenni: | sit fas Thessaliam post Simoenta legi.
(„Mantua, sei nachsichtig, du bist ja mit ewigem Ruhm gesegnet: Lass zu, dass man auch nach dem Simois über Thessalien liest.“)
Die drei geographischen Namen verweisen auf Vergil (Mantua), Lucan (Thessaliam) und Homer (Simoenta).16 Mit Bezug auf Lucan. 9, 980–98617 bittet der Sprecher – die fiktive persona Lucans oder der im neunten Buch der Pharsalia genannte Caesar, d.h. Nero? – bei Vergil darum, dass man auch das Bürgerkriegsepos nach einem Werk wie der Ilias noch lesen würde. Der Autor des Epigramms sah allem Anschein nach einen Widerspruch darin, dass sich Lucan im neunten Buch der Pharsalia auf den ewigen Ruhm Homers berufen, Vergil aber dabei mit keinem Wort erwähnt hatte. Die Bitte an Vergil – dem mit fama sacrata perenni bei Alcimus genau diejenige Qualität zugeschrieben wird, mit der Homer in Lucan. 9, 984 glänzt, nämlich ewiger Ruhm – soll diesen literaturkritischen faux pas Lucans ausgleichen: Neben Homer ist es für Alcimus eben auch Vergil, bei dem man mit seinem Wunsch nach ewigem Dichterruhm vorstellig werden muss.18
Zumindest zwei der vier Gedichte – Anth. Lat. 674a und 713 2Riese – behandeln den vorgegebenen Kanon also als eine verhandelbare Größe: Sie stellen das durch Quintilians Autorität verfestigte Urteil zur Disposition, wonach grundsätzlich Homer der erste, Vergil aber der zweite Rang zukommt, wobei auch beim letzten Gedicht (Anth. Lat. 225 Shackleton Bailey), in dem sich einer von den traditionell auf die hinteren Ränge verwiesenen Autoren zu Wort meldet, ein spielerischer Ton den Umgang mit den Vorgaben des Kanons bestimmt. Das einzige Gedicht, in dem der Kanon scheinbar uneingeschränkt affirmativ behandelt wird (Anth. Lat. 740 2Riese), lässt durch das pedantisch vorexerzierte Auszählen der Positionen ebenfalls eine gewisse Distanzierung zum Inhalt erkennen. Kanonisierung wird in diesen kurzen Stücken demnach einerseits als ein spielerischer Prozess des Aushandelns von Positionen vorgeführt, der seine besondere Dynamik andererseits aber in einem argumentativen Austausch konkurrierender Begründungen für die jeweilige Wertung entfaltet.
Das kann in einem Epigramm nur in pointierter Zuspitzung geschehen. Andere Zeugnisse antiker Literaturkritik, die im Zentrum der nachfolgenden Untersuchung stehen, tun dies in weit ausführlicherer und differenzierterer Form. Die Epigramme des Alcimus zeigen aber, dass man sich – zumindest in diesem Falle – von einer statischen Auffassung des Kanons zu lösen hat. Für Alcimus bzw. die personae seiner Gedichte besitzt der Kanon zwar Gültigkeit als ein allgemein bekannter kultureller Bezugspunkt. Die Gedichte formulieren aber alternative Sichtweisen und Perspektiven, sei es im Modus der Parodie (Anth. Lat. 740 2Riese), der Ethopoiie des unterlegenen Zweiten (Anth. Lat. 674a 2Riese), in der Doppeldeutigkeit eines Orakelspruches (Anth. Lat. 713 2Riese) oder in der nachgeholten Reverenz des „Dritten“ an den „Zweiten“ (Anth. Lat. 225 Shackleton Bailey). Man greift sicherlich zu hoch, wenn man diesen Gedichten die Absicht unterstellt, sie wollten den gültigen Kanon subversiv infrage stellen oder generell „Kanonkritik“ betreiben. Vielmehr geht es um einen produktiven und differenzierenden Umgang mit den Vorgaben der autoritativen Bestenlisten, der bestimmte ästhetische Aspekte – ars und ingenium, imitatio und Originalität u.a. – in den Vordergrund spielt, die bei einer simplen Listenplatzierung aus dem Blick geraten. Die Gedichte führen also gewissermaßen von der Wertung zu den Werten: Nicht mehr das statische Ergebnis, sondern die ästhetischen Beurteilungsgrundlagen des Kanonisierungsvorgangs, die seinen prozesshaften Verlauf bestimmen, rücken in den Vordergrund.
1.2 Fragestellung, forschungsgeschichtliche Einordnung und Methode
Ausgehend von den Gesichtspunkten, die im Zusammenhang mit den vier Gedichten aus der Anthologia Latina angesprochen wurden, ist die zentrale Fragestellung der vorliegenden Untersuchung näher zu bestimmen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die ästhetischen Beurteilungskriterien und Begründungsstrategien in denjenigen Texten, die einen wertend-begründenden Vergleich zwischen den beiden Dichtern Vergil und Homer anstellen, zu benennen, zu erklären und nach ihren rezeptionsgeschichtlichen Bedingungen zu befragen. Daran schließt sich als übergeordnetes Untersuchungsziel die Frage an, ob und – wenn ja – wie sich die verschiedenen Antwortversuche auf das Problem einer Vorrangstellung Homers oder Vergils in der antiken Kanondiskussion positionieren, näherhin ob und inwieweit die fraglichen Vergleiche als Beiträge zu einer solchen Kanondiskussion betrachtet werden können oder ob sich die Funktion des Homer-Vergil-Vergleichs in der Antike anders bzw. differenzierter bestimmen lässt.
Als Untersuchungsgegenstände kommen also grundsätzlich wertende Vergleiche zwischen Homer und Vergil in Betracht. Diese wertenden Vergleiche wurden in der Antike mit dem Terminus Synkrisis (bzw. lat. diiudicatio locorum o.ä.) bezeichnet (s.u. → Kap. 1.3.1 und 4.1.3). Gemeint ist dabei immer ein methodengeleiteter, von bestimmten ästhetischen Kriterien ausgehender Vergleich mindestens zweier Texte mit dem Ziel, eine qualitative Hierarchie zwischen ebendiesen Texten zu bestimmen.
Ausgeschlossen aus der engeren Themenstellung sind demnach solche Texte bzw. Abschnitte, die ein homerisches Modell für eine konkrete Vergilstelle lediglich identifizieren, ohne eine explizite literaturkritische Stellungnahme damit zu verbinden. Das gilt etwa für die umfangreichen Abschnitte Sat. 5, 2, 6–5, 3, 17, 5, 3, 2–14, 5, 4, 2–5, 10, 13 und 5, 11 in den Saturnalia des Macrobius, aber auch für den Großteil der Homer-Vergil-Vergleiche in den Vergilkommentaren, zumal bei Servius. – Von einer gesonderten Untersuchung der Vergilkommentare konnte in diesem Rahmen vor allem aus zwei Gründen abgesehen werden: Einerseits sind die literaturkritisch wertenden Vergleiche mit Homer in diesen Erklärungsschriften wie erwähnt quantitativ unterrepräsentiert, zumeist wird einfach auf ein homerisches Beispiel verwiesen oder es werden unter Berufung auf Homer Sacherläuterungen gegeben. Außerdem liegt mit der Studie von Marco Scaffai eine umfassende Monographie vor, die alle expliziten Erwähnungen Homers bei Servius und den anderen Kommentatoren eingehend bespricht (vgl. ergänzend dazu Cyron [2009], S. 192–223 [„Die Funktion von Verweisen auf andere Autoren“; bes. zu Homer S. 210–223]). Die i.e.S. synkritischen Notizen nehmen dann entsprechend auch bei Scaffai nur einen kleinen Abschnitt ein; vgl. Scaffai (2006), S. 327–373 (Kapitel 3: „Critica poetica e sistema narrativo“). Gerade der zuletzt genannte Abschnitt kann daher als Ergänzung der vorliegenden Studie angesehen werden, auch weil er auf die an den jeweiligen Stellen relevanten ästhetischen Kategorien – wenn auch nicht systematisch – eingeht. Metapoetische Deutungen entsprechender Stellen, an denen Vergil in den Augen seiner antiken Exegeten über sich und sein Verhältnis zu anderen Autoren – Zeitgenossen, aber auch kanonischen Vorbildern – spricht, behandelt Cyron (2009), S. 277–282. – Selbstverständlich sind Servius und die anderen Kommentatoren aber auch für die engere Fragestellung dieser Untersuchung von Relevanz, weil es oft nur durch die in den Kommentaren überlieferten Vergildeutungen möglich ist, den philologischen Diskussionszusammenhang zu rekonstruieren, in den sich die wertenden Vergleiche bei Seneca d.Ä., Gellius oder Macrobius einordnen. Die Kommentatoren werden hier also durchaus durchgehend berücksichtigt, aber nicht eigenständig behandelt.1
Mit dieser Fragestellung soll also nicht nur ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte Vergils geleistet werden, vielmehr werden am Beispiel des Homer-Vergil-Vergleichs exemplarisch Analysekriterien zusammengestellt, mit denen der literaturkritische Praktiker in der Antike zumal solche Beziehungen zwischen Texten bewertete, bei denen er eine intentionale Bezugnahme eines Nachahmers auf sein Modell im Sinne von imitatio bzw. aemulatio unterstellte.2
Dieser antike Zugang zum Text steht den modernen, von den methodischen Grundsätzen der strukturalistischen Intertextualitätstheorie mit ihrer Ausblendung der Autorinstanz geleiteten Annäherungen an Vergil natürlich grundsätzlich entgegen: Die antiken Philologen hatten, pointiert formuliert, keine Angst vor der intentional fallacy. Daraus ergibt sich die generelle Tendenz, bei entsprechenden Text-Text-Beziehungen immer von einer „bewussten“ Bezugnahme des jüngeren Autors auf den Text des älteren auszugehen und diese Bezugnahme entsprechend regelmäßig als imitatio bzw. aemulatio mit Wettkampfcharakter zu deuten. Deutlich kommt dies schon in der bekannten Formulierung des Servius am Beginn seines Vergilkommentars zum Ausdruck: intentio Vergilii haec est, Homerum imitari … (I 4, 10 Thilo-Hagen). – Zu den verwendeten Begriffen: Im Folgenden wird also in der Regel von „Modell“, „Vorbild“, „Muster“ bzw. „Nachahmung“, „Nachbildung“, „imitatio“ gesprochen, ohne dass in jedem Fall die – ohnehin nur schwer zu beantwortende – Frage diskutiert wird, ob tatsächlich eine intentionale Bezugnahme Vergils auf Homer vorliegt. Ausgegangen wird von der Feststellung eines derartigen Bezugs durch den antiken Literaturkritiker. Zur Bewertung seiner Einschätzung ist dann hingegen sehr wohl zu fragen, ob es nicht noch weitere Vorbilder gibt, zumal solche „Zwischenmodelle“ – z.B. ein nach Homer gestaltetes Gleichnis bei Apollonios, das wiederum Vergil zum Vorbild gedient hat – Aufschluss über die kritische Rezeptionsgeschichte der fraglichen Homerstelle geben können (s.u.).
Die Synkrisis, der Vergleich von Modell und Nachahmung, ist für den antiken Literaturkritiker also das Instrument, um Strategien einer intentional verstandenen imitatio und aemulatio zu verbalisieren und nach ihrem Erfolg zu beurteilen. Eine zusammenfassende Analyse synkritischer Urteile, wie sie in der vorliegenden Untersuchung für den Fall der vergilischen Homer-imitatio unternommen wird, ermöglicht somit Rückschlüsse auf den literaturkritischen Erwartungshorizont, der als Faktor literarischer Produktion auch für andere, zumal epische Texte von Relevanz ist.