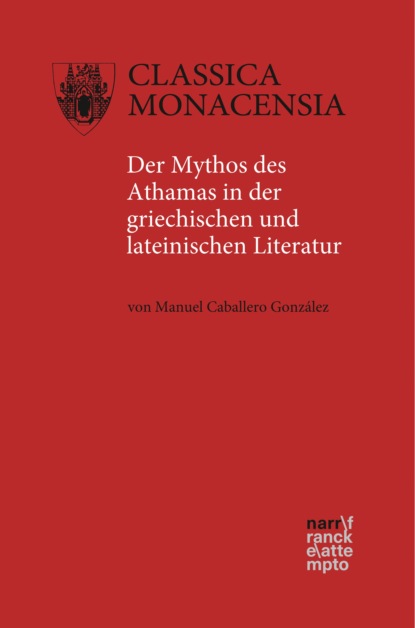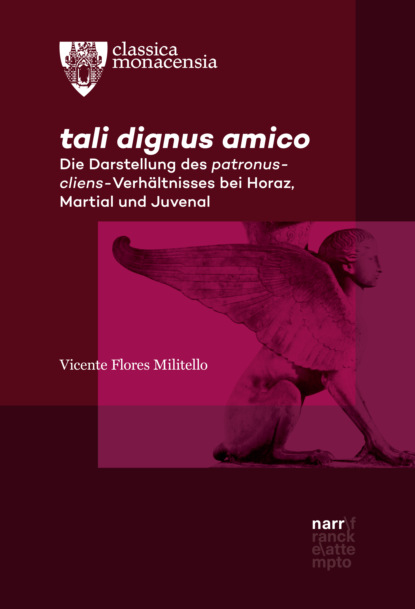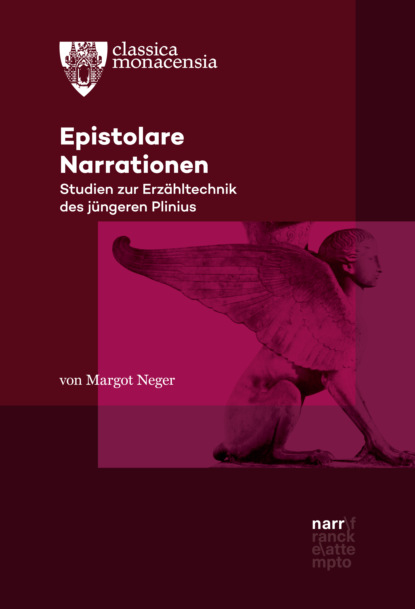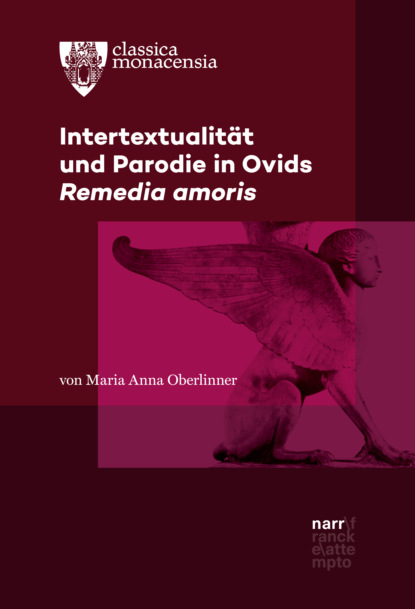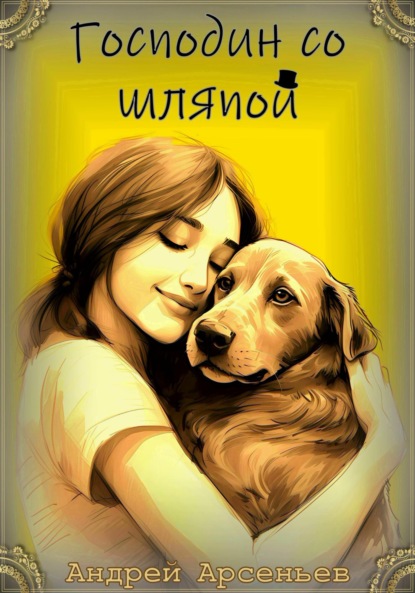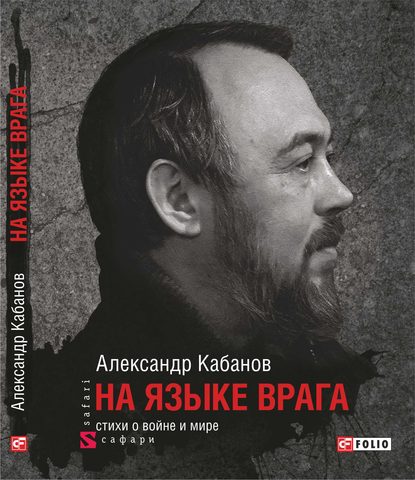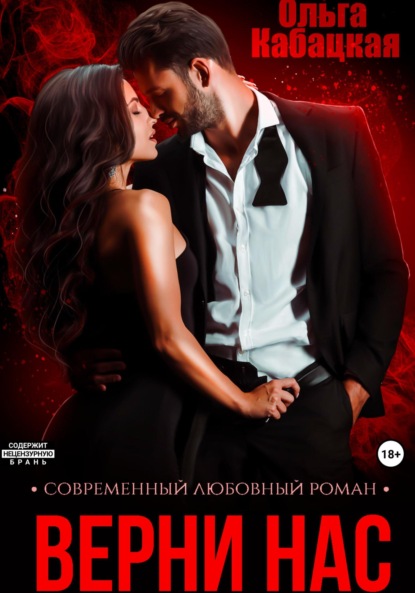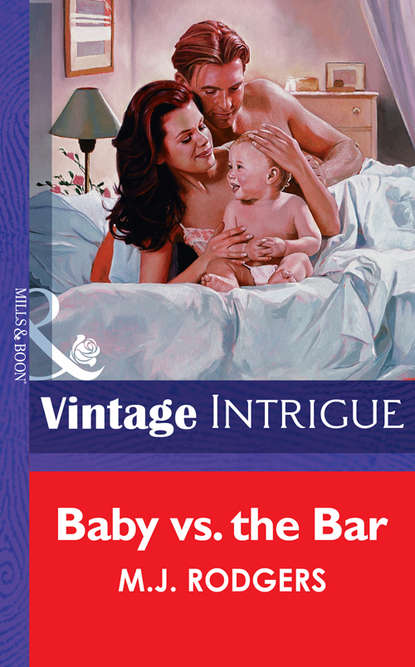Homer und Vergil im Vergleich
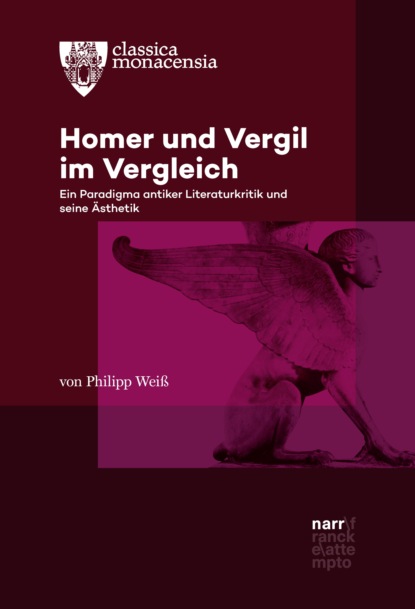
- -
- 100%
- +
Folgt man der VSD, so hat es neben der Parodie aber noch andere Gattungen der Vergilkritik gegeben: Kritik in der Nachfolge der sog. Ὁμηρομάστιξ des Zoilos und Plagiatsvorwürfe. Dass sich der zuerst genannte Carvilius Pictor36 mit dem Titel seiner Aeneidomastix auf den prototypischen Vertreter der Homerkritik, Zoilos von Amphipolis, bezog, dürfte auf der Hand liegen. Wie aber ordnet sich diese Nachricht in die Rezeptionsgeschichte des Zoilos, soweit uns diese heute noch greifbar ist, ein?37 Der Sophist Zoilos hatte sich im vierten Jahrhundert neben historischen und rhetorischen Werken mit seinen neun Büchern κατὰ τῆς Ὁμήρου ποιήσεως einen Namen als Homerkritiker gemacht. Er folgte in dieser Schrift vermutlich dem Handlungsgang von Ilias und Odyssee und brachte an denjenigen Stellen, die ihm anfechtbar schienen, seine Ausstellungen an. Soweit wir wissen, hat sich Zoilos – anders als sein Zeitgenosse Aristoteles in der Schrift über die Homerprobleme38 – mit der Identifikation und Verzeichnung der problematischen Passagen begnügt. Den Beinamen Ὁμηρομάστιξ scheint man ihm erst nach seinem Tod gegeben zu haben, wie es auch wohl erst in späthellenistischer bzw. augusteischer Zeit dazu kam, dass man ihn zum Muster des Homerkritikers erhob.39 Aus dieser Periode sind uns sowohl zustimmende40, neutrale41 wie auch eindeutig ablehnende (s.u.) Einschätzungen des Zoilos bezeugt, bevor sein Name dann in der Folgezeit zum Inbegriff des Homerbekritlers werden konnte.42
Zur letzteren Kategorie gehört ein Distichon aus Ovids Lehrgedicht über die Heilmittel gegen die Liebe: ingenium magni livor detractat Homeri: | quisquis es, ex illo, Zoile, nomen habes.43Ovidrem. 365–368 Ovid wendet sich in dieser Einlassung gegen Kritiker, die seine erotischen Dichtungen unter moralischem Gesichtspunkt beanstanden (vgl. rem. 361–362: Nuper enim nostros quidam carpsere libellos, | Quorum censura Musa proterva mea est). Die Stelle zeigt einerseits, dass Zoilos zur Abfassungszeit der Remedia, also ca. 1 v. Chr./2 n. Chr.44, als Inbegriff des schmähsüchtigen Kritikers gelten und andererseits auch für moralisch motivierte Kritik in Anspruch genommen werden konnte. Die zweite Beobachtung stellt eine bemerkenswerte Erweiterung des kritischen Spektrums dar, wie wir es aus den überlieferten Zoilosfragmenten rekonstruieren können.45 Für die Aeneidomastix, an die Ovid – wie gleich noch zu zeigen ist – an dieser Stelle denkt, kann damit prinzipiell auch moralische Kritik angenommen werden.46
Bei Ovid folgt unmittelbar anschließend in rem. 367–368 dieselbe Parallelisierung von Vergil- und Homerkritik, die wir in der VSD angetroffen haben: Et tua sacrilegae laniarunt carmina linguae, | Pertulit huc victos quo duce Troia deos. Die explizite Erwähnung des Aeneisdichters berechtigt zu dem Schluss, dass Ovid hier auf die Aeneidomastix anspielt47, woraus sich eine Datierung dieser Schrift in die zwei Jahrzehnte zwischen 19 v. Chr. und spätestens 2 n. Chr. ergäbe. Zwar verlegt sich Ovid in dem anschließenden Passus rem. 373–388 auf den Hinweis auf stoffliche und stilistische Gattungskonventionen als Rechtfertigungsstrategie gegen den livor, erklärt die Kritik an Homer und Vergil in rem. 369–370 aber mit dem allgemeinen Hinweis Summa petet livor, perflant altissima venti, | Summa petunt dextra fulmina missa Iovis.48 Nach dieser Sentenz ruft alles Große, beinahe einem Naturgesetz folgend, Kritik hervor. Indem er aus dem Umstand der Kritik auf den Rang der angefeindeten Dichter schließt, trifft sich Ovid mit Sueton, der im Einleitungssatz VSD 43 ja einen ganz ähnlichen Gedanken formuliert hatte.
Methode und Tendenz der Aeneidomastix sind für uns heute nur mehr umrisshaft zu erschließen, doch wird man Folgendes festhalten können: Die Schrift dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach in die erste Phase der Aeneisrezeption in den beiden Jahrzehnten unmittelbar nach Vergils Tod fallen. Wenn der im Titel gegebene Bezug mehr ist als eine unverbindliche Anspielung, dann wird sich die Kritik methodisch in dem von Zoilos vorgegebenen Rahmen bewegt haben und, wie aus dem Ovidzitat hervorgeht, moralische Kritik miteingeschlossen haben. Die Methode, kritische Anfragen gegen eine Dichtung in Form eines ζήτημα bzw. einer quaestio zu richten, war aus der alexandrinischen Philologie schon kurz vor der Entstehung der Aeneidomastix in Rom eingeführt worden und wird Carvilius Pictor das formale Muster für seine Kritik an die Hand gegeben haben.49
Was den Inhalt von Herennius’ Schrift über die vitia Vergils betrifft, so lässt sich dieser wohl enger als bei Carvilius Pictor eingrenzen. Worin bestanden die inkriminierten vitia? Eine Schrift mit einem ähnlichen Titel verfasste der Aristarchschüler Dionysodoros.50 Einer der Irrtümer, die er im Rhesos korrigierte, betraf die genaue Lokalisierung eines Apollontempels, also ein sachliches Detail. Die Scholiennotiz referiert die Kritik mit dem Hinweis, Euripides hätte sich hier παρὰ τὴν ἱστορίαν vergangen. Wie aus VSD 46 hervorgeht, hat Asconius Pedianus Vergil auch gegen Vorwürfe contra historiam verteidigt. Möglich also, dass eine mit vitia betitelte Schrift Vorwürfe dieser Art enthalten hat. Die Reihenfolge des Titelkatalogs bei Sueton legt aber einen anderen Schluss nahe: Unmittelbar zuvor wird eine Anekdote berichtet, die die Eigentümlichkeiten des vergilischen Stils betrifft. Die Schrift des Herennius wird in einem Atemzug mit einer anderen stilkritischen Schrift, den furta des Perellius Faustus, genannt. Die zeitliche Nähe zu den seit dem 1. Jhdt. v. Chr. in großer Zahl entstehenden Werken περὶ ἑλληνισμοῦ51 lässt es plausibel erscheinen, dass der Begriff vitium im Titel streng terminologisch im Sinne eines Verstoßes gegen die Regeln richtigen Sprachgebrauchs verwendet ist.52 Herennius dürfte Vergil keine Verstöße gegen Handlungslogik, Charakterdarstellung o.ä. vorgeworfen haben, sondern sich auf Sprachfehler im engeren Sinne beschränkt haben. Dass er seinen Analysen dabei die Kategorien zugrunde legte, in die man die vitia in Anlehnung an die griechische grammatische Theorie einteilte, ist wahrscheinlich.53 Man warf Vergil entsprechende vitia vor, wie sich ja schon im zweiten Fragment des Numitorius gezeigt hat, und viel früheres Material ist auch in den Kommentar des Servius eingegangen.54
Doch stellt sich auch dann wieder die Frage, wie sich der von Sueton behauptete direkte Bezug zur Homerkritik herstellen lässt. Dass sich die alexandrinischen Grammatiker auf die Kriterien der Sprachrichtigkeit bei der Diorthose des Homertextes berufen konnten, lässt sich aus den überlieferten Aristarchfragmenten ersehen.55 Doch schon die Sophisten hatten die ὀρθοέπεια, den richtigen Wortgebrauch, in den homerischen Gedichten thematisiert und in Frage gestellt.56 Auch Spezialschriften zu diesem Thema wurden verfasst: Immerhin ist schon für Demokrit eine Schrift mit dem Titel περὶ Ὁμήρου [ἢ] ὀρθοεπείης καὶ γλώσσεων überliefert, in der Homer für seine sprachlichen Besonderheiten in Schutz genommen wurde.57 Auch erklärte Homerkritiker wie Zoilos hatten sprachliche Beanstandungen in ihre Schriften aufgenommen.58 Herennius konnte, wenn er sich tatsächlich auf sprachliche vitia Vergils konzentrierte, demnach mit einem gewissen Recht für eine bestimmte Richtung der Homerkritik in Anspruch genommen werden, wenn seine Methoden auch wohl aus jüngerer Zeit stammten und ganz der im 1. Jhdt. erst zu einem Teilbereich des τεχνικὸν μέρος der Grammatik ausgebauten Lehre von der Sprachrichtigkeit verpflichtet gewesen sein dürften.
2.2 Die Plagiatsvorwürfe gegen Vergil
2.2.1 Philologische Spezialschriften περὶ κλοπῆς
Kein direktes Vorbild aus der Homerkritik lässt sich aber für die mit den Titeln furta und Ὁμοιότητες überschriebenen Sammlungen des Perellius Faustus bzw. Quintus Octavius Avitus ausmachen. Der Inhalt der acht Bücher umfassenden Schrift des Avitus1, aber auch der furta des Perellius Faustus, ergibt sich aus Suetons erklärendem Zusatz quos et unde versus transtulerit (VSD 45). Wie ordnen sich aber diese Schriften, deren Titel einmal eine polemische Stoßrichtung (furta), einmal eine neutrale Wertung der Parallelen als „Ähnlichkeiten“ (Ὁμοιότητες) erkennen lassen, in die philologisch-kritische Tradition ein? Um diese Frage zu beantworten, sind zunächst die antiken Nachrichten über philologische Plagiatsliteratur unter den besonderen Aspekten von Chronologie und Tendenz erneut zu prüfen.2
Hauptquelle für unsere Kenntnis über die griechischen Spezialabhandlungen zum Plagiat ist ein Abschnitt aus der Φιλόλογος ἀκρόασις des Neuplatonikers Porphyrios3, den uns Eusebios in seiner zwischen 312 und 322 entstandenen Praeparatio evangelica überliefert:4Eusebiospraep. evang. 10, 3
Ταῦτ᾿ εἰπόντος τοῦ Νικαγόρου ὁ Ἀπολλώνιος∙ ῾Καὶ τί θαυμάζομεν᾿, ἔφη, ῾εἰ Θεοπόμπου καὶ Ἐφόρου τὸ τῆς κλοπῆς πάθος ἥψατο, ἀργοτέρων οὕτως ἀνδρῶν, ὅπου γε καὶ Μένανδρος τῆς ἀρρωστίας ταύτης ἐπλήσθη, ὃν ἠρέμα μὲν ἤλεγξε διὰ τὸ ἄγαν αὐτὸν φιλεῖν Ἀριστοφάνης ὁ γραμματικὸς ἐν ταῖς Παραλλήλοις αὐτοῦ τε καὶ ἀφ᾿ ὧν ἔκλεψεν ἐκλογαῖς; Λατῖνος δ᾿ ἓξ βιβλίοις, ἃ ἐπέγραψε Περὶ τῶν οὐκ ἰδίων Μενάνδρου, τὸ πλῆθος αὐτοῦ τῶν κλοπῶν ἐξέφηνε∙ καθάπερ ὁ Ἀλεξανδρεὺς Φιλόστρατος Περὶ τῆς τοῦ Σοφοκλέους κλοπῆς πραγματείαν κατεβάλετο. Κεκίλιος δέ, ὥς τι μέγα πεφωρακώς, ὅλον δρᾶμα ἐξ ἀρχῆς εἰς τέλος Ἀντιφάνους, τὸν Οἰωνιστήν, μεταγράψαι φησὶ τὸν Μένανδρον εἰς τὸν Δεισιδαίμονα.᾿ … ἀλλ᾿ ἵνα μὴ καὶ αὐτὸς κλοπῆς ἄλλους αἰτιώμενος κλέπτης ἁλῶ, τοὺς πραγματευσαμένους τὰ περὶ τούτων μηνύσω. Λυσιμάχου μέν ἐστι δύο Περὶ τῆς Ἐφόρου κλοπῆς, Ἀλκαῖος δέ, ὁ τῶν λοιδόρων ἰάμβων καὶ ἐπιγραμμάτων ποιητής, παρῴδηκε τὰς Ἐφόρου κλοπὰς ἐξελέγχων, Πολλίωνος δὲ ἐπιστολὴ πρὸς Σωτηρίδαν Περὶ τῆς Κτησίου κλοπῆς, τοῦ δ᾽ αὐτοῦ καὶ Περὶ τῆς Ἡροδότου κλοπῆς ἐστι βιβλίον καὶ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Ἰχνευταί πολλὰ περὶ Θεοπόμπου λέγεται, Ἀρητάδου τέ ἐστι Περὶ συνεμπτώσεως πραγματεία, ἐξ ὧν τοιαῦτα πολλὰ ἔστι γνῶναι. (frg. 408/409 Smith = Euseb. praep. evang. 10, 3, 12–13 u. 23)
(„Auf diese Worte des Nikagoras hin sagte Apollonios: ‘Was wundern wir uns also darüber, dass Theopomp und Ephoros von der Kleptomanie ergriffen wurden, zwei so träge Gesellen, wenn selbst Menander von dieser Krankheit befallen war, den der Grammatiker Aristophanes, weil er ihn allzu sehr verehrte, in den Parallelexzerpten, die er aus seinen Werken und den von ihm bestohlenen Schriftstellern anfertigte, nur ein bisschen schmähte. Latinos aber zeigte die ganze Menge seiner Plagiate auf in den sechs Büchern, die er Über das, was nicht von Menander stammt schrieb. Ebenso unternahm es auch Philostratos von Alexandria, ein Werk Über die Plagiate des Sophokles zu schreiben. Und Kekilios sagt – so als ob er eine große Entdeckung gemacht hätte –, dass Menander vom Anfang bis zum Ende ein ganzes Drama, den Augur des Antiphanes, zu seinem Abergläubigen umgeschrieben habe.’ … Doch um nicht selber als Ankläger von Plagiatoren des Plagiats überführt zu werden, möchte ich diejenigen Autoren, die zu diesen Fragen geschrieben haben, nennen. Von Lysimachos gibt es zwei Bücher Über die Plagiate des Ephoros; auch Alkaios, der Dichter von schmähenden Jamben und Epigrammen, brachte die Plagiate des Ephoros ans Licht und spottete über sie; von Pollion gibt es einen gegen Soteridas gerichteten Brief Über die Plagiate des Ktesias, vom selben Autor auch ein Buch Über die Plagiate Herodots, und viel über Theopomp steht auch in der Spürnasen betitelten Schrift; und von Aretades stammt das Werk Von den Übereinstimmungen – in diesen Schriften kann man viele Beispiele dieser Art finden.“)
Zumeist geht man davon aus, dass Porphyrios die Schrift noch während seiner Lehrzeit bei Kassios Longinos in Athen, also vor seinem Weggang nach Rom im Jahr 263 n. Chr., verfasst hat.5 Der erhaltene Abschnitt beschreibt eine Gastmahlszene, in der sich die beteiligten Sprecher (Grammatiker, Geometer, peripatetische und stoische Philosophen) über literaturkritische Fragen austauschen und, einer bei Symposien gerne geübten Praxis6 folgend, Autoren synkritisch miteinander vergleichen. Dabei kommen sie auch auf Plagiatsfragen zu sprechen. Im zitierten Ausschnitt belegen die Symposiasten ihre Behauptungen, indem sie auf einschlägige Spezialabhandlungen περὶ κλοπῆς verweisen.
Der größere Teil der von Porphyrios genannten Schriften befasst sich mit historischen Werken. Als ein Beispiel wird eine Schrift Περὶ τῆς Ἐφόρου κλοπῆς genannt.7 Die Lebenszeit ihres Autors Lysimachos lässt sich auf etwa 200 v. Chr. datieren.8 Soweit wir aus den überlieferten Nachrichten ersehen, muss das Werk als ein Nebenprodukt mythographischer Forschungen angesehen werden. Lysimachos verfasste umfangreiche Untersuchungen zu Reisesagen und eine Zusammenstellung von thebanischen Wundergeschichten.9 Seine Methode war die des mythologischen Vergleichs, der auch entlegene Gewährsmänner berücksichtigte und die verschiedenen Sagenvarianten durch Zitate mit genauen Quellenangaben dokumentierte. Im Zuge dieser Arbeiten wird er auch auf das universalhistorische Werk des Ephoros von Kyme gestoßen sein10, dem er – wenn man eine weitere Stelle bei Porphyrios auf Lysimachos zurückführt – besonders schwerwiegende Fälle von Plagiat nachweisen konnte, nämlich Übernahmen aus seinen Vorgängern im Umfang von bis zu dreitausend Zeilen.11 Mit Ephoros, der sich in seinen kompilatorischen Werken primär auf schriftliche Quellen stützte und deshalb als erster und prototypischer Vertreter des Buchgelehrten gilt, hatte Lysimachos natürlich eine geeignete Zielscheibe für seine Plagiatsvorwürfe gefunden.12 Der Kritikpunkt war dabei nicht die Benutzung fremden Materials an sich, denn für diese Praxis bot Lysimachos selbst das beste Beispiel, sondern die Absicht, unverändert übernommene wörtliche Zitate zu verschleiern, was er Ephoros mit dem Schlagwort κλοπή unterstellte. Diese Vorwürfe wurden in der zeitgenössischen Jambographie und Epigrammatik aufgegriffen, wie Porphyrios’ Hinweis auf Alkaios von Messene zeigt.13 Wie wir aus einer anderen Nachricht schließen können, dürften die unter dem Titel Συγκρίσεις gesammelten skoptischen Gedichte des Alkaios zumindest in Teilen der vergleichenden Methode gefolgt sein.14
Der zweite Gewährsmann für Plagiate im Bereich der Geschichtsschreibung ist ein gewisser Pollio, dem Porphyrios drei Titel zuweist.15 Die ersten beiden Schriften wiesen unstatthafte Entlehnungen bei den Historikern Ktesias (ἐπιστολὴ πρὸς Σωτηρίδαν περὶ τῆς Κτησίου κλοπῆς)16 und Herodot (τοῦ δ҆ αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς Ἡροδότου κλοπῆς ἐστι βιβλίον) nach. Auch bei der letzten Schrift, die den bezeichnenden Titel Ἰχνευταί (‘Spürnasen’) trug, standen wohl literarische Anleihen bei Geschichtsschreibern im Vordergrund (καὶ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Ἰχνευταί πολλὰ περὶ Θεοπόμπου λέγεται).
Im Falle Theopomps, dem Pollios Interesse im letztgenannten Werk galt, ist die eingehende Auseinandersetzung mit den historiographischen Vorgängern und Konkurrenten bekannt. Neben einer Epitome aus Herodot17 trat er mit seiner griechischen Geschichte in direkte stoffliche Konkurrenz zu Xenophon.18 Dass es dabei zu zahlreichen inhaltlichen Entsprechungen kam, die ein übelwollender Kritiker als Plagiat schmähen konnte, liegt nahe. Bei Ktesias und Herodot liegt die Sache allerdings anders. Diese beiden Autoren vertraten in ihren Werken ausdrücklich einen Originalitätsanspruch, der sich aus dem von ihnen proklamierten Ideal der αὐτοψία ergab. Beschreibenswert war demnach nicht, was andere bereits geschildert hatten, sondern das, was man mit eigenen Augen gesehen hatte.19 Trotzdem ist auch bei den diese Autoren betreffenden Plagiatsvorwürfen davon auszugehen, dass sie sich auf umfangreichere stoffliche Anleihen bezogen, was jedoch bei Herodot und Ktesias schwerer als bei Theopomp wiegen musste.20
Wie lässt sich der Autor aber chronologisch einordnen? Schon der Name des Pollio weist in die Kaiserzeit. Einen Datierungshinweis enthält außerdem die Angabe des Adressaten der Schrift über Ktesias. Es handelt sich bei Soteridas mit großer Wahrscheinlichkeit um den Vater der unter Nero lebenden Philologin Pamphila, von der wir wissen, dass sie neben anderen Geschichtswerken eine drei Bücher umfassende Epitome des Ktesias verfasst hatte.21 Die gelehrten Interessen der Tochter wären demnach bereits beim Vater vorgeprägt gewesen, dem in der biographischen Überlieferung eine Reihe von grammatischen Schriften zugewiesen wird.22
Wenn man vom Interesse der Tochter an Ktesias auf die literarischen Vorlieben des Vaters schließen darf, so wird man in πρὸς Σωτηρίδαν im Titel der Plagiatsschrift des Pollio eine polemische Absicht erkennen dürfen und den Ausdruck nicht als bloße Angabe des Widmungsträgers zu verstehen haben. Pollion dürfte mit seiner Schrift also die Absicht verfolgt haben, den von Soteridas geschätzten Ktesias als Plagiator bloßzustellen.23
Von der Schrift Περὶ συνεμπτώσεως πραγματεία des Aretades, die Porphyrios im Anschluss an Pollion erwähnt, können wir uns heute wohl keine nähere Vorstellung mehr machen.24 Immerhin begegnet die Vorstellung des συμπίπτειν gelegentlich im Zusammenhang mit Plagiatsfragen. Artemidoros von Daldis etwa erläutert in der Vorrede zum zweiten Buch der Traumdeutung seine wissenschaftliche Methode und weist nachdrücklich darauf hin, dass er unbeabsichtigte sachliche Übereinstimmungen mit seinen Vorgängern vermeiden möchte; in diesem Zusammenhang fällt der Begriff συμπίπτειν.25 Aretades hat demnach Parallelstellen verglichen, ohne dass man dabei eine polemische Tendenz gegen den bloßen Umstand der sachlichen oder sprachlichen Entsprechung annehmen dürfte. Wahrscheinlich hat Aretades nicht nur einen Autor behandelt, da er ja keine näheren Angaben im Titel macht; Porphyrios Einordnung der πραγματεία unter die Plagiatsschriften über Geschichtsschreiber legt aber immerhin eine entsprechende Gattungswahl bei Aretades nahe. Eine Datierung ins 2. Jhdt. v. Chr. erscheint zumindest plausibel.26
Wir greifen mit den behandelten fünf Titeln also einen Forschungszweig, der spätestens seit alexandrinischer Zeit bestand. Kein Anlass besteht zu der Annahme, dass die in einem Teil dieser Schriften artikulierten Plagiatsvorwürfe stilistische bzw. sprachliche Entlehnungen betrafen. Vielmehr tadelte man – wenn überhaupt eine polemische Tendenz zu erkennen ist – die dreisten Versuche der Geschichtsschreiber, sachliche Einzelinformationen bzw. ganze Abschnitte ohne Ausweis der Quelle zu übernehmen. Ein wie auch immer theoretisierter Begriff von literarischer imitatio o.Ä. spielt dabei keine Rolle.
Was lässt sich aber über die auf Dichter bezogenen Plagiatsschriften bei Porphyrios sagen? Zwei der genannten Werke behandelten Plagiate Menanders. Die Schrift des Aristophanes von Byzanz27 wird folgendermaßen umschrieben: ἐν ταῖς Παραλλήλοις αὐτοῦ τε καὶ ἀφ᾿ ὧν ἔκλεψεν ἐκλογαῖς. Es erscheint bedenklich, den Titel des Werks mit Παράλληλοι Μενάνδρου τε καὶ ἀφ᾽ ὧν ἔκλεψεν ἐκλογαί zu rekonstruieren, da der damit ausgedrückte κλοπή-Vorwurf der verschiedentlich bezeugten Hochachtung des alexandrinischen Grammatikers vor Menander widersprechen würde. Aristophanes sticht unter den alexandrinischen Gelehrten gerade wegen seiner Vorliebe für Menander hervor. Einmal lobt er in einem berühmten, bei Syrian erhaltenen Vers den Realismus Menanders28, ein andermal stellt er den Komödiendichter in einem inschriftlich überlieferten Epigramm sogar dem Homer an die Seite.29 Übrigens weist ja schon die Notiz des Porphyrios διὰ τὸ ἄγαν αὐτὸν φιλεῖν auf die positive Haltung des Aristophanes Menander gegenüber hin. Man rekonstruiert den überlieferten Titel also am besten als Παράλληλοι ἐκλογαί und weist den Einschub, der den eigentlichen Plagiatsvorwurf markiert (ἀφ᾿ ὧν ἔκλεψεν), dem Porphyrios zu.
Nimmt man den Titel der Schrift aber ernst, dann dürfte es sich um nichts weiter als um eine tendenzlose Sammlung von einzelnen Passagen bzw. sprichwörtlicher γνώμαι gehandelt haben, in denen Menander bewusst auf andere Autoren zurückgegriffen hat bzw. zufällig mit ihnen übereinstimmt.30 Dass Aristophanes dabei insbesondere ältere und zeitgenössische Komödienautoren im Blick hatte, liegt nahe.31 Solche sammelnd-vergleichenden Studien passen auch gut zu den sonst bezeugten Forschungsinteressen der alexandrinischen Philologie. Ob Aristophanes in seinen Παράλληλοι ἐκλογαί auch die Überlegenheit Menanders hervorheben wollte, muss dahingestellt bleiben. Jedenfalls stellt er sich nicht nur mit dieser Schrift32 in die Tradition gnomologischer Sammelwerke; eine polemische Tendenz im Sinne eines Plagiatsvorwurfs ist in diesem Fall aber auszuschließen.
Wir haben zumindest einen weiteren Hinweis, dass solche Parallelensammlungen auch in monographischer Form vorlagen. Ein Grammatiker namens Ptolemaios verfasste, wie wir aus dem zugehörigen Sudaartikel wissen, eine Sammlung ähnlicher Ausdrücke bei den Tragikern mit dem Titel Τὰ ὁμοίως εἰρημένα τοῖς Τραγικοῖς (= 79 frg. 1 Bagordo).33 Ptolemaios ist wohl in augusteische Zeit zu datieren.34 Jedenfalls hat er wie Aristophanes synkritische Studien betrieben und sich inhaltlich entsprechende Sentenzen (ὁμοίως εἰρημένα) zusammengestellt, ohne dabei freilich die Autorität der behandelten Tragiker – wohl eher die kanonische Trias als die spätere hellenistische Πλειάς – durch κλοπή-Vorwürfe in Frage zu stellen.
In der Schrift des Latinos, der in sechs Büchern Περὶ τῶν οὐκ ἰδίων Μενάνδρου schrieb, finden wir diesen Typus der alexandrinischen Parallelensammlung vielleicht schon ins Polemische gewendet.35 Der Inhalt der Schrift wird aus dem erklärenden Zusatz τὸ πλῆθος αὐτοῦ τῶν κλοπῶν ἐξέφηνε deutlich – wenn wir hier nicht wieder mit einer bewussten Umdeutung durch Porphyrios rechnen müssen: Es handelte sich offenbar um Plagiatsnachweise in tadelnder Absicht. Schon im Titel klingen die üblichen verbalen Umschreibungen zur Bezeichnung der tadelnswerten Aneignung fremden Guts an, die in den Plagiatsnachweisen bei Athenaios oder Klemens von Alexandrien verwendet werden.36 Auch Latinos weist sich durch seinen Namen eindeutig als kaiserzeitlicher Autor aus, allerdings gibt es keine weiteren Anhaltspunkte zur Datierung.37 Wenn Menander aber von Latinos aufgrund seiner sprachlichen Übereinstimmungen mit anderen Autoren tatsächlich kritisiert wurde, so handelt es sich um eine Einzelstimme.38 Der kanonische Rang des Dichters war zumindest seit augusteischer Zeit so unbestritten, dass man ihn sogar als stilistisches Vorbild für den angehenden Redner schätzte.39
Einen besonders interessanten Fall stellt die Schrift περὶ τῆς Σοφοκλέους κλοπῆς des Philostratos von Alexandria dar.40 In ihr scheint zum ersten Mal einer der spätestens seit Aristophanes von Byzanz als kanonisch erklärten Autoren41, also ein πραττόμενος, unter Plagiatsverdacht zu stehen. Sophokles hatte in der späthellenistischen Zeit Euripides als am höchsten geschätzter Tragiker abgelöst.42 Offenbar handelt es sich bei Philostratos um den aus Alexandrien stammenden Akademiker, der in der Gunst des Antonius und der Kleopatra stand und von dem eine Reihe von biographischen Informationen überliefert ist.43 Ein Papyrusfund aus dem Jahr 1943 erlaubt eine nähere Charakteristik der Schrift:44
ε[ἰ Ꞌ Σο]φοκ[λ]έους τὸ δρᾶμα [· λέ] Ꞌ γει γὰρ Φιλό[σ]τρατος ἐν τῷ λ[γ] πε[ρ]ὶ τῶν Σοφοκλ[έους] {τοδρ[α]μ[α]λεγει} κλοπῶν ὅ Ꞌ τι οὐκ ἔστι Σοφοκλέους
(„… wenn das Drama überhaupt von Sophokles ist. Philostratos sagt nämlich im 33. Buch seines Werks über die Diebstähle des Sophokles, dass es nicht von Sophokles ist.“)
Die Scholiennotiz eines anonymen Grammatikers aus dem 2. Jhdt. n. Chr. betrifft ein textkritisches Problem im pseudosophokleischen Ναύπλιος Πυρκαεύς. Vor dem eigentlichen Zitat stellt der Scholiast die Frage nach der Authentizität des Dramas und verweist dabei darauf, dass Philostratos im 33. Buch seines Werks über die Diebstähle des Sophokles behaupte, es stamme gar nicht von Sophokles. Zwei Gesichtspunkte sind in diesem Zusammenhang hervorzuheben: Zum einen der schiere Umfang des Werks von über 33 Büchern, mit dem die Schrift sogar die voluminöse Sammlung des Latinos um mehr als das fünffache übertrifft. Zum anderen überrascht der Inhalt des Werks, in dem es offensichtlich auch um Fragen der Pseudepigraphie ging.45
Eine nicht bei Eusebios bezeugte Schrift, bei der man bislang ebenfalls meist davon ausgegangen ist, dass es sich um eine polemische Plagiatsschrift gehandelt haben muss, ist auf der Basis des bisher Ausgeführten noch zu prüfen. Es handelt sich um das ins 2. Jhdt. zu datierende Werk des Ammonios, von dem bei Ps.-Longinus und in den Homerscholien46 die Rede ist: Ammonios hätte demnach sprachliche Anleihen an Homer bei Platon gesammelt.47 Ps.-Longinus schreibt, er könne auf einen detaillierten Nachweis der sprachlichen Bezugnahmen Platons auf Homer verzichten, weil diese schon von Ammonios herausgesucht und verzeichnet wurden.48 Dem anonymen Autor geht es hier darum zu zeigen, dass Entlehnungen kein Diebstahl (κλοπή) sind, sondern einer inspiratorischen Wirkung der älteren Dichter auf ihre Leser entspringen. Für unseren Zusammenhang ist wichtig, dass sich auch aus der Erwähnung dieser Schrift keine polemische Haltung des Ps.-Longinus gegen Ammonios ergibt: Der Autor wollte Platon nicht etwa gegen einen von Ammonios erhobenen Plagiatsvorwurf verteidigen, sondern wendet sich gegen eine Fehlinterpretation des gesammelten Parallelenmaterials. Aus seiner Erwähnung bei Ps.-Longinus kann also nicht abgeleitet werden, dass Ammonios in seiner Schrift Plagiatsvorwürfe gegen Platon erhob.49 Vielmehr wird man sie zu dem Typ der Parallelensammlung rechnen, dem wir schon bei Aristophanes von Byzanz begegnet sind.50