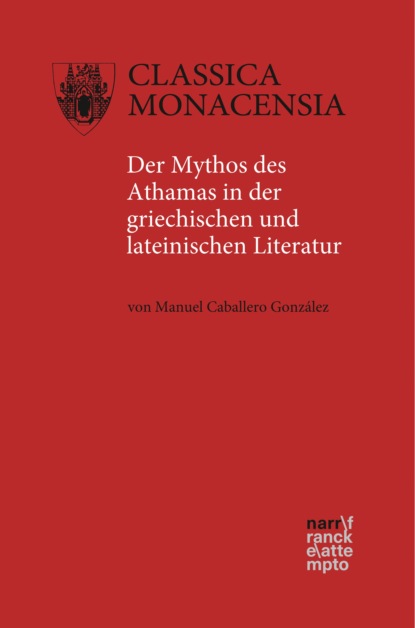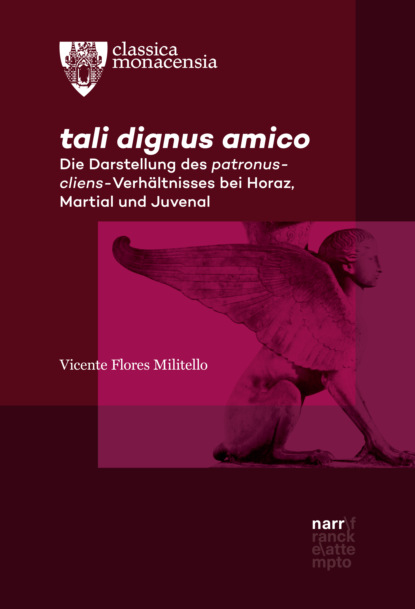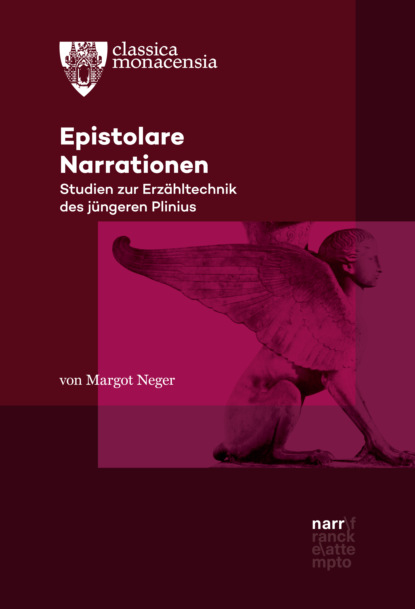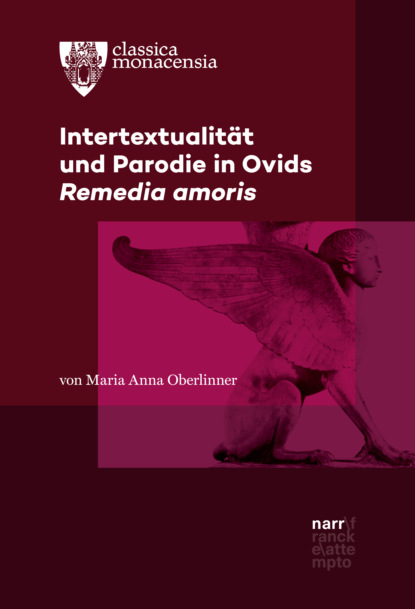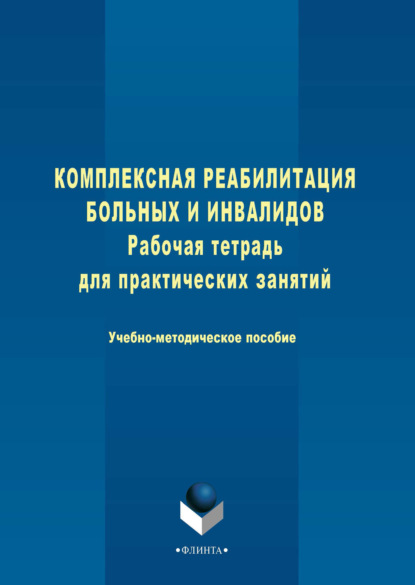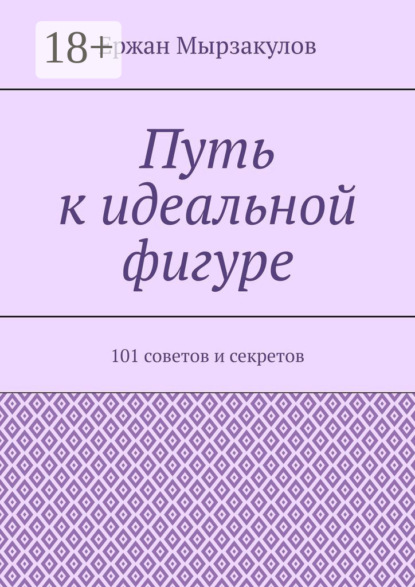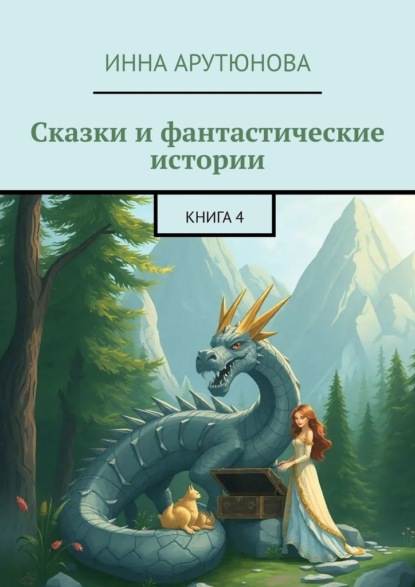Homer und Vergil im Vergleich
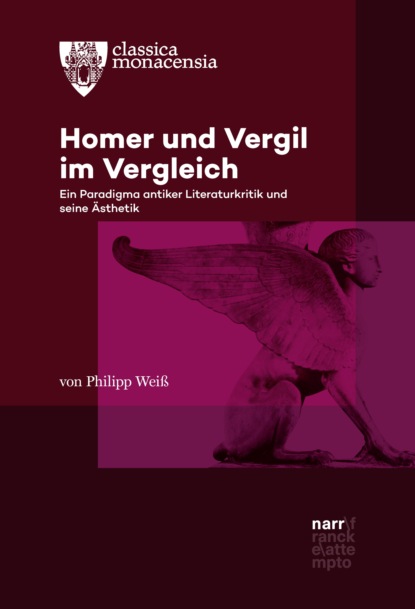
- -
- 100%
- +
Vor welchem Hintergrund trifft Seneca d.Ä. bzw. Maecenas aber nun sein stilkritisches Urteil, wenn er die fragmentierten Wendungen des Dorion, die er zitiert, als tumidum bzw. inflatum bezeichnet? Betrachten wir zur Beantwortung dieser Frage den stilkritischen Kontext, in dem die homerische Kyklopenepisode steht, um die spezifischen Herausforderungen, die sich einem Homernachahmer hier stellten, näher zu bestimmen.Demetrioseloc. 115
Der Passus über den frostigen Stil (τὸ ψυχρόν) aus der Schrift περὶ ἑρμηνείας, die unter dem Namen des Demetrius überliefert ist und meist ins 1. Jhdt. v. bzw. n. Chr.12 datiert wird, führt bei der theoretischen Standortbestimmung weiter. Für Demetrios ist der frostige Stil als korrespondierende Fehlausprägung zum erhabenen Stil (χαρακτὴρ μεγαλοπρεπής)13 entsprechend in drei Bereiche zu unterteilen, nämlich in ‘Frostigkeit’ hinsichtlich der Gedanken (διάνοια)14, hinsichtlich der Wortwahl (λέξις)15 und hinsichtlich der Wortfügung (σύνθεσις)16. Um seine Ausführungen zum ψυχρόν im Bereich der διάνοια zu belegen, wählt Demetrios ein Beispiel, das den bei Seneca d.Ä. zitierten Wendungen des Dorion auffallend ähnelt:
Γίνεται μέντοι καὶ τὸ ψυχρὸν ἐν τρισίν, ὥσπερ καὶ τὸ μεγαλοπρεπές. ἢ γὰρ ἐν διανοίᾳ, καθάπερ ἐπὶ τοῦ Κύκλωπος λιθοβολοῦντος τὴν ναῦν τοῦ Ὀδυσσέως ἔφη τις· φερομένου τοῦ λίθου αἶγες ἐνέμοντο ἐν αὐτῷ. ἐκ γὰρ τοῦ ὑπερβεβλημένου τῆς διανοίας καὶ ἀδυνάτου ἡ ψυχρότης. (Demetr. eloc. 115 = 28, 3–7 Radermacher.)
(„Der frostige Stil entsteht aus drei Ursachen, wie auch der hohe. Die eine liegt im Gedanken, so wie einer bei der Beschreibung des Kyklopen, der Steine auf das Schiff des Odysseus wirft, gesagt hat: ‘Während der Stein flog, weideten noch Ziegen darauf.’ Die Frostigkeit entsteht auch durch den übertriebenen Gedanken und das Unmögliche.“)
Man hat wegen der inhaltlichen Nähe sogar angenommen, dass es sich bei den von Demetrios angeführten Worten um ein weiteres Zitat aus Dorions Homermetaphrase handelt.17 Die Darstellung von sachlich nicht nachvollziehbaren und somit unglaubwürdigen Begebenheiten – wie hier der Vorstellung, der vom Kyklopen geworfene Stein sei so groß gewesen, dass noch Ziegen darauf weiden konnten – wird bei Demetrios jedenfalls für die besagte ‘frostige’ Wirkung verantwortlich gemacht.Demetrioseloc. 124–127
Bei den anschließenden Ausführungen zur Übertreibung (ὑπερβολή) in eloc. 124–127 = 29, 25–30, 14 Radermacher wird dem Aspekt des ἀδύνατον dann sein systematischer Ort zugewiesen: Die Hyperbole hält Demetrios für die schlimmste Ausprägung des frostigen Stils, und macht für sie neben dem Vergleich (καθ’ ὁμοιότητα; Bsp.: Il. 10, 437: θείειν δ’ ἀνέμοισιν ὁμοῖοι „im Lauf wie die Winde“) und der Überbietung (καθ’ ὑπεροχήν; Bsp.: Il. 10, 437: λευκότεροι χιόνος „weißer als Schnee“) das besagte Unmögliche (κατὰ τὸ ἀδύνατον; Bsp.: Il. 4, 443: οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει „sie stemmte das Haupt gegen den Himmel“) als Quelle aus.18
Was hat man sich unter der Darstellung unmöglicher Sachverhalte genau vorzustellen und welcher Stellenwert kommt diesen ἀδύνατα in der epischen Dichtung zu? Ein Abschnitt in der Poetik des Aristoteles gibt hier nähere Auskunft. Bekanntlich entwickelt Aristoteles seine Theorie vom Epos, indem er sie kontrastiv der zuvor dargelegten Tragödientheorie gegenüberstellt und besonders auf die Unterschiede der beiden Dichtungsformen eingeht.Aristotelespoet. 1460a11–b2 Eine der sechs Hauptunterschiede besteht in der Verwendung des Wunderbaren (τὸ θαυμαστόν)19, für das er das Ungereimte (τὸ ἄλογον) als Hauptquelle identifiziert.20 Für Aristoteles gilt die anthropologische Grundannahme, dass das Wunderbare Gefallen erregt.21 Im neunten Kapitel hatte er ausgeführt, dass der Tragödiendichter seine bekannten Wirkungsabsichten vor allem durch überraschende Handlungsverläufe erreichen kann, wobei die innere Logik der handelnden Charaktere, d.h. die Wahrscheinlichkeit, gewahrt bleiben muss. Das ist ein Hinweis auf die Funktion, die dem θαυμαστόν zugewiesen wird: Das Wunderbare soll die Aufmerksamkeit des Publikums erwecken, um dem gewünschten psychologischen Effekt zu umso größerem Durchschlag zu verhelfen.22 Wenn Aristoteles nun auf das Staunenswerte im Epos zu sprechen kommt, so geht es ihm nicht um diese eindeutig als positiv gewerteten überraschenden Handlungsverläufe, sondern um tatsächliche logische Inkonsistenzen, die aber um ihrer Wirkung willen erlaubt sind und denen er besonders in der epischen Dichtung einen Platz einräumt, weil der epische Dichter nicht auf die besonderen realistischen Erfordernisse des Bühnengeschehens Rücksicht zu nehmen hat.23 Im Epos hat das Widersprüchliche seinen Platz, insofern es nur die beabsichtigte überraschende Wirkung erreicht. Aristoteles zitiert einige Beispiele für Inkonsistenzen im Drama und im Epos, u.a. aus der Odyssee.24 Als wichtigstes Kriterium gilt dabei, dass der epische Dichter den Eindruck der Wahrscheinlichkeit erweckt, auch wenn er – was Aristoteles freilich eigentlich ablehnt – eine inkonsistente Handlungsabfolge konstruiert hat.25
Eng mit der Frage, welche sachlichen Unstimmigkeiten ein Dichter in Kauf nehmen darf, hängt die Vorstellung zusammen, dass der Poesie anders als etwa der Geschichtsschreibung eine besondere Freiheit (ποιητικὴ ἐξουσία) zustände.26IsokratesEuag. 9–10 Die Idee ist bereits bei Isokrates zum Ausdruck gebracht, der im Euagoras die Unterschiede zwischen Prosaautoren und Dichtern sowohl auf der Ebene der Gedanken – Gegenstand der Dichtung sind etwa die Handlungen der Götter – wie auch auf der der Sprache festmacht: Den Dichtern werden auf beiden Gebieten Sonderrechte zugestanden.27 Der Terminus ποιητικὴ ἐξουσία bzw. ἄδεια wird zwar meist gebraucht, um morphologische oder stilistische Idiosynkrasien zu bezeichnen.28 Doch beruft man sich auch auf ποιητικὴ ἐξουσία, wenn es gilt, sachliche Ungenauigkeit oder Widersprüche bei Dichtern zu entschuldigen. Polybios etwa unterscheidet in dem bei Strabo 1, 2, 17 überlieferten Fragment zwischen μεταβολή (zufällig unterlaufene Vertauschung), ἄγνοια (Unkenntnis) und ποιητικὴ ἐξουσία (bewusst in Anspruch genommene dichterische Freiheit), um sachliche Ungereimtheiten bei Dichtern zu erklären.29 Auch andere Ausdrücke in den Scholien verweisen auf Erklärungen dieser Art, wie etwa der Hinweis auf ποιητικὴ ἀρεσκεία oder darauf, dass der Dichter etwas κατ’ ἐπιφοράν („ohne ersichtlichen Grund“) gesagt habe.
Ein aufschlussreiches Beispiel für einen Fall von dichterischer Lizenz – ebenfalls in der homerischen Kyklopenepisode – gibt die Diskussion über die IterataHomerOd. 3, 72–74 Od. 3, 72–74 undHomerOd. 9, 253–255 Od. 9, 253–255. Aristarch begründete seine Entscheidung, die zweite Stelle als ursprünglich homerisch anzuerkennen und deshalb allein in den Text aufzunehmen gegen Aristophanes von Byzanz mit dem Argument, dass die Worte Nestors, der Telemachos und Peisistratos gefragt hatte, ob sie etwa Piraten seien, entgegen der Meinung des Aristophanes nicht in den Kontext von Od. 3 passten. Bei der zweiten Stelle hingegen ergäben sich zwar auf den ersten Blick einige Widersprüche, doch müsse man dabei die Freiheit des Dichters in Rechnung stellen und die Verse anerkennen:
ὁ δὲ Ἀρίσταρχος οἰκειότερον αὐτοὺς τετάχθαι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ Κύκλωπός φησιν· οὐδὲ γὰρ νῦν οἱ περὶ Τηλέμαχον λῃστρικόν τι ἐμφαίνουσι. δοτέον δέ – φησί – τῷ ποιητῇ τὰ τοιαῦτα· καὶ γὰρ ναῦν αὐτὸν παράγει εἰδότα, “ἀλλά μοι εἴφ’ ὅπη ἔσχες ἰὼν εὐεργέα νῆα” [ι 279], καὶ συνίησιν Ἑλληνίδα φωνήν. (schol. DHMa ad Od. 3, 71a = II 30, 6–10 Pontani)
(„Aristarch aber sagt, dass man sie passender in die Rede des Kyklopen einfügt. Hier nämlich erwecken Telemachos und seine Gefährten nicht den Anschein, als wären sie Piraten. Er sagt, man müsse dem Dichter das zugestehen: Er lässt ihn ja auch das Schiff kennen, ‘Sage mir aber, wo du dein gut gebautes Schiff hast’, und er versteht die griechische Sprache.“)
Daneben kann sich die Freiheit des Dichters auch auf weitere Bereiche beziehen, etwa auf die Möglichkeit, tradierte Mythen abzuwandeln und den Erfordernissen der eigenen Dichtung anzupassen, oder auf eine spezifische Freizügigkeit, wenn sich der Dichter an die Götter wendet.30 Die zahlreichen diesbezüglichen Scholiennotizen und das breite Anwendungsfeld der Kategorie der dichterischen Freiheit dürfen dabei aber nicht den Eindruck erwecken, dass den Dichtern tatsächlich alles erlaubt war. Die Zeugnisse geben vielmehr zu erkennen, dass die Grenzen der Freiheit dichterischer Darstellung ein notorisches Thema kritischer Diskussionen war: Nicht alles war den Dichtern erlaubt und das Diktum des Eratosthenes ἀλλ’ ἔξεστι πλάττειν τοῖς ποιηταῖς ἅ βούλονται („und die Dichter dürfen gestalten, was sie wollen“)31 darf – wie auch aus den gleich zu zitierenden Stimmen zur homerischen Kyklopenszene zu ersehen – nicht als repräsentativ für die antike Literaturkritik angesehen werden.32
Auch in der Kyklopenepisode in der Odyssee wurde nämlich eine stilistische Entgleisung hinsichtlich der Plausibilität der Handlung diagnostiziert. Am deutlichsten stellt Hermogenes, der Autor verschiedener Schriften über Teilgebiete der Rhetorik33, in seinem Traktat περὶ εὑρέσεως im Kapitel über das κακόζηλον34 die Anstößigkeit des Kyklopensteinwurfs in Od. 9, 481 heraus – und belegt dabei gleichzeitig die Popularität und Exemplarität der Verse als Schulbeispiel für eine unrealistische Darstellung. Das Hauptproblem ist demnach darin zu sehen, dass die Darstellung durch ihre Übertreibungen unglaubwürdig (ἄπιστον) wird. Hermogenes gibt verschiedene Gründe an, warum man eine Stelle als κακόζηλον verwerfen konnte:Hermogenesinv. 4, 12
Τὸ δὲ κακόζηλον γίνεται ἢ κατὰ τὸ ἀδύνατον ἢ κατὰ τὸ ἀνακόλουθον, ὃ καὶ ἐναντίωμά ἐστιν, ἢ κατὰ τὸ αἰσχρὸν ἢ κατὰ τὸ ἀσεβὲς ἢ κατὰ τὸ ἄδικον ἢ κατὰ τὸ τῇ φύσει πολέμιον, καθ’ οὓς τρόπους καὶ ἀνασκευάζομεν μάλιστα τὰ διηγήματα ἐκβάλλοντες ὡς ἄπιστα. (Hermog. inv. 4, 12 = 202, 4–8 Rabe)
(„Der Stilfehler [τὸ κακόζηλον] entsteht entweder durch die Darstellung von Unmöglichem [τὸ ἀδύνατον] oder von Unzusammenhängendem [τὸ ἀνακόλουθον], was dann auch ein Widerspruch [τὸ ἐναντίωμα] ist, oder durch die Darstellung von etwas Hässlichem [τὸ αἰσχρὸν] oder etwas Gottlosem [τὸ ἀσεβὲς] oder von etwas Unrechtem [τὸ ἄδικον] oder von etwas, das der Natur widerspricht [τὸ τῇ φύσει πολέμιον]. Diesen Gesichtspunkten folgend verwerfen wir bestimmte Erzählungen, indem wir sie als unglaubhaft aussondern.“)
Der zuletzt genannte Vorwurf der Unglaubwürdigkeit dichterischer Darstellung ist für Hermogenes der entscheidende: Das Kriterium der Plausibilität (τὸ εἰκός) erlaubt ein Urteil darüber, ob eine dichterische Unternehmung (διασκευή) als akzeptabel gewertet werden kann oder nicht.35
Um einen gewagteren, die Grenzen der Glaubwürdigkeit überschreitenden Gedanken dennoch zu formulieren, aber zugleich dem Vorwurf des κακόζηλον zu entgehen, schlägt Hermogenes als Strategie die Vorbereitung (προκατασκευή bzw. προθεραπεία) durch den Dichter vor:Hermogenesinv. 4, 12
Ἰστέον μέντοι, ὅτι τὰ κακόζηλα ἔστι πολλάκις ἰᾶσθαι τῇ προκατασκευῇ καὶ προθεραπείᾳ· τὰ γὰρ προμαλαχθέντα τῇ ἑρμηνείᾳ νοῦν εἰσάγει, ὅθεν καὶ τὸ τόλμημα προσδοκᾶται τοῖς ἀκούουσιν, ὃ καὶ πρὶν λεχθῆναι ἀσφαλὲς εἶναι δοκεῖ, γυμνὸν δ’ ἂν τεθῇ πρὸ τῆς κατασκευῆς τοῦ λόγου, κακόζηλον ἔδοξεν ἢ τῷ νῷ ἢ τῷ λόγῳ. (Hermog. inv. 4, 12 = 202, 16–203, 1 Rabe)
(„Man muss freilich wissen, dass Stilfehler [κακόζηλα] häufig durch Vorbereitung [προκατασκευή] und Vorsorge [προθεραπεία] geheilt werden: Was nämlich durch die Wortwahl vorher abgeschwächt wurde, erregt einen Gedanken, von dem seitens der Hörer ein Wagnis erwartet wird, das, noch bevor es ausgesprochen wurde, den Anschein der Glaubwürdigkeit erweckt, wenn es aber ungeschützt gesagt wurde, bevor noch die Rede entsprechend ausgerüstet wurde, so erscheint es entweder als gedankliches oder sprachliches κακόζηλον.“)
Um dies zu illustrieren, zitiert Hermogenes die Kyklopenepisode aus der Odyssee:
καὶ σκόπει, πῶς καὶ Ὅμηρος ἐποίησεν· ὡς γὰρ λέξειν ἔμελλεν: ‘ἧκε δ’ ἀπορρήξας κορυφὴν ὄρεος μεγάλοιο’ <Od. 9, 481>, φοβούμενος τούτου τὸ ἀδύνατον προκατασκευάζει τοιοῦτον ἄνδρα τῷ λοιπῷ διηγήματι, ὡς μηδὲ τὸν περὶ τούτου λόγον ἄπιστον καταστῆναι λεχθέντα, τῷ τε τροφὰς αὐτῷ παραθεῖναι μείζονας ἢ κατὰ ἄνθρωπον τῷ τε ἀποδοῦναι αὐτῷ ῥόπαλον βαστάζειν, οἷον οὐκ ἄνθρωπος, καὶ λίθον καὶ τῷ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ διελθεῖν ὡς μεγάλην καὶ φοβερὰν καὶ τῷ εἰπεῖν ‘οὐδὲ ἐῴκει | ἀνδρί γε σιτοφάγῳ, ἀλλὰ ῥίῳ ὑλήεντι’ <Od. 9, 190–191>· πάντες γὰρ οἱ περὶ τούτου προγυμνασθέντες λόγοι πιστὸν ἐποίησαν εἶναι δοκεῖν τὸ παράδοξον τὸ περὶ τοῦ Κύκλωπος ῥηθὲν τὸ ‘ἧκε δ’ ἀπορρήξας κορυφὴν ὄρεος μεγάλοιο’ <Od. 9, 481>· εἰ γὰρ καὶ τοιοῦτος ἦν, οἷον αὐτὸν προκατεσκεύαζεν, οὐδὲν ἦν τὸ καὶ τοιοῦτον αὐτὸν ποιῆσαι δυνηθῆναι. (Hermog. inv. 4, 12 = 203, 1–18 Rabe)
(„Und schau, wie auch Homer das bewerkstelligt hat. Er wollte nämlich sagen ‘er riss ab die Kuppe von einem großen Berg’, fürchtete aber die Unmöglichkeit dabei und leitete deshalb in der restlichen Erzählung auf einen solchen Mann hin, sodass das, was über ihn gesagt wurde, nicht unglaubwürdig würde, indem er ihm nämlich Nahrung zuwies, die über das Menschenmaß ging, und indem er ihn eine Keule tragen ließ, die kein Mensch tragen könnte, und einen Stein, und indem er seine Gestalt als groß und furchteinflössend beschrieb, und indem er sagte: ‘und er glich nicht einem brotessenden Manne, sondern einer bewaldeten Felsenkuppe’. Alle diese vorbereitenden Reden aber über ihn bewirkten, dass das Paradoxon, das vom Kyklopen ausgesagt wurde, nämlich ‘er riss ab die Kuppe von einem großen Berg’, glaubhaft erscheine. Wenn er nämlich so war, wie er ihn vorbereitend geschildert hatte, so war es für ihn ein Leichtes, etwas von dieser Art tun zu können.“)
Vorbereitung durch den Dichter – Hermogenes verwendet nicht den üblichen Terminus προδιόρθωσις36 – kann also dem Eindruck mangelnder Glaubhaftigkeit vorbeugen.37 Eben diese vorbereitende Strategie identifiziert nun ein Scholion zuHomerOd. 9, 187 Od. 9, 187, wo eine Beschreibung des Kyklopen gegeben wird:
ἔνθα δ’ ἀνὴρ] εἰκότως προσυνίστησι τὸ μέγεθος, ἵνα ἀξιόπιστος φανῇ τὰ <Od. 9, 287–293> δύο σώματα σιτούμενος. πλείστας δὲ παραβολὰς ποιεῖται τοῦ μεγέθους αὐτοῦ. διὸ καὶ ὄρει ἄνθρωπον εἴκασεν ὡς ὑπερβάλλοντα παντὸς ζῴου μέγεθος, καὶ οὐδ’ ὄρει ἁπλῶς, ἀλλὰ <Od. 9, 191> ῥίῳ ὑλήεντι, ὅ ἐστιν ὄρει τῷ ὑψηλοτέρῳ καὶ τούτῳ ὑλήεντι. τοῦτο δέ ἐστιν ὑπερβολὴ ὑπερβολῆς. (schol. Q ad Od. 9, 187 = 421, 10–15 Dindorf)
(„Seine Größe stellt er im Voraus dar, wobei er Wahrscheinlichkeit erzeugt, nämlich damit es glaubwürdig erscheint, dass er zwei Menschenleiber frisst. Die meisten Gleichnisse macht er bezüglich der Größe. Deswegen vergleicht er auch einen Menschen mit einem Berg, weil er die Größe jedes Lebewesens übertrifft, und nicht einfach mit einem Berg, sondern mit einem bewaldeten Gipfel, also mit einem höheren und bewaldeten Berg. Das ist die Übertreibung der Übertreibung.“)38
Homer hat demnach den an sich anstößigen, weil unrealistischen Gedanken vom losgerissenen Berggipfel durch den Gang der Erzählung und die vorbereitenden Schilderungen des Kyklopen, die dem Publikum die übermenschliche Kraft Polyphems eindrucksvoll vor Augen gestellt hatten, erträglich gemacht.39 Das war möglich, weil Homer sein Kyklopenabenteuer in einem langen, beinahe das ganze neunte Buch der Odyssee umfassenden Narrativ entwickelt. Bei der ersten von Seneca d.Ä. bzw. Maecenas zitierten Vergilstelle stellen sich die Dinge hingegen anders dar: Acmon ist eine Nebenfigur, außer den wenigen in Aen. 10, 127–129 gegebenen Information erfahren wir nichts weiter von ihm – eine umständliche Vorbereitung wie bei Homer war hier nicht möglich. Vergil musste den hyperbolischen Gedanken durch die Litotes haud partem exiguam montis abschwächen, um dem Vorwurf eines Stilfehlers zu entgehen.
Dass auch bei der zweiten von Seneca d.Ä. bzw. Maecenas zitierten Vergilstelle eine stilistische Steigerung vorliegt, wurde schon in der Antike vermerkt. Quintilian zitiertQuintilianinst. 8, 6, 68 in inst. 8, 6, 68 die Verse Aen. 8, 691–692 als Beispiel für eine Hyperbel (= decens veri superiectio; vgl. Quint. inst. 8, 6, 67), ohne dass er dabei aber einen negativen Hyperbelbegriff zugrundelegt.40 Auch bei Quintilian wird die fides, die Wirklichkeitstreue, als die sensible Bezugsgröße eingeführt, gegen die die Hyperbel tendenziell verstößt.41 Ähnlich wie Seneca d.Ä., der eigens hervorhebt, dass es sich bei den Schiffen nicht tatsächlich um Inseln gehandelt habe und Vergil die imaginäre Qualität seines Vergleichs durch credas hinreichend markiert habe, ordnet Quintilian die Vergilstelle in seiner Typologie der Formen der Hyperbel der Kategorie per similitudinem zu und bringt damit zum Ausdruck, dass der Gleichniswert des Bildes erhalten bleibt.42 Seneca d.Ä. bzw. Maecenas hingegen verteidigt Vergil mit dem Hinweis auf die legitime Strategie der προδιόρθωσις, wenn er in credas eine Vorbereitung des Hörers auf einen unter handlungslogischen Gesichtspunkten problematischen, hinsichtlich seiner Wirkung aber effektvollen Gedanken erkennt: propitiis auribus accipitur, quamvis incredibile sit, quod excusatur antequam dicitur.
3.2.2 Ein Urteil Ovids und die Kategorie der psychologischen πιθανότης (contr. 7, 1, 27)
Seneca d.Ä. gibt keine systematische Übersicht über die Kriterien gelungener Nachahmung, sondern legt seinen Söhnen die ästhetischen Grundbegriffe, denen er folgt, anhand von Einzelbeispielen dar. Vergil wird dabei durchweg als stilistisches Muster vorgestellt, der die Kunst der Nachahmung in vorbildhafter Weise repräsentiert.1 So auch in contr. 7, 1, 27, wo der von Seneca d.Ä. hoch geschätzte Julius Montanus auf eine Vergilimitation des Cestius zu sprechen kommt. Zwar handelt es sich hierbei nicht um einen Homer-Vergil-Vergleich im engeren Sinne, doch sind, wie noch zu zeigen sein wird, das homerische Modell und die daran anschließenden kritischen Diskussionen bei den besprochenen Texten präsent, sodass eine Behandlung in unserem Zusammenhang geboten erscheint.
In contr. 7, 1 verlangte der Fall die Schilderung einer nächtlichen Meeresszenerie.2 Cestius3 hatte sich daran versucht, doch mangelte es dem Deklamator, der kein lateinischer Muttersprachler war, nach dem Urteil Senecas d.Ä. an der copia verborum.4 Dieser Umstand hinderte seinen Redefluss insbesondere dann, wenn er sich mit den großen literarischen Vorbildern messen wollte. In contr. 7, 1, 27 wird dies an einem Beispiel vorgeführt. Cestius schildert in einer narratio die Stille der Nacht: nox erat concubia, et omnia luce canentia sideribus muta erant („Tiefe Nacht war, und alles, was bei Tageslicht sang, schwieg
Soleo dicere vobis Cestium Latinorum verborum inopia
Gewöhnlich wird Ovids Vorschlag, den zweiten Halbvers bei Varro zu streichen, mit Verweis auf die auf diese Weise erzielte brevitas (= durch Kürzung verstärkte stilistische Prägnanz) erklärt.7 Zweifel an dieser einfachen Erklärung weckt aber schon die Präsentation durch Seneca d.Ä., der als unterscheidendes Merkmal zwischen Varro und Ovid herausstellt, dass in den beiden Versionen jeweils ein anderer Gedanke zum Ausdruck gebracht wird (Varro quem voluit sensum optime explicuit; Ovidius in illius versu suum sensum invenit). Seneca d.Ä. bescheinigt Ovid also geradezu das Gegenteil, nämlich den stilistisch gelungenen Ausdruck eines anderen Gedankens (optime explicuit). Lassen sich also alternativ anstelle der bislang vermuteten stilistischen auch sachliche Gründe für die Änderung ausmachen? Um dieses Frage zu beantworten, sind die Prätexte, auf die Varro und Vergil bei ihren Nachtschilderungen zurückgreifen – insbesondere Apollonios und Homer – und die Zeugnisse für die daran anschließende kritische Diskussion heranzuziehen. Auch hier wird eine präzise definierbare und bereits in der Antike reflektierte Schwachstelle in den Vorlagen auszumachen sein, welche eine genauere Bestimmung der ästhetischen Herausforderung, der sich die Imitatoren jeweils gegenübersahen, und einen besseren Nachvollzug ihrer Entscheidungen erlaubt.
Zunächst ist von der Vorlage Varros, der entsprechenden Stelle in den Argonautika des Apollonios Rhodios, auszugehen und zu ermitteln, welchen dichterischen Erfordernissen der hellenistische Epiker bei seiner Nachtschilderung zu genügen hatte. Apollonios’ Darstellung lässt den Einfluss der kritischen Auseinandersetzung mit bestimmten homerischen Nachtszenen, nämlich mit denen am Beginn des zweiten und zehnten Buches der Ilias, erkennen. Doch betrachten wir zunächst die Schilderung des Apollonios im ZusammenhangApollonios3, 744–748 (Apoll. Rhod. 3, 744–748):
νὺξ μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἄγεν κνέφας: οἱ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ | ναῦται εἰς Ἑλίκην τε καὶ ἀστέρας Ὠρίωνος | ἔδρακον ἐκ νηῶν: ὕπνοιο δὲ καί τις ὁδίτης | ἤδη καὶ πυλαωρὸς ἐέλδετο: καί τινα παίδων | μητέρα τεθνεώτων ἀδινὸν περὶ κῶμ᾽ ἐκάλυπτεν: | οὐδὲ κυνῶν ὑλακὴ ἔτ’ ἀνὰ πτόλιν, οὐ θρόος ἦεν | ἠχήεις, σιγὴ δὲ μελαινομένην ἔχεν ὄρφνην …
(„Die Nacht nun brachte Dunkelheit über die Erde, und die Seeleute auf dem Meer blickten von ihren Schiffen zum Großen Bären und zum Sternbild des Orion; auf Schlaf hoffte auch schon mancher Wanderer und Türhüter; selbst manche Mutter, deren Kinder gestorben waren, umfing tiefer Schlaf. Auch Hundegebell war in der Stadt nicht mehr zu hören, und auch kein Geräusch von Stimmen: Schweigen herrschte in dem schwärzer werdenden Dunkel.“ ÜS Glei/Natzel-Glei)
Im zitierten Passus werden, bevor die Sprache auf Medea selbst kommt, eine Reihe von Personengruppen genannt, die nachts keine Ruhe finden. Es scheint, dass Apollonios schrittweise von der sorgsamen Wachsamkeit der Seeleute über die Schläfrigkeit der Wanderer und Türhüter zu den „vom Schlaf eingehüllten“ Müttern, die ihre Kinder verloren haben, fortschreitet, das allmähliche Einschlafen der ganzen Welt also dichterisch nachzuvollziehen versucht.8 Alle, die zuvor noch von Sorgen gequält waren, umfängt nach und nach tiefer Schlaf; nur Medea, die kontrastiv am Ende der Reihe steht, bleibt wach. Apollonios verleiht mit dieser narrativ steigernd strukturierten Darstellung den Sorgen der Verliebten besonderen Nachdruck: Das nächtliche Schweigen hat eine solche Gewalt9, dass ihm eigentlich niemand widerstehen kann. Medea hingegen ist von einer solchen inneren Unruhe gequält, dass sie sogar der Macht des Schlafes standhält.