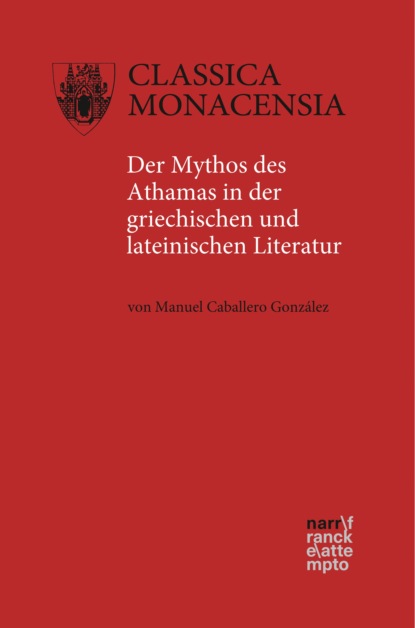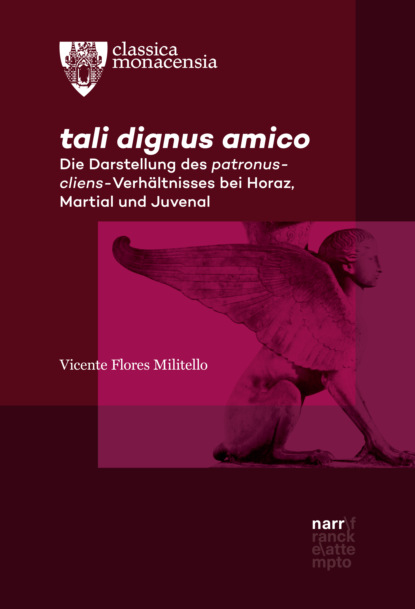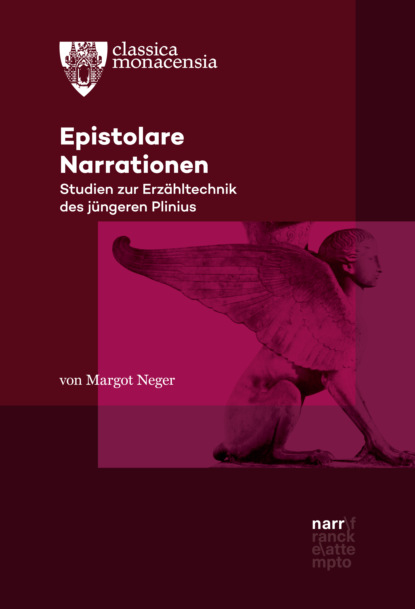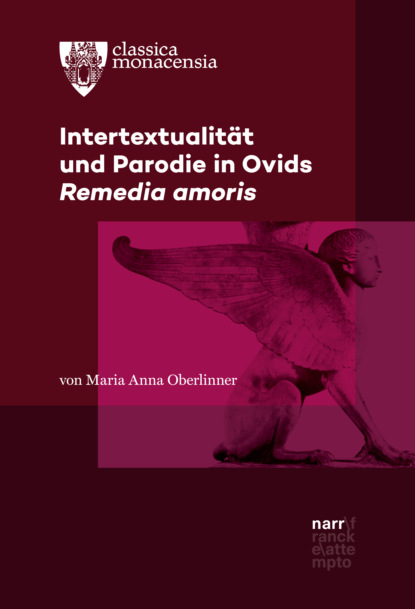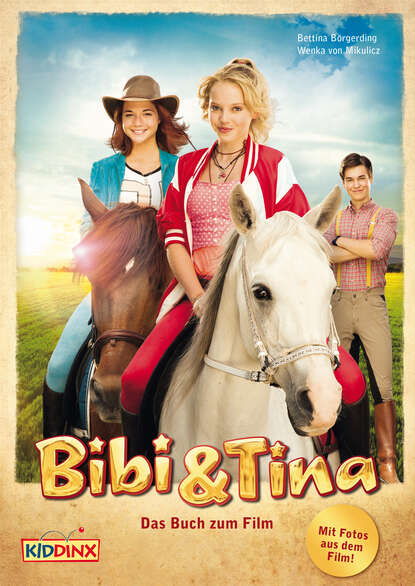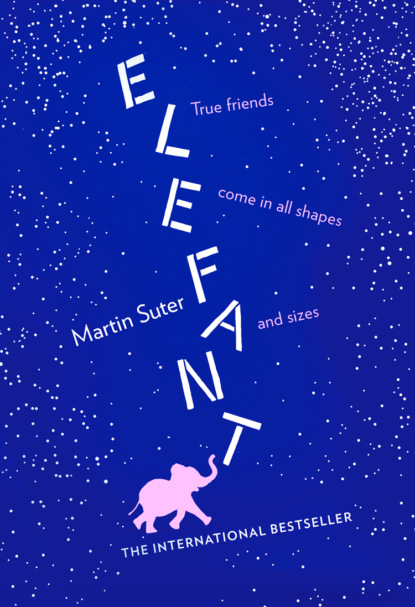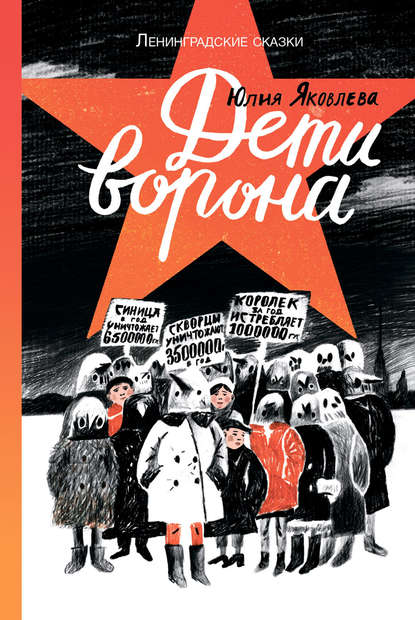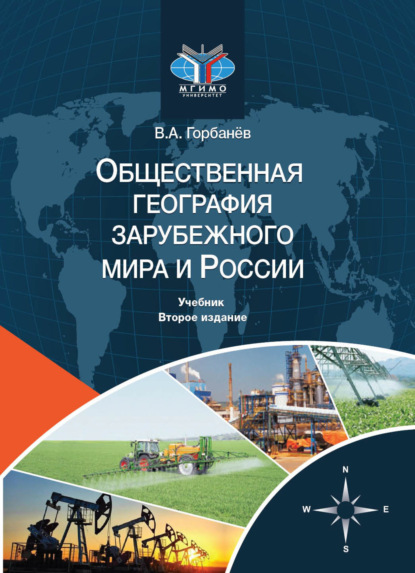Homer und Vergil im Vergleich
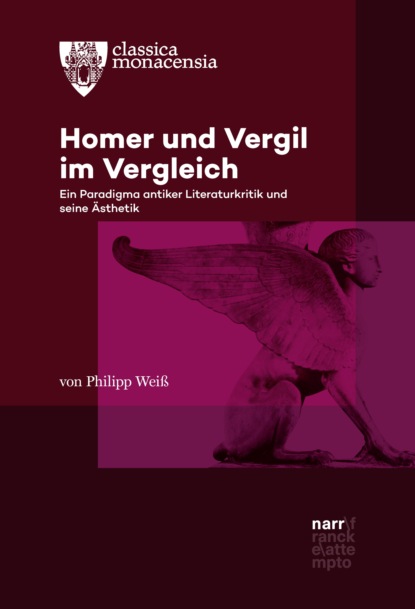
- -
- 100%
- +
Wie aber sind das Schlafen der Vielen und das Wachen des Einzelnen zu bewerten? Wenn Schlaf in Situationen geschildert wird, in denen sich die Ruhe wegen einer drohenden Gefahr o.ä. eigentlich verbietet, so provoziert dies vor allem zwei Reaktionen seitens der antiken Kritiker: Entweder sie tadeln auf der Handlungsebene die schlafenden Personen selbst, indem sie ihnen Vorhaltungen wegen ihres unpassenden Verhaltens machen, oder sie kritisieren den Dichter, der seinem Publikum eine psychologisch unglaubwürdige Darstellung zumutet. Beide Formen der Kritik begegnen in den antiken Homerkommentaren – entweder als explizit geäußerter Tadel oder implizit in Form einer Verteidigung Homers gegen bestimmte Vorwürfe – im Zusammenhang mit Szenen, die sich im weiteren Sinne als Vorlagen für die Nachtschilderungen bei Apollonios, Varro und Vergil auffassen lassen.
Kritik an den handelnden Figuren findet sich in einer Kommentarnotiz zuHomerIl. 2, 1–4 Il. 2, 1–4, wo nach der Auseinandersetzung zwischen Hera und Zeus, die den Abschluss des ersten Buches der Ilias bildet, der Schlaf der Götter und Menschen geschildert wird:
Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ | εὗδον παννύχιοι, Δία δ’ οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνος, | ἀλλ’ ὅ γε μερμήριζε κατὰ φρένα ὡς Ἀχιλῆα | τιμήσῃ, ὀλέσῃ δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.10
(„Da schliefen die anderen Götter und die pferdegerüsteten Männer | Die ganze Nacht. Aber den Zeus hielt nicht der süße Schlaf, | Sondern er überlegte in seinem Sinn, wie er den Achilleus | Ehre und viele der Achaier verderben sollte bei den Schiffen.“ ÜS Schadewaldt)
Im ersten Buch wird zwar keine akute Bedrohung durch den Krieg beschrieben. Dennoch findet der Schlaf der Krieger – die Götter bleiben von der Kritik ausgenommen – den Tadel der Philologen:
ἱπποκορυσταί] οὓς ἀγρυπνεῖν ἔδει διὰ τὴν τοῦ πολέμου πρόνοιαν. οἱ δὲ τοὺς βασιλεῖς ἤκουον. (schol. bT ad Il. 2, 1c = I 175, 7–8 Erbse)
(„roßgerüstet] Sie hätten wachen müssen, weil sie den Kampf schon vorhersahen. Sie hatten ja die Anführer gehört.“)
Die Einlassung gilt den Achaiern selbst, die am Tag zuvor der Beratung beigewohnt hatten, bei der die Rücksendung der Chryseis und die Überstellung der Briseis an Agamemnon beschlossen worden war (Il. 1, 54–305). Der anonyme Kommentator hat insbesondere die Worte des Achilles im Blick, der den Achaiern unter Eid seine Enthaltung vom Kampf und vielfachen Tod unter den Händen Hektors für den Fall in Aussicht gestellt hatte, dass ihm das Ehrgeschenk genommen würde (Il. 1, 233–244). Nach einer solchen Szene war es dem antiken Kritiker zufolge als unangemessen zu tadeln, dass die Achaier sorglos schliefen.
Wenn nicht die handelnden Figuren für ihr inkonsequentes Verhalten, sondern der Dichter und seine Darstellung getadelt werden, so richtet sich die Kritik auf die fehlende Plausibilität der Darstellung. Auch dafür findet sich in den Homerscholien ein treffendes Beispiel, nämlich am Beginn des zehnten Buches der Ilias (Il.HomerIl. 10, 1–4 10, 1–4):
Ἄλλοι μὲν παρὰ νηυσὶν ἀριστῆες Παναχαιῶν | εὗδον παννύχιοι μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ· | ἀλλ’ οὐκ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν | ὕπνος ἔχε γλυκερὸς πολλὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντα.
(„Da schliefen die anderen bei den Schiffen, die Ersten der All-Achaier, | Die ganze Nacht hindurch, vom weichen Schlaf bezwungen. | Doch den Atreus-Sohn Agamemnon, den Hirten der Völker, | Hielt nicht der süße Schlaf, denn viel bewegte er in dem Sinn.“ ÜS Schadewaldt)
Legt man wieder die zur Parallele im zweiten Buch genannten Kriterien an, so wäre ein Schlafverbot an das achaische Kriegsvolk an dieser Stelle noch eher am Platz als dort. Nach der abgebrochenen Schlacht (Il. 8, 53–349) und der misslungenen Gesandtschaft an Achilles (Il. 9, 182–668) ist der Mut der Achaier geschwunden; an Schlaf sollte in dieser Situation nicht zu denken sein. Der anonyme Kommentator muss also eigens betonen, dass hier eine glaubhafte Darstellung vorliegt, um Homer zu rechtfertigen:
ἄλλοι μὲν παρὰ νηυσὶν ἀριστῆες Παναχαιῶν | <εὗδον παννύχιοι>] εἰκότως· ἀμφότερα γὰρ ὕπνου ἀγωγά, καὶ ὁ ἐκ τῆς μάχης κάματος καὶ ἡ ἐπὶ τῇ ἥττῃ δυσθυμία. (schol. A ad Il. 10, 1–2 = III 1, 7–8 Erbse)
(„Das stellt er glaubwürdig dar: Die beiden Dinge nämlich führen den Schlaf herbei, sowohl die Anstrengung des Kampfes wie auch die Mutlosigkeit infolge der Niederlage.“)
Die Achaier sind nach einem Tag voller Kämpfe und der von Achill abgeschlagenen Bitte um Unterstützung vom Schlaf wie überwältigt (vgl. Il. 10, 2b: μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ).11 Diese Gewalt des Schlafes über alle Menschen ist ein Gemeinplatz:
μαλακῷ] τῷ πάντας μαλάσσοντι, ὅθεν καὶ <Il. 24, 5; Od. 9, 373> ‘πανδαμάτωρ’ καλεῖται. (schol. bT et b ad Il. 10, 2b = III 2, 21–22 Erbse)
(„vom weichen] von dem, der alle weich macht, weswegen er auch ‘Allbezwinger’ genannt wird.“)
Die negative Wertung des Schlafes als bedrohliche Macht, die von den Menschen Besitz ergreift, hat ihr Pendant in der positiv besetzten Tugend der ἀγρυπνία, die man besonders von den homerischen Führungsgestalten Agamemnon und Achill einforderte. Am Beginn der homerischen Dolonie wird diese Qualität im Kontrast zu den Achaiern an Agamemnon betont (vgl. Il. 10, 3–4). Die Scholien bemerken dazu:
<ἀλλ’ οὐκ Ἀτρείδην –/ὕπνος ἔχε>] ἀγρυπνεῖ ὁ στρατηγός, πρῶτα μὲν ὅτι τοὺς πρώην πολιορκουμένους πολιορκοῦντας ὁρᾷ, καὶ ὅτι ἡ εἰς Ἀχιλλέα ἐλπὶς ἐξεκέκοπτο, ἧς μάλιστα τὴν αἰτίαν εἶχεν. ἀκήκοε δὲ καὶ τοῦ ὀνείρου λέγοντος· <Il. 2, 24> ‘οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα’· τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῆς τύχης, τοῦ δὲ ἀμελεῖν ἡ αἰτία ἀπαραίτητος τοῖς στρατηγοῖς. … (schol. bT ad Il. 10, 3–4 = III 2, 25–36 Erbse)
(„Der Feldherr aber schläft nicht, erstens weil er die kürzlich noch Eingeschlossenen nun angreifen sieht und weil sich seine Hoffnung auf Achilles zerschlagen hat, zu der er die größte Veranlassung hatte. Den Traumgott aber hat er sagen hören: ‘Nicht gebührt es dem richtenden Manne die Nacht zu durchschlummern.’12 Das andere ist den Umständen geschuldet; hart aber ist der Vorwurf der Sorglosigkeit für Feldherren.“)
Dass man auch in Rom epische Texte vor dem Hintergrund dieser homerischen Wertevorstellungen las, zeigen die antiken Vergilkommentatoren. In der Aeneis hat das Motiv des schlafenden Anführers eine wichtige Funktion bei der Charakterisierung der Figuren. Ein Scholion des Servius zeigt, dass man den Schlaf des Aeneas bei der Wegfahrt aus Karthago als anstößig empfand. Servius schreibt zu Aen.VergilAen. 4, 555 4, 555:
carpebat somnos] hoc est quod et paulo post culpat Mercurius, dicens <Aen. 4, 560> ‘nate dea, potes hoc sub casu ducere somnos’? sed excusatur his rebus: nam et certus eundi fuerat, et rite cuncta praeparaverat: aut certe prooeconomia est, ut possit videre Mercurium. rite] recte et ex ordine compositis. et diligenter virum strenuum non ante facit requiescere, quam rite omnia paravisset. ([D]Serv. ad Aen. 4, 555 = I 562, 27–563, 3 Thilo-Hagen)
Servius wendet zwei unterschiedliche Strategien an, um einen potentiellen Tadel an der Stelle, der vielleicht schon in einer der frühen Obtrektationsschriften gegen Vergil erhoben worden war, zu entkräften: Mit dem Stichwort prooeconomia ist der erzählstrategische Aspekt angesprochen, der im Schlaf des Helden die logische Voraussetzung für die folgende Traumerscheinung des Mercurius erkennt, wodurch die narrative Kohärenz gewährleistet wird.13 Das erste apologetische Argument, das Servius vorbringt, bewegt sich hingegen auf einer anderen Ebene, nämlich derjenigen der ethischen Qualität des Helden. Der Schlaf des Helden sei gerechtfertigt, weil Aeneas sicher mit seiner Abreise rechnen konnte und zuvor alle nötigen Vorkehrungen getroffen habe: Seine Sorglosigkeit ist begründet – anders als bei den Achaiern an den oben behandelten Homerstellen.14
Auch im Zusammenhang mit der Nachtszene, dieVergilAen. 8, 26–27 mit Aen. 8, 26–27 eingeleitet wird, finden wir Hinweise, dass das Thema des Schlafes hier von den Vergilkommentatoren mit Bezug auf die homerischen Vorbildszenen behandelt wurde. Servius bringt eine Erklärung, die der oben in dem Scholion zu Il. 2, 1 referierten Kritik vom Ansatz her erstaunlich ähnelt:
seramque dedit per membra quietem] tardam, quippe in bellicis curis. (Serv. ad Aen. 8, 30 = II 203, 21–22 Thilo-Hagen)
Deutlicher wird der anonyme Verfasser eines Veroneser Scholions, der die bekannten Worte des Schlafgottes aus dem zweiten Buch der Ilias mit einem Hinweis auf ihre ethische Relevanz für den dux zitiert:
Diese Besonderheiten des epischen Verhaltenskodex, den die antiken Kritiker an die Texte von Homer, Apollonios bzw. Varro und Vergil in vergleichbarer Weise anlegten, sind zu berücksichtigen, wenn man den Vorschlag Ovids, Varros zweiten Halbvers zu tilgen, richtig verstehen will. Vergleicht man die Übertragung Varros und stellt sie in den aus Apollonios zu rekonstruierenden Kontext, so ergibt sich nach antiker Vorstellung ein Widerspruch. Man kann nämlich schwerlich davon sprechen, dass die genannten Personengruppen, die trotz ihrer schweren Sorgen vom Schlaf überwältigt wurden, nach ihrem Einschlafen einen „friedlichen“ Schlaf genossen hätten. Ähnliches gilt auch für die Situation der Argonauten in dieser Nacht: Jason hatte kurz zuvor von den Aufgaben erfahren, die er zu vollbringen hat, und sich auf das risikoreiche Zaubermittel Medeas eingelassen. In dieser Situation wie Varro davon zu sprechen, dass sich „alles in friedlicher Ruhe niedergelegt“ hätte, erscheint nach den Maßstäben der Figurenpsychologie unglaubwürdig.
Dass placidus als Adjektiv für die nächtliche Ruhe der besorgten Bevölkerung nicht passen kann, zeigt auch Seneca d.J., der denselben Varrovers zitiert, der schon bei seinem Vater kritisiert wurde. Nach Seneca schließen sich nämlich innere Erregtheit und die in noctis placida quies zum Ausdruck kommende Vorstellung aus:Seneca d.J.ep. mor. 56, 5–6
… Nam quid prodest totius regionis silentium, si affectus fremunt? ‘Omnia noctis erant placida composta quiete.’ Falsum est: nulla placida est quies nisi quam ratio composuit; nox exhibet molestiam, non tollit, et sollicitudines mutat. (Sen. ep. mor. 56, 5–6)
Seneca d.J. will sagen: Nur die durch ratio erworbene Ruhe ist wirklich friedlich; die Beseitigung äußerer Störfaktoren trägt nichts zur inneren Ruhe bei. Wen die Nacht überwältigt hat, obwohl er eigentlich an Ruhe nicht denken kann – wie die Argonauten oder die anderen bei Apollonios genannten Personengruppen –, der genießt nicht eigentlich eine friedliche Ruhe, sondern tauscht nur die Unruhe am Tage mit der Drangsal bei Nacht ein.
Werfen wir abschließend einen kurzen Blick auf die vergilischen Schlafszenen und die hier verwendeten Adjektive, um die bisher vorgebrachten Überlegungen zu überprüfen. An der von Seneca d.Ä. zitierten Stelle Aen. 8, 27, die der Szenerie bei Apollonios bzw. Varro an Gespanntheit und innerer Dramatik entspricht, verwendet Vergil – wie sich nun sagen lässt: stilistisch begründet – das Adjektiv altus – und nicht placidus –, um den Schlaf zu charakterisieren. – Nach der Abfahrt des Aeneas besteht – außer für Dido – kein Grund zur Sorge mehr. Dass die Männer des Aeneas bei der Abfahrt froh gestimmt waren, hat die Königin selbst ihrer Schwester Anna berichtet (Aen. 4, 418). Und wenn man sich erinnert, welches Skandalon die Verbindung zwischen Aeneas und Dido bei der karthagischen Bevölkerung und bei den angrenzenden Völkern darstellte15, erscheint es plausibel, dass nach der Abfahrt der trojanischen Gäste auf Seiten der Karthager ein begründetes Gefühl der Sorglosigkeit vorherrschend war. Hier passen also die Wendungen, die Vergil in bewusstem Anklang an Varros Neugestaltung des Apollonios verwendet.16 – Aufschlussreich ist schließlich im Kontrast zu den zuletzt genannten Stellen Aen. 1, 247–249, wo Venus zu Jupiter von Antenor spricht, der – im Gegensatz zu Aeneas – das Ziel seiner Reise erreicht und Padua gegründet hat, demnach also auch keine Sorgen mehr leidet und seine friedliche Ruhe genießen kann. Auch hier finden sich – im letzten Vers – eindeutige Bezüge zu Varro (Aen. 1, 247–249): Hic tamen ille urbem Patavi sedesque locavit | Teucrorum, et genti nomen dedit, armaque fixit | Troia; nunc placida compostus pace quiescit.
Abschließend lässt sich also zusammenfassen: Ovid kritisiert bei Varro die Verwendung von placidus, weil es nicht zu der unmittelbar zuvor – für uns nur bei Apollonios, aber sicherlich auch in der Übertragung Varros – geschilderten sorgenvollen Welt passt. Durch die Streichung des zweiten Halbverses ändert Ovid den Sinn insofern, als er jetzt sagt, dass die Nacht Besitz von allem ergriffen hätte, und nähert so den Varrovers an die parallele Schilderung bei Homer an, wo beschrieben wird, dass der Schlaf als πανδαμάτωρ Gewalt über die Achaier ausübt. Das zugrundegelegte ästhetische Kriterium ist das der psychologischen Folgerichtigkeit bzw. Plausibilität (πιθανότης), wonach die Art des Schlafes mit der äußeren Situation der Schlafenden übereinstimmen muss. Das gibt aber nun gleichzeitig ein Kriterium an die Hand, um Vergils Änderung der varronischen Vorlage zu erklären: Altus nimmt den bei Varro vorliegenden Widerspruch zurück, die Stelle ist einer möglichen Kritik weniger stark ausgesetzt.
3.3 Zusammenfassung
In seinen programmatischen Äußerungen zeigt sich Seneca d.Ä. ganz auf der Höhe der stilkritischen Debatten seiner Zeit (→ Kap. 3.1). Er nimmt eine „moderne“ Position ein, wenn er die künstlerische imitatio einer Vielzahl von anerkannten Vorbildautoren als eine Methode beschreibt, dem aktuellen rednerischen Verfallszustand abzuhelfen. Seine Sammlung von Controversiae und Suasoriae hat weniger systematischen Anspruch im Sinne einer Theorie der imitatio, als vielmehr den Zweck, anhand konkreter Fälle Kategorien gelungener und misslungener Nachahmung vorzuführen. – In beiden behandelten Beispielen wird Vergils Kunst der imitatio als vorbildlich vorgestellt. Dies erfolgt jeweils vor der Kontrastfolie einer Prosadeklamation: Im Falle von suas. 1, 12 (→ Kap. 3.2.1) ist es ein aus Homer geschöpfter Abschnitt einer Übungsrede des griechischsprachigen Deklamators Dorion, der mit Vergils Homer-imitatio verglichen wird, in contr. 7, 1, 27 (→ Kap. 3.2.2) eine Formulierung des Cestius. Im letzteren Fall ist die Vergleichstechnik besonders raffiniert: Cestius imitiert und verfehlt Vergil; Vergil aber hat an selber Stelle wiederum Varro imitiert und dabei auch Modellstellen aus Homer und Apollonios Rhodios und deren philologischen Diskussionszusammenhang berücksichtigt. Als Anhang wird ein eigener Vorschlag Ovids referiert, der eine Schwachstelle in Varros Versen kenntlich macht: Wenn Varro in seiner Nachtschilderung die Menschen ruhig schlafen lässt, verstößt er gegen die Forderung nach psychologischer Glaubwürdigkeit. Erst durch diesen Kommentar Ovids wird deutlich, worin der Vorzug Vergils vor seinem Modell besteht: In der Aeneis ist nur vom tiefen Schlaf die Rede – der „Fehler“ Varros wird also vermieden. Auf ähnliche Weise führt suas. 1, 12 das Thema der Glaubwürdigkeit ein, diesmal aber in sachlicher Hinsicht: Vergil stellt den Steinwurf des Kyklopen viel vorsichtiger und den Gegebenheiten der Realität entsprechend dar, wohingegen Dorion seine Schilderung durch unrealistische und effekthascherische Details belastet. In beiden Abschnitten wird die imitatio also kontrastiv vor dem Kriterium der Glaubwürdigkeit bewertet, wobei in suas. 1, 12 Glaubwürdigkeit als Realismus im sachlichen Sinne – d.h. als Übereinstimmung mit der Erfahrungswirklichkeit –, in contr. 7, 1, 27 als Realismus im psychologischen Sinne gemeint ist.
4. Gellius, Noctes Atticae
4.1 Die Synkrisis als literaturkritische Kleinform in den Noctes Atticae
4.1.1 Enzyklopädische, rhetorische und grammatische Bildung bei Gellius
Über ein Jahrhundert trennen Seneca d.Ä. von Gellius, dem wir mit den beiden Kapiteln 9, 9 und 13, 27 seiner Noctes Atticae zwei wichtige Beiträge zur Frage der relativen Bewertung Vergils und Homers verdanken.1 Wie bereits ausgeführt, war Vergils kanonische Stellung zu Gellius’ Zeit, also in der zweiten Hälfte des zweiten Jhdt. n. Chr., gefestigt2 und sein Verhältnis zum Vorbild Homer nicht zuletzt durch die Autorität Quintilians definiert. Wo positionieren sich aber die Noctes Atticae in der Homer-Vergil-Frage? Wieder ist zunächst von der besonderen Zielsetzung, der Gellius in seiner Schrift folgt, auszugehen, bevor die in 9, 9 und 13, 27 präsentierten kritischen Methoden auf ihre Tendenz hin untersucht werden.
Über den Zweck, den Gellius mit seinen Noctes Atticae verfolgt, macht er in der Vorrede – sie ist wegen eines wohl nicht beträchtlichen Textausfalls am Beginn nur teilweise erhalten – unterschiedliche Angaben. Eher bescheiden äußert er sich an der Stelle, wo der überlieferte Text einsetzt:Gelliuspraef. 1 Gellius möchte demnach seinen Kindern die Möglichkeit geben, sich bei gelegentlichen Arbeitspausen (interstitione aliqua negotiorum data) geistig zu erholen (quando animus … laxari indulgerique potuisset).3 Im nächsten Abschnitt streicht er dagegen den persönlichen Nutzen, den er selbst mit seiner Sammlung verfolgt, hervor: Sie diene ihm als „Gedächtnisstütze“ bzw. „Wissensvorrat“ (ad subsidium memoriae quasi quoddam litterarum penus), indem sie die wesentlichen Inhalte der von ihm studierten Werke in komprimierter Form aufbewahrt. An einer dritten StelleGelliuspraef. 11 kommt Gellius dann wieder auf den Nutzen für die Kinder zu sprechen, diesmal allerdings in differenzierterer Weise und verbunden mit einem pädagogischen Gedanken. Sein Ziel sei demnach dreifacher Natur: Lesevergnügen, Bildung durch Lektüre und praktische Anwendbarkeit des memorierten Wissens (… quod sit aut voluptati legere aut cultui legisse aut usui meminisse).4 Er nimmt dabei für sich in Anspruch, seine Quellen „nicht ohne kritisches Unterscheidungsvermögen“ (‘alba’ ut dicitur ‘linea’ sine cura discriminis)5 ausgewählt zu haben, um die besagten drei Ziele zu erreichen.6
Einer Sentenz des Heraklit zufolge ist es nicht Vielwisserei, die den Verstand bildet.7 Darauf beruft sich Gellius in praef.Gelliuspraef. 12 12, wenn er seine Auswahl rechtfertigt, indem er zwei leitende Ziele geltend macht: Den aufnahmebereiten Lesern (ingenia prompta expeditaque) will er nur Anregungen bieten, die die Lust auf weitere Lektüre steigern sollen, für andere hingegen, die wegen drängender Geschäfte von weiteren Studien abgehalten werden, will er durch seine handliche Exzerptensammlung immerhin die Informationen liefern, mit denen sie sich vor dem Vorwurf schändlicher Unwissenheit bewahren können.8 Diese „schändliche und bäurische Unwissenheit“9 erstreckt sich für Gellius auf verba und res (rerum atque verborum imperitia), womit die beiden Hauptbereiche des in den Noctes Atticae vermittelten Wissens bezeichnet sind, nämlich der sprachliche und der antiquarisch-sachliche.
Die selbstauferlegte quantitative Beschränkung beim Exzerpieren hat zufolge, dass Gellius den einzelnen Themengebieten eine exemplarische Bedeutung zuweisen muss, wenn er gleichzeitig an der enzyklopädischen Grundidee der von ihm kompilierten Sammlung festhalten möchte. Diese enzyklopädische Grundidee kommt besonders in dem Abschnitt zum Tragen, in dem sich Gellius für die Behandlung entlegener Gegenstände aus Sachgebieten wie Grammatik, Dialektik oder Geometrie rechtfertigt:Gelliuspraef. 13
Non enim fecimus altos nimis et obscuros in his rebus quaestionum sinus, sed primitias quasdam et quasi libamenta ingenuarum artium dedimus, quae virum civiliter eruditum neque audisse umquam neque attigisse, si non inutile, at quidem certe indecorum est. (praef. 13)
Mit den ingenuae artes spielt Gellius auf den von Varro definierten Disziplinenkanon an, der als geschlossenes enzyklopädisches System eine Gesamtheit des Wissens repräsentieren sollte.10 Gellius legt die Betonung an der zitierten Stelle auf die Notwendigkeit einer bestimmten Form von Bildung für den sozialen Stand ihres Trägers, deren Fehlen zur sozialen Exklusion führt (… si non inutile, at quidem certe indecorum …). Dies rechtfertigt auch den Kompendiencharakter des Werks: Wenn er mit seinen Noctes Atticae bei einem Teil der Leser auch keine weiterreichenden Bildungsbemühungen anregen kann, so erfüllen sie doch ihren Zweck, indem sie diesem Rezipientenkreis zumindest das notwendige Minimum an Wissen an die Hand geben, um den sozialen Anforderungen an einen vir civiliter eruditus zu genügen.
Eine genauere Bestimmung der inhaltlichen Aspekte im Bildungsbegriff des Gellius geschieht eher beiläufig in praef. 16. Gellius tritt hier präventiv Einwänden entgegen, die sich gegen Abschnitte in seinem Werk richten könnten, in denen von entlegenen, dem Leser noch nicht aus anderen Texten bekannten Gegenständen die Rede ist. Hier sei Gellius zufolge zu prüfen, ob nicht auch sie Bildungswert besitzen:Gelliuspraef. 16
… aequum esse puto, ut sine vano obtrectatu considerent, an … eius seminis generisque sint, ex quo facile adolescant aut ingenia hominum vegetiora aut memoria adminiculatior aut oratio sollertior aut sermo incorruptior aut delectatio in otio atque in ludo liberalior. (Gell. praef. 16)
Diese allgemeine Zielbestimmung ist nicht nur auf das „Neue und Unbekannte“ (nova … ignotaque) – d.h. auf Randbereiche im antiken Disziplinenkanon – zu beziehen, sondern gilt für den Stoff der Noctes Atticae generell. Worauf läuft dieses übergeordnete Bildungsziel aber hinaus? Gellius profiliert es an dieser Stelle als ein rhetorisches, dem auch im strengeren Sinne der Grammatik zugehörige Bereiche (sermo incorruptior)11 und Fragen einer für Gebildete angemessenen Freizeitbeschäftigung (delectatio in otio atque in ludo liberalior) zugeordnet sind. Vor allem aber sollen die rhetorischen Kernkompetenzen ingenium, memoria und Redegewandtheit (oratio sollers) durch die Beschäftigung auch mit Nischenthemen ausgebildet werden.
Dabei fällt freilich auf, dass die rhetorische Theorie nur einen geringen Teil der in den Noctes Atticae angesprochenen Gegenstände darstellt.12 Auch der Lektürestoff der Rhetorenschule – Historiker und Redner13 – tritt, verglichen mit der Dichterlektüre, die strenggenommen ins Metier der Grammatiker fällt, keineswegs in den Vordergrund.14 Die zahlreichen Erörterungen über Archaismen, korrekten Sprachgebrauch, lexikalische Vergleiche zwischen der griechischen und lateinischen Sprache, Etymologien, Morphologie und Semasiologie15 sind der Disziplin nach grammatischer Natur, und C. Sulpicius Apollinaris, die zentrale Grammatikerfigur in den Noctes Atticae, bildet auch auf der Ebene des Personals ein Gegengewicht zu Rhetoriklehrern wie Antonius Julianus und T. Castricius.16
Gellius formuliert in seiner Vorrede also zwar ein rhetorisches Bildungsziel als Leitidee, berücksichtigt in der Auswahl seiner Themen aber die verschiedensten Themengebiete, wobei sich ein erkennbarer Schwerpunkt im Bereich der grammatischen Bildung ergibt.17 Damit folgt er der Idee von den ingenuae artes als eines umfassenden Wissenssystems, dessen Beherrschung erst den vir civiliter eruditus ausmacht, ohne dass er dieses Wissenssystem in vollem Umfang enzyklopädisch darstellen müsste. Aus dieser Schwerpunktsetzung im Bereich der Grammatik, wie sie sich in der Themenwahl der Noctes Atticae abzeichnet, erklärt sich nun auch das besondere Interesse, das Gellius Vergil als dem exemplarischen Dichter lateinischer Sprache entgegenbringt.18 Fragestellungen und Methoden sind hier wieder vor allem grammatischer Natur: Sprachgebrauch19, Lesarten (Gell. 4, 1, 15), angebliche Verstöße gegen die historia (Gell. 10, 16) oder die Frage, welche Bezüge zwischen Biographie und Werk bei diesem Dichter relevant sind (Gell. 6, 20), stehen hier im Zentrum. An manchen Stellen kommt außerdem zum Ausdruck, dass Gellius Vergil auch als Quelle „verborgenen“ Wissens schätzt, das er dann durch grammatische Sacherläuterung erschließt.20 Gelegentlich kommt er auch auf das Verhältnis zu Homer zu sprechen, wenn er dessen Autorität bei der Behandlung konkreter Vergilstellen entweder bestätigend21 oder – in Fällen von explizit festgestellter aemulatio – kontrastiv zur synkritischen Beurteilung mit Vergil22 heranzieht.