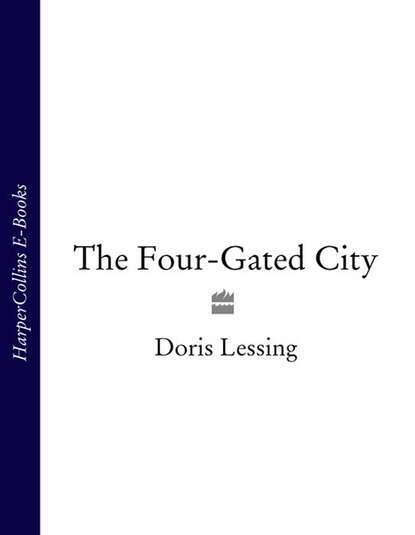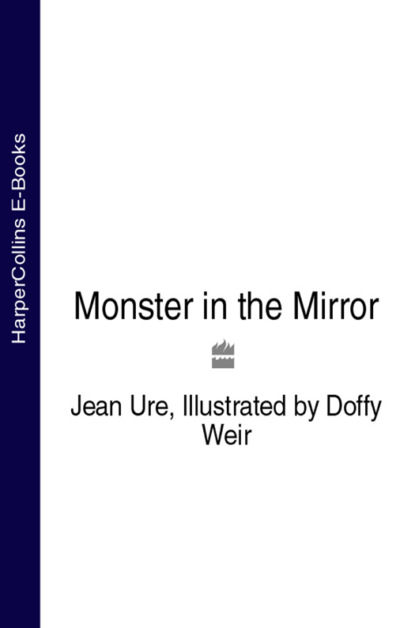Nacht über der Prärie

- -
- 100%
- +
Als das Rollen, Holpern, Schlagen und Überschlagen aufhörte, rollte sie sich wieder auseinander und stellte fest, dass der Wagen auf dem Dach lag; die Räder in der Luft, wie eine auf den Rücken gefallene Fliege. Es war noch einmal alles gut gegangen. Der Sturm hätte den Wagen auch mitnehmen und irgendwo zerschmettern können. Queenie richtete sich in der neuen Lage ein. Sie hatte einige Prellungen davongetragen. Das tat nichts. Alles, was nicht unmittelbar ans Leben ging, erschien ihr jetzt schon angepasst und erträglich. Jedenfalls hatte der Sturm sie aus dem Bach herausgeholt!
In dem Augenblick, in dem Queenie diesen Gedanken zu Ende gedacht hatte, schoss eine neue Flutwelle in das Prärietal hinein.
Queenie arbeitete an dem Fenster, um aus dem Wagen, in dem sie zu ertrinken fürchtete, noch hinauszugelangen. Mit dem Griff eines feststellbaren Taschenmessers, das sie auf Reisen stets bei sich trug, versuchte sie eine Scheibe einzuschlagen, da die Kurbeln nicht funktionieren wollten.
Zerkratzt, mit zerrissenen Kleidern, deren Fetzen nass am Körper klebten, stand sie endlich außerhalb des Wagens, bis über die Knie im Wasser. Ihr Haar flatterte im Sturm. Sie wusste nicht, wie sie sich halten sollte. Der Winddruck warf sie fast nieder, und sie musste jeden Augenblick befürchten, dass der Sturm sie so wie vorher den Wagen ergreifen und irgendwohin schleudern würde. Sie stand in der Sturmrichtung, das war gefährlich. In ein Quertal hätte sie sich retten müssen, aber nun war alles zu spät. Es blieb nichts übrig, als zu atmen, solange sie vermochte. Wenn sie einen Schritt zu machen versuchte, glaubte sie den Halt zu verlieren, selbst wenn sie sich an dem Wagen festklammerte. Der Boden unter dem Wasser war schlüpfrig und hatte Löcher. Der Sturm war zu gewaltig.
Die Anstrengung war für das Mädchen sehr groß. Ihre Knie zitterten. Auch mit dem Rücken gegen den Sturm gewandt, konnte sie nur noch schwer atmen. Es schwindelte ihr, und sie war so erschöpft, dass ihr alles gleichgültig werden wollte. Sie dachte aber noch: Es ist feige aufzugeben. Ich will kämpfen, solange ich noch denken kann, noch denken kann … noch denken … kann … Vater … ja … Mutter … ja, ja … noch denken …»Stonehorn!« schrie sie hinaus. Er war nicht der einzige, der wissen konnte, wo sie hingefahren war und wann sie gefahren war, aber er war der einzige, von dem sie erhoffte, dass er … ja, dass er … ihr vielleicht … gefolgt … und dass er dem Sturm widerstehen …
»Stonehorn!« Der Sturm wehte ihr das Wort vom Munde weg. Aber dann kam wirklich der, den sie gerufen hatte.
Seine Arme packten sie, als ob sie leicht wie ein Kind sei, und sie spürte den menschlichen Körper wie das Leben selbst, das sie liebte. Er trug sie ein gutes Stück weit, sie wusste nicht, wie lange oder wohin, aber sie war so vollständig geborgen, dass sie zu denken aufhörte und kein Gefühl mehr mit einem Wort hätte bezeichnen können.
Die Gewalt des Sturms schien nachzulassen. Der Mann hatte sie wohl in ein Seitental getragen; auch diese Vorstellung war mehr Instinkt für sie als Bewusstsein. Ihr Kopf sank zurück. Sie fand irgendeinen Halt dafür, und sie schlief ein.
Als sie wieder erwachte, verstand sie erst nicht, wo sie war, aber sie hatte doch soviel Gefühl dafür, dass sie die Stille nicht mit einer Frage zerriss. Ihre Lider öffneten sich nur halb, und sie fand kein Licht, aber auch nicht mehr das stumpfe Schwarz. Ein Stern glänzte matt zwischen letzten Nebeln, abfließendes Wasser rauschte, der Wind strich über die Gräser, die er gepeitscht hatte. Sie lächelte, denn sie spürte jetzt, dass ihr Kopf an der Schulter eines Menschen lag. Sie wandte ihm ihr Gesicht zu, und sie sagte noch immer nichts. Aber sie spürte von neuem das Leben und dass sie nicht gestorben und nicht zwischen schmutzigen Wassern verreckt war.
Als er sie an sich zog, sacht erst, dann mit seiner ganzen Kraft, schien ihr erfüllt zu sein, was sie verborgen vorgefühlt und in scheu gehüteten Träumen gesehen hatte, und die erste Leidenschaft ihres jungen Körpers und ihrer jungen Seele vereinten sich so mit der unbändigen Leidenschaft des Mannes, dass ihr alle Schmerzen Seligkeit wurden.
»Inya-he-yukan«, sagte sie leise, deutlich, andächtig, als sie auf der nassen Wiese lag und wieder Mond und Sterne leuchten sah. Seine Augen waren merkwürdig, aber sie glaubte, alles, was darin verschlossen war, auch in sich verschließen zu können. Sie konnte warten; die Seligkeit kannte keine Zeit.
Sie bemerkte erst jetzt, dass er keine Kleider trug, sondern nur den ledernen Lendenschurz nach alter Indianerart, am Gürtel ein Stilett, am Schulterhalfter zwei Pistolen. Nahebei weidete ein Pferd, das ebenso triefendnass war wie die beiden ersten Menschen in der Urzeit der Prärie. Sie lächelte, und auf seinem Gesicht erschien auch ein Lächeln, wie sie es noch nie bei ihm gesehen hatte; es war freundlich, in sich vollendet und ohne allen Spott.
»Weißt du noch?« sagte sie. »Ich habe einen kleinen Kaktus … da gepflückt, wo du mich das erste Mal in die Arme genommen hast. Ich war elf Jahre alt, und du warst sechzehn … und du warst noch einmal sitzengeblieben. Das Flaggengelöbnis hast du immer wieder falsch aufgesagt, und bei Mr Teacock wolltest du überhaupt nicht sprechen.«
»Er war von einem Menschen so weit entfernt wie ein Ziegenbock von meinem Pferd.«
»Und du hattest ihn – den andern meine ich – verprügelt, dass die Fetzen flogen. Es war ein früher Sommer wie jetzt, und die weiße Rose begann zu blühen. Die Wasser kamen, der Schnee schmolz. Du hast mich gefragt, ob ich deine Braut werden will … und ich wusste nicht, wie das ist … Dann bist du gegangen, aber du hast gesagt, du kämest wieder.«
Er vermochte nicht viel zu antworten.
»Du hast meinen Namen gerufen«, sagte er. »Du bist der erste Mensch, der nach mir gerufen hat, seit meine Mutter starb.« Er riss sie wieder an sich, und sie wollte in ihrem Leben niemals mehr etwas anderes sein als Tashina, die Frau des Inya-he-yukan und die Mutter seiner Kinder.
Es war noch immer Nacht.
Tashina krümmte sich, als ob ihr jemand ein Messer in die Eingeweide gestoßen habe, denn sie hörte eine Stimme, schmutziges Gift war diese Stimme.
»Jetzt ist es aber genug mit deiner Idylle, Chief, wahrhaftig, jetzt kommen wir dran …«
Stonehorn war schneller aufgesprungen, als Tashina überhaupt denken konnte. Er schlug dem Burschen mit der Handkante gegen die Kehle, dass er stürzte und ohne einen Laut liegenblieb. In der Linken hatte Stonehorn schon das Stilett. Er warf es jetzt seiner rechten Hand zu, aber der zweite Kerl war nicht mutig genug, um anzunehmen, und rannte weg. Stonehorn warf ihm das Stilett in den Rücken, so dass er zusammenbrach, und riss eine Pistole heraus. Doch kam er nicht zum Schuss. Er lag schon im Gras, als auf der anderen Seite der erste Revolver knatterte und die Geschosse über ihn hinwegpfiffen.
Mit einem Sprung kam er dann auf, schneller, als der andere neu zielen konnte, und schoss. Die Antworten kamen von links und von rechts; es mussten mindestens noch drei Banditen sein, die ihn aufs Korn nahmen, vielleicht auch vier. Er hatte beide Pistolen zur Hand und wechselte den Platz, suchte neue Deckung. Tashina konnte ihn nicht mehr sehen. Sie saß still im Gras und lauschte; ihre Augen waren auf das Pferd gerichtet, bei dem Stonehorn vielleicht noch andere Waffen hatte oder mit dem er vielleicht fliehen konnte. Zwischen den Hügeln peitschten Schüsse in schneller Folge. Das Gefecht zog sich hin. Kein Wort, kein Ruf wurde mehr laut. Es ging auf Leben und Tod, verbissen, mit äußerstem Hass. Banditen gegen Banditen, dachte Tashina eine Sekunde, aber dann war das weg, und sie fühlte und dachte nichts mehr als … Stonehorn …
An Tashinas Körper klebten die nassen Fetzen. Ihre Hände zitterten, als sie das Taschenmesser feststellte, so dass sie es als Stoßwaffe gebrauchen konnte. Sie umklammerte den Griff und verbarg die Schneide. Wenn ein Verbrechen an ihr geschehen sollte, wollte sie sich wehren, und wenn sie sich nicht mehr wehren konnte, wollte sie nicht überleben.
Das Feuergefecht war für einen Augenblick zum Stillstand gekommen. Wahrscheinlich hatten alle Deckung voreinander genommen. Es ertönten scharfe Pfiffe; das waren die Signale von Stonehorns Feinden. Einmal kreischte es auf: »Schwein und Verräter!« Als Antwort kam ein Schuss.
Am Eingang des kleinen Seitentals, in dem Tashina saß, erschien ein Mann, und obgleich Tashina in der Nacht die Farben seiner Kleidung nicht unterscheiden konnte, wusste sie sofort, dass es der Weiße mit dem braun-roten Hemd war, den sie in der Halle des Flughafens von New City gesehen hatte. Aus den Rufen und aus den Richtungen, aus denen Schüsse fielen, machte sie sich ein Bild von dem Stand des Gefechts. Offenbar hielten zwei oder drei Stonehorn in Schach. Sie feuerten immer wieder, und er antwortete sparsam. Er konnte seine Deckung offenbar nicht mehr verlassen. Ein weiterer seiner Feinde, und das musste der Mann im braun-rot karierten Hemd sein, sollte ihn umgehen und aus dem Hinterhalt niederschießen.
Aber als er Tashina vor sich hatte, kam diesem Karierten ein anderer, noch gemeinerer, wenn auch weniger kluger Gedanke. »He! Komm her, Stonehorn, du Schlappschwanz, ich hab hier dein Täubchen …«
Tashina begriff, dass sie jetzt dazu dienen sollte, ihren Mann aus der Deckung herauszuholen.
Sie erhob sich, um rascher handeln zu können. Tashina wollte sich nicht ergeben.
Dem Kerl im braunkarierten Hemd erschien das Mädchen schön, wenn er es auch nur als Schattenriss in der Nacht sehen konnte.
»Moment,..«, in seinem Tonfall klang ein Zwinkern mit. »Nachher! Ich servier dir Stonehorn zum Frühstück.«
Er wurde sich seiner ursprünglichen Mordaufgabe wieder bewusst und huschte weiter.
Tashina ließ die Messerklinge in die Erde sausen und wagte es, auf eine ganz andere Weise den Feind anzugreifen, um ihren Mann zu retten.
Der Karierte hatte das Gefühl, dass ihm eine Raubkatze von hinten in den Nacken sprang. Gewicht und Schwung brachten ihn, der von dieser Seite auf nichts gefasst gewesen war, zum Sturz. Der Revolver fiel ihm aus der Hand. Tashina hatte die Waffe schon, ehe er sich besinnen konnte. Sie zielte, als er sich aufrichtete. Auf der Ranch des Vaters hatte sie Waffen handhaben gelernt.
»Hands up!«
Als er nicht gehorchen wollte, schoss sie sofort. Er lag im Gras, und im Übermaß der Erregung und Erleichterung, auch in der Absicht, ihren Mann zu verständigen, stieß sie den schrillen Siegesruf ihrer Vorfahren aus.
Ein kurzer ähnlicher Schrei antwortete. Stonehorn lebte noch, und es schien, dass es ihm gelungen war, seinen Standort noch einmal zu wechseln. Seine Gegner hatten wohl eine Sekunde zu lange auf Tashinas Schuss und ihren schrillen Schrei gehorcht.
Das Feuergefecht setzte wieder ein. Aber jetzt war es einer, der die anderen jagte.
Endlich wurde es still.
Dann ertönte ein einzelner Pfiff. Er klang nicht schrill, sondern melodisch. Das Pferd setzte sich in Bewegung. Sicher galoppierte es seinem Herrn zu.
Tashina sah Inya-he-yukan in dieser Nacht nicht mehr. Lautlosigkeit legte sich über zerstörte Wege, niedergedrücktes Gras, gebrochene Bäume, lehmgefärbte Bäche … und über die Toten.
Tashina überlegte mit jener kühlen Berechnung, mit der sie den Raum für ein Bild einzuteilen pflegte, wenn die Leidenschaft der Intuition das Gesicht, dem sie Ausdruck geben wollte, schon geschaffen hatte.
Stonehorn war fortgeritten. Er hatte kein Wort mehr zu ihr gesagt, vielleicht keines mehr sagen können, wenn er noch jemand zu verfolgen hatte. Aber sie war seine Frau, und also musste er glauben, dass sie nun entschlossen genug sein würde, das Richtige zu tun. Tashina hätte versuchen können, nach den Toten zu sehen, aber der Gedanke daran kam ihr in diesem Augenblick nicht.
In einer Unwetternacht hatten Banditen ein scheußliches Verbrechen geplant und waren dafür mit dem Tode bestraft worden. Es erschien ihr im Grunde alles sehr einfach, und was hier geschehen war, ging auch niemanden etwas an als Inya-he-yukan und Tashina. Jedermann würde froh sein, in dieser Sache nicht weiter forschen zu müssen. Jedermann würde aufatmen, weil solche Banditen niemanden mehr bedrohen konnten.
Tashina warf den Revolver weg. Sie machte sich aus den nassen Fetzen wieder eine Kleidung zurecht und lief auf einen Hügel, ohne mit ihren Mokassins dabei viel Spuren zu hinterlassen. Von der Hügelkuppe aus orientierte sie sich. Sie wollte zu ihrem Wagen zurück und sehen, was davon noch übriggeblieben war.
Sie fand den Wagen. Das Wasser war im Sinken und Abfließen. Es gelang ihr, das Päckchen mit Fleisch und das Vollkornbrot herauszuholen, mit einiger Mühe schließlich auch ihr Köfferchen. Sie packte die Päckchen in den Koffer und machte sich zu Fuß auf den Weg zu der Ranch ihres Vaters. Die Luft war ganz ruhig, die Morgendämmerung zog herauf. Am Himmel leuchtete der Morgenstern, das sah Tashina als ein gutes Zeichen an. Von Übermüdung spürte sie nichts mehr. Sie lief schnell und ausdauernd. Zu Fuß war leichter voranzukommen als mit dem Wagen. Am schnellsten würde Stonehorn mit seinem Pferd sein. Es war ein prächtiges Tier, das hatte Tashina auch in der Nacht erkannt.
Ihr Mann lebte. Eine andere Gewissheit brauchte sie nicht.
Ein schwarzes Korn geht auf
Die beiden kleinen Indianermädchen und ihr Bruder, der erst drei Jahre alt war, standen auf einer Anhöhe und lugten in die Richtung, aus der ihre große Schwester Queenie-Tashina kommen musste … wenn sie endlich kam. Die jüngeren Geschwister hatten schon am Abend vorher viel ungeduldiger gewartet als Vater und Mutter und Großmutter.
Der Vater arbeitete auf dem Dach des Holzhauses, das vom Sturm beschädigt worden war. Die Mutter bereitete alles vor, damit die Laube aus Kiefernzweigen, die als Sonnen-, Wind- und Regenschutz für einen Werkstattplatz des Ranchers zu dienen pflegte, wieder aufgerichtet werden konnte. Einen Blick warf sie auf das zerstörte Gemüsebeet. Schlamm lag darüber. Doch ein Autowrack, zum Ausschlachten bereit, hatte die Sturmnacht überstanden.
Ein braver Brauner weidete das nasse Gras und zuckte und zitterte hin und wieder mit dem Fell. Die Sonne schien schon wieder warm. Der Weg, der aus der Prärie zu dem Haus führte, war noch voller Lachen und Rinnsale. Es würde wohl noch einige Stunden dauern, ehe man wieder mit dem Wagen durchkam. Helles Jubelgeschrei der drei Kinder auf der Anhöhe meldete aber den Eltern, dass Queenie in Sicht sei.
Vater und Mutter blickten erstaunt auf. Das hatten sie nicht erwartet. Die Großmutter kam aus dem kleinen Haus, noch das Leder in der Hand, das sie mit alten Mustern besticken wollte, um es an das Museum in New City zu verkaufen.
Als Queenie ohne Wagen mit nasser zerrissener Kleidung, aber das Köfferchen in der Hand vor den Augen der Eltern auftauchte, war sie sich bewusst, dass ihr Aufzug einige Überraschung auslösen musste. Doch die Eltern und die Großmutter brachen nicht in laute Rufe oder Fragen aus, sondern weiteten die Augen nur ein wenig, gespannt, von Queenie den Hergang überraschender Ereignisse zu erfahren. Die jüngeren Geschwister hingen schon an ihrer Hand, und der kleine Bruder krähte seine Frage nach dem fehlenden Wagen in den im übrigen ohne Zweifel wunderschönen Morgen hinein.
Als die stumme Begrüßung vorüber war, öffnete Queenie das Köfferchen, gab der Mutter das Fleisch – ein Geschenk, über das sich die ganze Familie freute –, zog ein paar trockene Sachen der Mutter an und machte sich über ein Stück nasses Vollkornbrot her.
»Wir müssen gleich nach dem Wagen sehen«, sagte sie dabei zu ihrem Vater, der sich mit im Hause eingefunden hatte. »Der Sturm hat mich weggeweht und den Wagen auf einen Talgrund geworfen.«
»Henry ist beim Wagen geblieben«, bemerkte der Vater, eigentlich nicht als Frage, sondern nur als Erläuterung, denn dies erschien ihm selbstverständlich.
Queenie suchte ihre Verlegenheit zu verbergen. »Henry war wohl krank … ich habe ihn bei Elk in New City gelassen.«
Elk galt als einer der vertrauenswürdigen Männer. Die Eltern hatten zu Queenies Auskunft also nichts weiter zu bemerken, aber in der Mutter stieg eine Sorge auf, das sah Queenie ihr an. Wenn Henry so krank war, dass ihn Queenie nicht einmal im Wagen hatte mitnehmen können, musste es wohl schlimm um ihn stehen.
Der Vater machte sich mit seiner ältesten Tochter auf den Weg. Er nahm einiges Werkzeug mit. Vielleicht konnte er den Wagen an Ort und Stelle wieder fahrbereit machen. Der Fünfzigjährige hatte einen sehr guten Schritt. Queenie strengte sich an, um mitzukommen, ohne den Vater aufzuhalten. Hoch in den Lüften sah sie zwei Geier schweben. Sie war der eine der beiden Menschen, die schon wussten, was diese Vögel anzog und worauf sie lauerten.
Queenie musste kräftig mithelfen, als der Vater den Wagen wieder auf die Räder stellte. Der Wagen hatte am Hang gelegen, schon etwas schräg, dadurch war die Arbeit für die beiden zu schaffen. Der Vater stellte die Motorhaube auf, damit alles schneller abtrocknen konnte, prüfte dies und jenes durch und fragte dabei: »Was ist mit Henry?«
»Er hatte getrunken.«
Der Vater schaute rasch, beinahe entsetzt auf.
Er sagte aber nichts, sondern beschäftigte sich mit dem Kabel der Batterie, das wieder locker geworden war.
»Was habt ihr denn nur mit dem Wagen gemacht!«
Queenie bemerkte dazu nichts.
»Hast du das Schießen heute nacht gehört?«
»Ja.«
Der Vater betrachtete das zersplitterte Fenster.
»Ich habe es durchstoßen, um herauszukriechen«, erklärte Queenie. »Hier im Tal ist das Wasser geströmt wie in einem Fluss.«
»Ah, so.«
»Ich habe etwas verdient, und ein Kleid kann ich mir wieder kaufen. Ich habe viel Geld verdient, das habe ich bei Elk gelassen.«
»Ja. Schon gut.«
Der Vater sah hinauf zum Himmel und beobachtete die Aasvögel.
»Es gibt solche Vögel … und es gibt auch solche Menschen …«, sagte er. Das war alles, was er sagte oder zu fragen hatte. Vater und Tochter warteten zwei Stunden. Es saß sich schön und ruhig in der Sonne und in dem sanften Wind. Als der Wagen gut abgetrocknet war und auch die Wege schon wieder in einen Zustand kamen, der von einem Indianer als fahrbar angesehen wurde, ließ der Vater den Motor an. Die Zündung funktionierte, und die Fahrt nach Hause ging ohne Unterbrechung vonstatten.
Queenie machte sich daheim an die Gartenarbeit. In den Ferien war das Gärtchen immer ihrer persönlichen Obhut anvertraut. Sie holte sich Wasser von dem Pumpbrunnen, den sich der verstorbene Großvater und der Vater in jahrelanger mühseliger Arbeit selbst gebaut hatten. Mit Wasser ließ sich die Erde, die die Gemüsebeete überschlammt hatte, vorsichtig auflösen, noch ehe sie trocknete und hart wurde.
Es war, als ob das Blut in Tashinas Adern schneller strömte und die Sonne in ihren Augen heller glänzte, weil ein Glanz von innen ihr entgegenkam.
Das Unwetter hatte zahlreiche Schäden angerichtet, und in den nächsten Tagen war man allerorts mit Reparaturen beschäftigt. Die laufende Arbeit wurde dadurch überall aufgehalten, auf den Ranches, in den Büros, selbst in der Angelhakenfabrik, deren Dach abgedeckt war. Die Gerichtstermine konnten zum Teil nicht eingehalten werden, und das Krankenhaus war durch die Aufnahme von Unfallopfern des Sturms überbelegt. Viele Leute, die ihre Verwandten besuchten, blieben einige Tage länger, um abzuwarten, bis die Wege wieder leichter befahrbar wurden. Der alte Isaac Booth fand es daher zunächst nicht besorgniserregend, dass sich sein Sohn Harold nicht blicken ließ.
Erst zehn Tage später kam wie durch Zufall das Gespräch darauf. Mutter Booth kaufte frühmorgens im Supermarkt an der Agenturstraße ein, Eier, Mehl … Früchte? Nein, Früchte nicht, denn das Geld war immer knapp, die Ranch sollte noch vergrößert und die Pacht an den Stammesrat immer pünktlich bezahlt werden.
»Wie geht es denn Harold?« erkundigte sich die Kassiererin, in deren Adern einige Tropfen Indianerblut flossen.
Die Mutter, die sich um den tagelang ausbleibenden Sohn viel mehr sorgte als der Vater, witterte irgendeine Bedeutsamkeit in der Frage.
»Warum? Haben Sie Harold kürzlich gesehen? Gut vor einer Woche, meine ich. Er wollte hier für uns einkaufen.«
»Ja, das wollte er wohl.« Jetzt war es an der Kassiererin, einem interessanten Fall auf die Spur zu kommen. »Aber dann hat er doch nicht eingekauft.«
»Dann hat er doch nicht eingekauft.« Die ängstlich gespannten Augen der Mutter erweckten in der Frau an der Kasse die Erwartung auf einen wahren Kriminalroman. Ein Glück, dass sich außer Mutter Booth im Augenblick kein Kunde im Laden befand. Die Kassiererin konnte die Angelegenheit spannend machen. »Ich habe mich auch gewundert«, ließ sie zunächst nur verlauten.
»Ach – Sie haben ihn gesehen, obgleich er nicht in den Laden kam?«
»So ungefähr.«
Jetzt trat doch ein Kunde ein, holte sich eine Kleinigkeit, zahlte und ging.
Die Kassiererin konnte endlich fortfahren. »Dort drüben hat er gestanden, drüben auf der anderen Straßenseite.« Sie lächelte verstohlen.
»Warum kam er denn nicht herein?« fragte Mutter Booth.
»Was weiß ich! Ich meine – das kann ich ja nun auch nicht wissen, warum sich der junge Mr Booth anders entschlossen hat.«
»Haben Sie noch gesehen, dass er wegging?«
»Ja, das habe ich wohl noch gesehen. Ich habe hier auch viel zu tun und kann nicht einfach aus dem Fenster schauen – entschuldigen Sie. Ich glaube, er fuhr mit einem fremden Wagen weg.«
Die Tür war wieder aufgegangen. Drei Kunden traten ein. Sie hatten erst lange zu wählen, um viele gute Sachen und wenig Geld irgendwie in Einklang zu bringen.
»In welche Richtung fuhr er denn?« forschte Mutter Booth aufgeregt.
»Ich kann keine Eide leisten. Ich glaube, er fuhr zurück, wieder in die Agenturstraße hinein, die er entlanggekommen war.«
Der Mutter standen die Tränen in den Augen. »Er ist seitdem nicht mehr nach Hause gekommen.«
»Jesus Christus! Nicht nach Hause gekommen! Es wird doch nicht etwa … So ein guter Sohn … Haben Sie denn schon nachforschen lassen, Mrs Booth?«
»Nachforschen? Aber Sie werden doch nicht denken, dass ihm etwas passiert ist?«
»Wo werde ich denn so etwas denken. Doch nicht hier auf heller Straße, mitten in der Agentur.«
»Es war der Tag – erinnern Sie sich –, das war doch der Tag, an dem der furchtbare Sturm einsetzte …«
»Aber ganz richtig, ganz genau.«
»Wenn ihm nun mit dem Wagen irgend etwas … zugestoßen … Also er ist zu den Agenturgebäuden zurückgefahren?«
»Könnte auch umgekehrt gewesen sein. Sehen Sie, es fiel mir überhaupt nur ein, aus dem Fenster zu schauen, weil …«
»Weil …?«
Es trat eine längere Pause ein, da die drei Kunden sehr umständlich zahlten und packten.
»Weil es mir doch unheimlich vorkam«, konnte die Kassiererin endlich fortfahren. »Man hat manchmal ein Gefühl, ganz ohne Verstand! Weil es mir also unheimlich vorkam … dass …«
» … dass …? So reden Sie doch!«
»Ja, dass drüben der junge Mr Booth stand, und hier beim Schaufenster stand Joe – Joe King.«
»Joe King?!«
»Ja. Und Queenie kam ausgerechnet dazwischen.«
Die Mutter schaute die Kassiererin einige Sekunden entgeistert an. Dann vergaß sie fast zu zahlen, legte schließlich ein zu großes Geldstück hin, ohne sich herausgeben zu lassen – was ihren Gewohnheiten durchaus widersprach –, und stürzte aus der Tür hinaus, zu dem Wagen hin, in dem ihr Mann, schon sehr ungeduldiger Stimmung, am Steuer saß.
»Isaac!« Sie hatte sich noch nicht gesetzt, sondern stand, vorgebeugt, an der offenen Autotür und schob die Einkäufe auf dem Hintersitz zurecht. »Isaac … Harold ist ermordet. Joe King hat das getan. Wir müssen sofort Anzeige erstatten.«
Mr. Booth senior war durch das Gehabe seiner Frau etwas aus dem Gleichgewicht gebracht. Mammy war ein Halbblut, eine fleißige Ranchersfrau, kümmerte sich stets um die Kleintierzucht, die von vielen Indianerinnen verachtet wurde, und passte sich daheim der schweigsamen Atmosphäre der Ranch an. Vielleicht war Harold der einzige, dem ihre natürliche Redseligkeit nicht lästig war, weil er selbst gern plauderte, und vielleicht rührte auch daher die besondere Liebe der Mutter für diesen ihren jüngsten Sohn. Aber die Unterhaltung mit Harold reichte nicht aus.