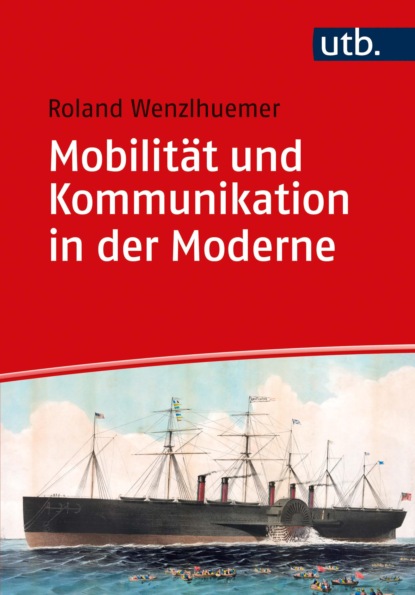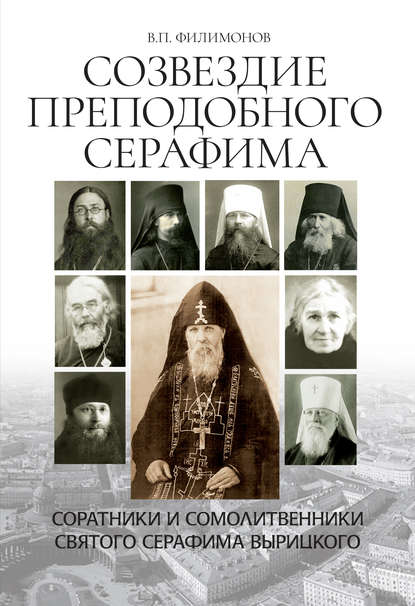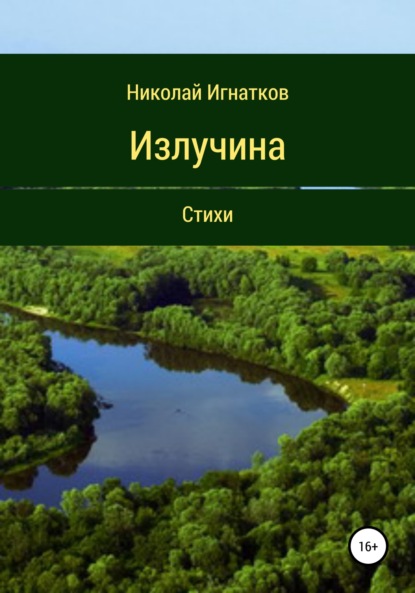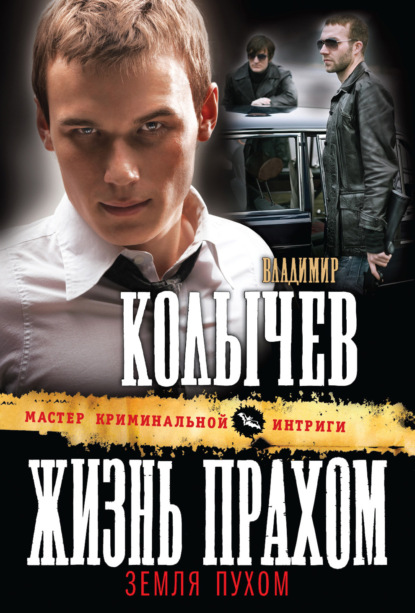- -
- 100%
- +
Ein solcher Fokus auf transformative Prozesse hat natürlich auch blinde Flecken. Wichtige Inhalte und Themen der Mobilitäts- und Kommunikationsgeschichte haben in diesem Zugang nicht den ihnen vielleicht zustehenden prominenten Platz gefunden und hinterlassen unbefriedigende Leerstellen. Beispielsweise konnten Migrationsbewegungen, die eine so prägende Rolle in der Geschichte der Moderne einnehmen, nicht wirklich systematisch erörtert werden. Sie tauchen an vielen Stellen im Buch auf, nehmen analytisch aber keine zentrale Position ein. Zudem wird kaum einmal gezielt über den sich im 19. Jahrhundert intensivierenden Tourismus gesprochen oder über die damit oft in Verbindung stehende Praxis des Reiseberichts, der auch in seiner Funktion als historische Quelle Beachtung verdient hätte. Überhaupt kommen Reiseerfahrungen, die unter anderem in kulturhistorischen Zugängen zur Mobilität zentral sind,[6] in diesem Buch zu kurz. Und auch zu einzelnen Trägertechnologien oder Mobilitätserscheinungen hätte man viel mehr sagen können: über die Bedeutung des Straßenbaues, über das nordenglische Kanalsystem[7] oder vielleicht über das Grand Hotel.[8] Zusätzlich dazu werden jeder Leserin und jedem Leser entlang der eigenen Interessen weitere Leerstellen auffallen. All diese Auslassungen sind schmerzlich, ließen sich aber aus dem prozessualen Zugang des Buches heraus schwerlich vermeiden. Umso weniger kann und will diese Einführung einen Anspruch auf eine vollständige Abbildung der Mobilitäts- und Kommunikationsgeschichte der Moderne erheben.
Untersuchungsrahmen
Jedes der acht thematischen Kapitel beginnt mit einem anschaulichen, manchmal außergewöhnlichen Beispiel, dessen Ziel es ist, den Kern des besprochenen Großprozesses freizulegen. Diese historischen Episoden stammen aus dem Repertoire des Autors und spiegeln dementsprechend dessen partikulare Expertise und Forschungsinteressen wider. Sie stammen zu einem überwiegenden Teil aus einem britischen oder einem britisch-imperialen historischen Zusammenhang (vom nur forschungsbiografisch zu erklärenden Übergewicht telegrafischer Beispiele einmal ganz zu schweigen) und sind damit in ihrer Auswahl ebenso wenig repräsentativ für die gesamte moderne Geschichte von Mobilität und Kommunikation wie der Inhalt der Kapitel selbst. Es kann allerdings auch nicht der Anspruch dieses dünnen Bandes sein, sich möglichst umfassend mit dem in seiner Gesamtheit kaum zu überblickenden Untersuchungsgegenstand zu beschäftigen. Vielmehr soll dieser in seiner historischen Bedeutung erfassbar und zugänglich gemacht werden. In diesem Licht ist auch die Auswahl der acht Großprozesse zu sehen. Auch hier hätte man natürlich andere Prozesse und Entwicklungen auswählen können. Es handelt sich bei den acht ausgewählten Zugängen nicht um eine abgeschlossene Liste oder – schlimmer noch – um einen wie auch immer gearteten Kanon der Mobilitäts- und Kommunikationsgeschichte. Vielmehr spiegelt die Auswahl den Versuch, nachvollziehbare und analytisch sinnvolle Schneisen in einen schwer zu überblickenden Gegenstand zu schlagen und dadurch dessen umfassende gesellschaftliche Bedeutung besser nachvollziehbar zu machen, wider.
Das Buch betrachtet seinen Gegenstand in einem zeitlich wie auch räumlich begrenzten Untersuchungsrahmen. Es fokussiert auf die Geschichte von Mobilität und Kommunikation in einem weitgehend europäischen, europäisch-kolonialen oder – wie zum Beispiel im Fall der Vereinigten Staaten – europäisch-postkolonialen Kontext. Entwicklungen außerhalb dieser Regionen und Kulturen bleiben in der vorliegenden Darstellung weitgehend unberücksichtigt. Ebenso eng umrissen ist der Betrachtungszeitraum. Dieser liegt hauptsächlich im so genannten „langen 19. Jahrhundert“, das grob den Zeitraum von den Atlantischen Revolutionen im ausgehenden 18. Jahrhundert bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs beschreibt. Bisweilen blickt das Buch aber auch ganz bewusst über diesen zeitlichen Fokus hinaus – besonders deutlich etwa in Kapitel III.3 zu Fragen der Kommodifizierung von Information oder in Kapitel III.8 zu Digitalisierungsprozessen.
Die Festlegung sowohl des räumlichen wie auch des zeitlichen Rahmens ist somit aus dem Blick auf die europäische Geschichte abgeleitet. Dies ist eine bewusste Eingrenzung des Gegenstands, die zum einen den professionellen Limitationen des Autors Rechnung trägt. Andererseits kann dieser analytische Eurozentrismus hoffentlich einen noch schädlicheren normativen Eurozentrismus verhindern. Viele der größeren Entwicklungen, die dieses Buch im Bereich von Mobilität und Kommunikation untersucht, sind in der Art und Weise, wie sie hier betrachtet werden, Ausprägungen einer spezifischen europäischen Moderne, die nicht ohne weiteres auf andere Weltregionen oder Kulturen umgelegt werden kann. Dieses Buch will durch seinen Fokus auf die europäische Geschichte keinesfalls europäische Idee, Praktiken und Entwicklungen zu einem Maßstab erhöhen, an dem sich andere messen lassen müssen.
[1] New York Sun, 26.08.1864.
[2] Eine detaillierte und dennoch gut lesbare Rekonstruktion des Mordfalls findet sich u. a. bei: Colquhoun; eine Erörterung des Falls auf Basis des Gerichtsprozesses wurde schon vor längerer Zeit hier vorgenommen: Knott u. Irving; Zudem sind die Unterlagen des Verfahrens auch einsehbar: Trial of Franz Muller.
[3] Hoerder, Migrations and Belongings; ders, Geschichte der deutschen Migration; ders. u. Moch, European Migrants; Bade.
[4] Regulation of Railways Act 1868, III. Provisions for Safety of Passengers.
[5] Gibbs, S. 116.
[6] Zum Beispiel Schivelbusch, S. 51‒66; Krajewski, S. 25.
[7] Bagwell, S. 15‒34.
[8] Knoch.
1. Mobilitätsgeschichte
Dieses Kapitel versucht zu vermitteln, auf welchen theoretischen Zugängen die historiografische Beschäftigung mit Mobilität und Kommunikation beruht bzw. beruhen kann. Es will verschiedene Fragestellungen und Erkenntnisinteressen im Zusammenhang der Mobilitäts- und Kommunikationsgeschichte vorstellen und dieses Feld damit vor allem im größeren Rahmen der Geschichtswissenschaft verorten. Genau dazu dienen theoretische Überlegungen in der Wissenschaft. Idealerweise bilden sie den Übergang vom Kleinen ins Große, vom Spezifischen zum Allgemeinen. Sie verweisen darauf, welche Rolle ein Untersuchungsgegenstand in einem größeren, gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang spielt. Sie machen deutlich, an welche grundlegenden Fragen und Problemstellungen eine Arbeit anschließen will und kann, zu welchen breiteren Diskussionen sie einen Beitrag leistet. Theorie ist also, um eine Mobilitätsmetapher zu bemühen, eine Brücke – eine Brücke zwischen dem Forschungsgegenstand und dem größeren gesamtgesellschaftlichen Rahmen.
Theorie leitet Forschung und verortet die Forschungsergebnisse. Um das zu gewährleisten, müssen theoretische Überlegungen weder besonders ausführlich noch besonders abstrakt oder kompliziert formuliert sein. Sie sollen schlicht dafür sorgen, dass die Bearbeitung eines bestimmten Gegenstandsbereichs auch zur Beantwortung von Fragen außerhalb des eng abgesteckten Beobachtungsrahmens beitragen kann. Im Zusammenhang der Mobilitäts- und Kommunikationsgeschichte tauchen dabei unter anderem folgende grundlegenden Fragen auf: Was ist eigentlich die Rolle kommunikations- oder mobilitätshistorischer Studien in einem größeren geschichts- oder kulturwissenschaftlichen Zusammenhang? Aus welcher Perspektive blicken wir auf historische Transportmittel, Mobilitätsformen oder Kommunikationsweisen? Jenseits einer reinen Beschreibung historischer Sachverhalte: Was wollen wir eigentlich wissen? Welche Aspekte betonen wir, welche vernachlässigen wir? Welchen Gültigkeitsbereich haben die Ergebnisse, die wir erhalten? Zu welchen gesellschaftlichen Diskussionen können sie beitragen?
Das sind zunächst einmal keine komplizierten Fragen, die zweckdienliche Auseinandersetzung mit ihnen kann aber wissenschaftlich durchaus herausfordernd sein und braucht eine enge Abstimmung zwischen theoretischem Anspruch und empirischem Vorgehen. Dieses Kapitel will den forschungsleitenden Charakter von theoretischen Zugängen zur Mobilitäts- und Kommunikationsgeschichte anhand konkreter Beispiele herausarbeiten. Dazu wird es in einem ersten Schritt einen gerafften Überblick über die Entwicklung der historiografischen Beschäftigung mit Transport und Kommunikation geben und im Zuge dessen auch das in diesem Buch verwendete Verständnis von Mobilitätsgeschichte skizzieren. Im Anschluss greift das Kapitel vier historisch-theoretische Zugänge zum Thema Mobilität und Kommunikation heraus und stellt deren spezifische Erkenntnisinteressen vor. Exemplarisch behandelt werden in dieser Hinsicht technik-, wirtschafts-, kultur- und globalgeschichtliche Ansätze. Diese Auswahl stellt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch auf exakte Trennschärfe. Die verschiedenen Zugänge überlappen sich in ihren Fragen und Interessen, und natürlich sind auch andere Perspektive auf Mobilität und Kommunikation genauso valide. Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch, dass die ausgewählten Ansätze analytisch nicht notwendigerweise auf derselben Stufe stehen. So informieren technikhistorische Fragestellungen nach der Rolle von Technologien in historischen Gesellschaften alle anderen Ansätze implizit oder explizit mit, da Transport und Kommunikation zumeist in ihrer technisch vermittelten Form untersucht werden. Ähnliches gilt in gewisser Weise für die Globalgeschichte, die nach der historischen Bedeutung von transregionalen oder transkulturellen Verbindungen fragt und damit in der Mobilitätgeschichte ein natürliches Untersuchungsfeld findet.
Mit dem Aufkommen globalhistorischer Forschungsinteressen und sicherlich auch aus aktuellen gesellschaftlichen Globalisierungserfahrungen heraus stehen Themen wie menschliche Mobilität oder Kommunikation seit einigen Jahren vermehrt im Fokus der Geschichtswissenschaft. Insgesamt ist dieses Interesse aber noch verhältnismäßig jung.[1] Das gesamte 20. Jahrhundert hindurch hat sich das Fach hauptsächlich für klar Umgrenztes, Stabiles, Gegebenes interessiert. In dieser Zeit stellte der Nationalstaat den maßgebenden Forschungsrahmen dar. Fragen nach der gesellschaftlichen Bedeutung der Bewegung von Menschen, Waren und Ideen spielten aus dieser Perspektive heraus – insbesondere, wenn sie nationale Grenzen überschritten – eine untergeordnete Rolle. Das heißt aber nicht, dass sich die Geschichtswissenschaft in dieser Zeit überhaupt nicht für Verkehr und Transport interessiert hätte. Im Gegenteil, die Verkehrs- bzw. Transportgeschichte (vgl. in der englischsprachigen Forschung transport history) entwickelte sich bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts schrittweise zu einem eigenständigen Subfeld der Disziplin. Sie fokussierte dabei aber weniger auf die Bewegung von Menschen oder Waren, war also wenig an Mobilität im eigentlichen Sinn interessiert, sondern nahm vor allem einzelne Verkehrsmittel aus technik- oder wirtschaftshistorischer Perspektive in den Blick. Das heißt, die Verkehrsgeschichte fragte vor allem nach der technischen Entwicklung von Transportmitteln und nach deren wirtschaftlicher Bedeutung. Und sie tat dies üblicherweise in einem nationalstaatlichen bzw. nationalökonomischen Rahmen. Im Laufe der Zeit kamen unternehmensgeschichtliche und zum Teil auch sozialgeschichtliche Fragestellungen hinzu. Die Verkehrsgeschichte orientierte sich dabei vor allem an der Angebotsseite von Mobilität und nutzte das jeweilige Verkehrsmittel als ihren zentralen analytischen Zugang. Ein Hauptaugenmerk galt dabei traditionell der Eisenbahngeschichte, der etwa auch im wichtigsten Fachorgan der englischsprachigen Forschung – dem Journal of Transport History – der bei weitem größte Teil aller Publikationen gewidmet war.[2] Die Geschichte der Eisenbahn wurde in diesem Zusammenhang zumeist in einem nationalstaatlichen Kontext verortet. Das zweite große Interessenfeld neben der Eisenbahn, die maritime history , begann in den 1970ern allerdings, diesen engen nationalen Beobachtungsrahmen allmählich aufzubrechen.
Der nach Transportmitteln kompartmentalisierte Blick der Verkehrsgeschichte gepaart mit einem nationalgeschichtlichen Zuschnitt und hauptsächlich technik- und wirtschaftshistorischen Erkenntnisinteressen weist einige blinde Flecken auf, die gegen Ende des 20. Jahrhunderts immer deutlicher hervorzutreten begannen. Ein zentrales Problem war die Tendenz der Verkehrsgeschichte, aus ihrer speziellen Perspektive heraus implizit oder explizit eine reine Fortschrittsgeschichte von Transport und Kommunikation zu schreiben. Das heißt, dass viele transportgeschichtliche Studien auf der Annahme beruhten, dass Verkehrsmittel immer wieder fast zwangsweise von besseren und schnelleren Alternativen abgelöst würden. Ein solcher Ansatz bleibt für das Nebeneinander und vor allem für das Miteinander verschiedener Transport- und Kommunikationsmittel blind. Er ignoriert einerseits, dass in der Geschichte immer Technologien ganz unterschiedlichen Zuschnitts parallel zueinander existiert und ganz andere gesellschaftliche Rollen gespielt haben. Er kann demnach die „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ nicht adäquat abbilden. Zudem anerkennt ein solcher Ansatz auch nicht das Ineinandergreifen verschiedener Verkehrsmittel zum Beispiel in logistischen Ketten. In dieser Form leistete die Verkehrs- bzw. Transportgeschichte häufig einem unhinterfragten Technikdeterminismus Vorschub, der auch in der klassischen Technikgeschichte lange Zeit eine häufige Erscheinung war. Das heißt, dass der analytische Fokus auf die technische Seite von Mobilität, kombiniert mit einem ausgeprägten Fortschrittsglauben, Technologien – in diesem Fall Verkehrstechnologie – zu Taktgebern der gesellschaftlichen Entwicklung macht. Aus einer solchen Perspektive führen neue Verkehrsmittel und technische Verbesserungen zu sozialen, ökonomischen und kulturellen Veränderungen. Die Nutzer haben hier kaum Wahl- oder Einflussmöglichkeiten. Die kulturelle Bedeutung und Wirkung von Mobilität und Kommunikation spielt keine Rolle. Schließlich ignorierte die traditionelle Verkehrsgeschichte auch weitgehend, dass verschiedene Gruppen von Menschen zur gleichen Zeit unterschiedliche Bedürfnisse nach Mobilität und auch unterschiedliche Zugänge zu Transport- und Kommunikationsmitteln hatten. Sie kann damit Valeska Hubers in Anlehnung an Shmuel Eisenstadt formulierter Idee der multiple mobilities nicht gerecht werden.[3]
Manche dieser Schwächen und auch einige andere Punkte – wie zum Beispiel die Tatsache, dass ein verkehrsmittelzentrierter Blick Mobilitätsformen wie etwa das Zu-Fuß-Gehen nicht adäquat berücksichtigen kann – hat die Verkehrs- bzw. Transportgeschichte vor allem in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts selbst erkannt und adressiert. So konnte man im Feld zunehmend Schritte hin zu einer so genannten „integrierten Verkehrsgeschichte“ erkennen, die verschiedene Verkehrsformen auch in ihrem Verhältnis nebeneinander und zueinander untersucht. Diese Entwicklung ging vielen Mobilitätshistorikern aber nicht weit genug. Daher wurden zu Beginn des 21. Jahrhunderts vermehrt Forderungen nach einer neuen Form der historiografischen Beschäftigung mit Transport und Kommunikation laut. Der Automobilhistoriker Gijs Mom hat diese im Jahr 2003 im Journal of Transport History selbst formuliert und anstatt einer Verkehrs- bzw. Transportgeschichte nach einer Mobilitätsgeschichte verlangt, die sich nicht mit Mitteln des Transports, sondern mit der Bewegung von Menschen und Gütern als kulturelle Praxis auseinandersetzen soll.[4] Begünstigt auch durch die Popularität globalhistorischer Forschungsinteressen ist dieses Verständnis der Mobilitätsgeschichte in den letzten eineinhalb Jahrzehnten auf breite Resonanz gestoßen und hat sich als äußert produktiv erwiesen. Zunehmend lösen sich hier nun auch die Grenzen zwischen der Transport- und der Kommunikationsgeschichte auf, die in älteren Ansätzen noch klar gezogen waren. Es ist dieses Verständnis der jüngeren Mobilitätsgeschichte, das dem vorliegenden Buch zugrunde liegt; ein Verständnis, das die technische und ökonomische Seite sicherlich nicht ignoriert, Mobilität gleichzeitig aber als soziokulturelle Praxis sieht; ein Verständnis, das Transport und Kommunikation nicht getrennt denkt, sondern in ihrer wechselseitigen Beziehung (wie beispielsweise in Kapitel III.2 anhand des Prozesses der Dematerialisierung besonders deutlich wird); ein Verständnis, das die Idee multipler Mobilitäten ernst nimmt und versucht, diese auch adäquat abzubilden.
Dieses Konzept einer breit angelegten Mobilitätsgeschichte hat sich mittlerweile in der Geschichtswissenschaft als analytisch produktiver Zugang fest etabliert. Innerhalb dieses integrativen Ansatzes gibt es aber natürlich auch weiterhin ganz unterschiedliche Problemstellungen und Erkenntnisinteressen, die entsprechend unterschiedliche Gewichtungen in ihrer Betrachtung von historischer Mobilität vornehmen. Sie interessieren sich für jeweils eigene Aspekte der Geschichte von Transport und Kommunikation und setzen dabei entweder auf etablierten Zugängen auf oder entwickeln eigene Fragestellungen. Es handelt sich dabei allerdings nicht um klar voneinander abgrenzbare Strömungen mit klar umrissenen Vorgaben und Problemen, sondern um sich überlappende Perspektiven, die – zumindest aus der Sicht der heutigen Mobilitätsgeschichte – nicht ohneeinander zu denken sind. Im Folgenden werden vier solche Blickwinkel exemplarisch herausgegriffen und vor allem hinsichtlich ihres Erkenntnisinteresses und Erklärungspotentials kurz vorgestellt. Es handelt sich dabei um technik-, wirtschafts-, kultur- und globalgeschichtliche Fragestellungen. In ihrer Zusammenschau bilden diese vier die gesellschaftliche Bedeutung von Mobilität eindrucksvoll ab. Die Zusammenstellung ist aber sicherlich nicht vollständig. Viele Fragen jenseits dieser Bereiche sind ebenso lohnend.
[1] Huber, Multiple Mobilities, S. 317.
[2] Mom, S. 126.
[3] Huber, Multiple Mobilities.
[4] Mom, S. 132.
2. Technikgeschichtliche Perspektiven
Was bedeutet es eigentlich für Reisende wie Reeder, dass Dampfmaschinen lange einen vergleichsweise geringen Energieeffizienzgrad hatten und daher viele Dampfschiffe im 19. Jahrhundert auf weiten Überfahrten Kohle nachladen mussten? Wie wirkt sich der Umstand, dass lange Zeit nur Textinhalte per Telegraf übermittelt werden konnten, auf die Kommunikationspraxis aus? Welche Inhalte wurden so privilegiert, welche mussten mit anderen Medien übermittelt werden? Kurz, welche Rolle spielen eigentlich die technischen Grundlagen von Mobilität und Kommunikation in der Vergangenheit? Diese und ähnliche Fragen interessieren die Technikgeschichte.
Der Mensch ist ein Werkzeugmacher und -nutzer, ein homo faber. Er nutzt seit jeher technische Hilfsmittel, um bestimmte Dinge zu tun oder bestimmte Ziele zu erreichen. Technik umgibt uns, sie ist im menschlichen Leben omnipräsent. Ein hölzerner Stock, der uns als Armverlängerung dient, gehört ebenso dazu wie die jüngste Computertechnologie. Sobald man mit Hilfe einer Gabel oder eines Tellers isst, sobald man Kleidung trägt, sobald man nachts sein Haupt weich bettet, greift man bereits auf technische Hilfsmittel zurück – häufig ohne das bewusst als Techniknutzung wahrzunehmen. Tatsächlich gibt es kaum Tätigkeiten, die ohne technische Hilfsmittel auskommen. Aufgrund der Allgegenwärtigkeit von Technik kann es helfen, den Begriff negativ zu definieren, um zu präzisieren, was man darunter versteht. Nach einer solchen Definition würden nur ausschließlich mentale oder biologische Aktivitäten keine Technik benötigen – und selbst hier, so gibt die Technikhistorikerin Martina Heßler zu bedenken, ist üblicherweise ein technischer Kontext vorhanden.[5]
Technik, so kann man in jedem Fall festhalten, ist für die menschliche Geschichte von größter Bedeutung. Ihre Betrachtung spielt demnach auch in der Geschichtswissenschaft allgemein eine wichtige Rolle – insbesondere, aber nicht nur im Feld der so genannten Technikgeschichte, die ihren Blick auf das Verhältnis von Technologie und Gesellschaft in einem historischen Kontext richtet. Darüber, was genau der Begriff Technik im Rahmen einer solchen Beschäftigung aber umfasst, wurde unter Fachleuten viel diskutiert. Ein enger Technikbegriff fokussiert auf technische Artefakte, auf Apparate und Maschinen, und stellt sie in den Mittelpunkt der Betrachtung. Hier ist man sehr nahe an einem umgangssprachlichen Verständnis von Technik, das hauptsächlich an deren materielle Manifestationen denkt. Am anderen Ende des Spektrums steht eine Definition von Technik, die sich am altgriechischen techné (τέχνη) als Fertigkeit bzw. Praxis orientiert und damit die Anwendbarkeit des Begriffs auf menschliche Handlungen erweitert (z. B. im Sinne von Lesetechniken, Sprungtechniken etc.). Letztlich stellt sich ein zwischen diesen beiden Polen liegendes Verständnis von Technik wohl als die analytisch produktivste Herangehensweise heraus. Hier wird das technische Artefakt „in den Kontext seiner Herstellung und seines Gebrauchs“[6] gestellt. Das heißt, all jene Handlungen, die sich auf ein technisches Artefakt beziehen, gehören ebenfalls zur Technik. In der aktuellen Technikgeschichtsforschung hat sich dieses Verständnis weitgehend durchgesetzt. Bei aller Berücksichtigung menschlichen Handelns bleibt aber auch dieser Ansatz letztlich auf das technische Artefakt konzentriert und betrachtet die darauf bezogenen Aktivitäten in der Forschungspraxis als darum gruppiert.
Die Technikgeschichte beschäftigt sich im Kern mit technologischem Wandel und dessen Wechselwirkung mit der Gesellschaft. Das heißt, sie fragt zum einen also danach, wie zu bestimmten Zeiten und unter bestimmten Bedingungen neue Technologien geplant, entwickelt und angewendet wurden, welche gesellschaftlichen Vorbedingungen dafür nötig waren. Sie will in dieser Hinsicht die Genese von Technologien verstehen und erklären. Zweitens geht die Technikgeschichte aber natürlich auch der gesellschaftlichen Bedeutung von Technologien nach und fragt nach den Auswirkungen neuer Entwicklungen. Das Verhältnis von Technik und Gesellschaft wird demnach in beide Richtungen untersucht. Das prinzipielle Verständnis dieses Verhältnisses hat sich dabei im Laufe der Zeit aber grundlegend gewandelt. Viele technikhistorische Arbeiten interessierten sich lange Zeit vornehmlich für die Geschichte einzelner Erfinder bzw. deren Erfindungen und blieben historiografisch an diesen haften. Ein solcher Ansatz vernachlässigt entweder das genannte Verhältnis zwischen Technik und Gesellschaft zugunsten einer ausgeprägten Konzentration auf biografische oder im engeren Sinne technische Details. Oder aber es liegt ein stark vereinfachtes, oft monokausales Verständnis dieses Verhältnisses vor. Typische Beispiele dafür wären etwa ein diffusionistisches Verbreitungsmodell von Technik oder ein explizit oder implizit formulierter Technikdeterminismus. Unter ersterem versteht man die Idee, dass sich bessere oder effizientere Technik mehr oder minder automatisch ausbreitet, Anwendung findet und in diesem Zusammenhang ältere Techniken überschreibt oder verdrängt. Diese Idee ist häufig Teil eines breiteren Technikdeterminismus, der davon ausgeht, dass technische Entwicklungen soziale und kulturelle Veränderungen verursachen und technischen Wandel so zu einer zentralen gesellschaftlichen Triebfeder macht.
Diese Art der Technikgeschichte ist im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts zunehmend in die Kritik geraten. Erstens haben Technikhistoriker wie etwa David Edgerton eine Rekalibrierung des Untersuchungsfokus weg von der Phase der Erfindung hin zur Anwendung von Technologien gefordert. Edgerton hat dafür den Begriff der technologies-in-use geprägt und argumentiert schlüssig, dass das Verhältnis zwischen Technik und Gesellschaft nur in der Phase breiter Anwendung untersuchbar wird.[7] Solche Anwendungsphasen könnten sich zeitlich und räumlich deutlich vom Kontext der Erfindung unterscheiden. Edgerton benennt dafür unter anderem auch Beispiele aus der Mobilitätsgeschichte wie etwa das Fahrrad und seine aktuelle, weltweite Nutzung.[8] Edgerton führt treffend ins Feld, dass die Vorstellung eines technologischen Determinismus, wenn überhaupt, dann nur für die Nutzungsphase einer Technologie konzeptuell überhaupt Sinn machen würde.[9] Aber auch die Grundidee, dass Gesellschaften ursächlich von technischen Entwicklungen geprägt werden, wird mittlerweile in der Technikgeschichte zugunsten eines sozialkonstruktivistischen Ansatzes zurückgewiesen. Da sich vor allem englischsprachige Historikerinnen und Historiker mit der Entwicklung dieses Zugangs beschäftigt haben, spricht man abgekürzt auch häufig von SCOT (Social Construction of Technology). Man geht davon aus, dass Technologien nicht strikt nach objektivem Bedarf und reinen Effizienzkriterien entwickelt werden und sich dann entsprechend durchsetzen, sondern dass es sich dabei um soziale Prozesse handelt. Das heißt, dass in der Technikentwicklung und -anwendung nicht nur technikinterne, sondern maßgebend soziale Kriterien zur Entfaltung kommen. So spiegeln sich in der Entwicklung des Automobils eben nicht nur technische Notwendigkeiten, sondern beispielsweise auch soziale Bedürfnisse. Man denke an das Auto als Statussymbol.[10] Die breite fachliche Anerkennung dieses sozialkonstruktivistischen Zugangs soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sowohl in der öffentlichen wie auch in der wissenschaftlichen Diskussion über Technik deterministische Interpretationen weiterhin zumindest implizit erkennbar sind.