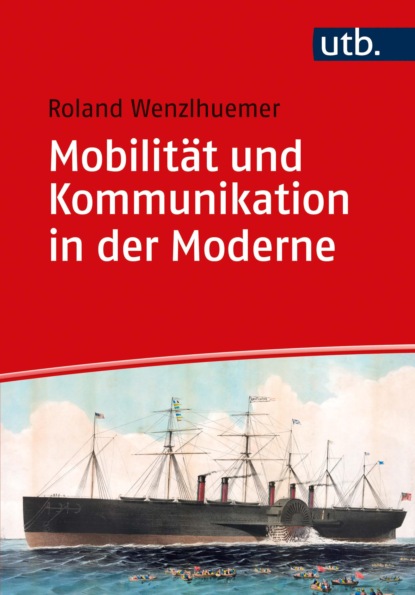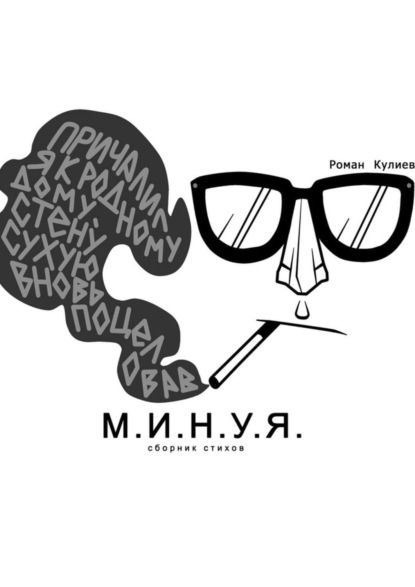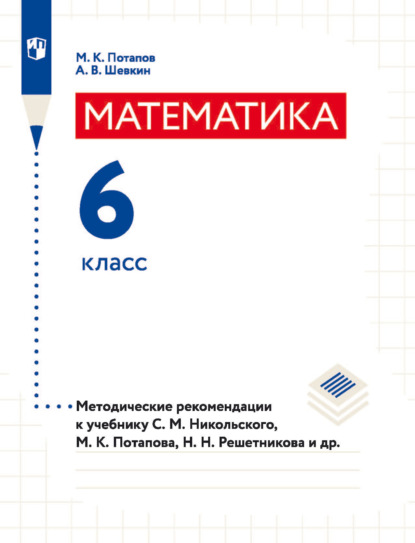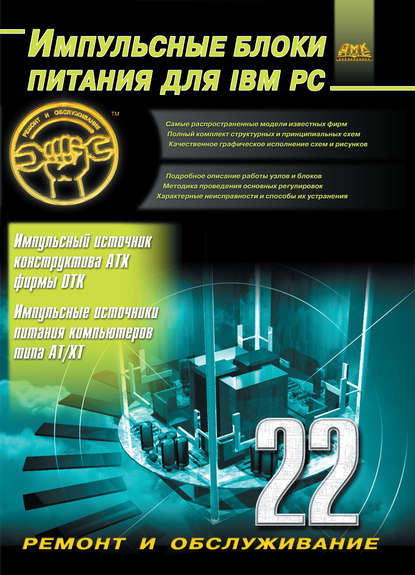- -
- 100%
- +
Weitgehend parallel zum Aufkommen eines sozialkonstruktivistischen Ansatzes hat sich auch ein leichter Wandel im Erkenntnisinteresse der Technikgeschichte eingestellt. Lange Zeit waren technikhistorische Arbeiten hinsichtlich der gesellschaftlichen Rolle von neuen Technologien hauptsächlich wirtschaftshistorisch orientiert. Ihre Fragen drehten sich also darum, wie wirtschaftliche Bedürfnisse technische Entwicklungen beeinflussten und vor allem wie sich neue Technologien wirtschaftlich niederschlugen. Mit der Etablierung kulturgeschichtlicher Ansätze in der Geschichtswissenschaft insgesamt setzte auch ein langsamer Wandel in der Technikgeschichte hin zu einer Kulturgeschichte der Technik [11] bzw. der Geschichte der technischen Kultur ein. Man fragte nun auch nach der kulturellen Bedeutung von Technologie, nach ihrer Symbolfunktion und kulturellen Codierung. Diese Idee einer kulturhistorisch anschlussfähigen Technikgeschichte hat sich im Feld mittlerweile weitgehend durchgesetzt.
Die Technikgeschichte hat sich schon immer auch mit Verkehr, Transport und Kommunikation beschäftigt. Schließlich handelt es sich dabei in der Regel um technisch vermittelte Prozesse (selbst Fußgänger nutzen in den allermeisten Fällen Schuhe oder angelegte Wege). Technische Artefakte spielen demnach eine zentrale Rolle im Bereich der Mobilität. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Fragen nach der Wechselwirkung zwischen Transport- bzw. Kommunikationstechnologien und ihren Trägergesellschaften in der Technikgeschichte seit langem fest etabliert sind und damit auch das Erkenntnisinteresse der Verkehrs- und Transportgeschichte entscheidend geprägt haben. Auch wenn die heutige Mobilitätsgeschichte über diesen technikhistorischen Ansatz inzwischen weit hinausgeht und beispielsweise Erfahrungen, Praktiken oder Möglichkeiten von Mobilität ebenso in den Blick nimmt, so bleibt die Frage nach der Rolle der Technologie selbst praktisch immer präsent. Die soziale und kulturelle Praxis von Mobilität bezieht sich eben auch entscheidend auf die vermittelnde Technik. Daher spielen immer dann, wenn sich Mobilität und Kommunikation technischer Hilfsmittel bedienen, technikhistorische Fragestellungen eine mal vordergründige und mal hintergründige Rolle. Ein grundlegendes Verständnis technikgeschichtlicher Erkenntnisinteressen ist im Feld der Mobilitätsgeschichte daher auch nach der kulturgeschichtlichen Neuorientierung unabdingbar.
Was sind nun typische Fragestellungen der Technikgeschichte an den Bereich der Mobilität und Kommunikation? Da ist einmal die Frage danach, wie sich die technischen Spezifika und Notwendigkeiten einer bestimmten Technologie gesellschaftlich niedergeschlagen haben. Nehmen wir als Beispiel den zunehmenden Einsatz der Dampfkraft im Transportwesen, der eingehender im folgenden Kapitel thematisiert wird. Zwar minderte die neue Kraftquelle die Abhängigkeit von menschlicher, tierischer oder anderweitig der Natur gewonnener Energie, gleichzeitig entstand aber eine neue Notwendigkeit der Brennstoffversorgung. Daher waren Dampfmaschinen im großen Stil zunächst nur in der Nähe von Brennstoffvorräten einsetzbar. In späterer Folge wirkte sich diese Abhängigkeit ganz massiv auf die Förderung und logistische Verteilung von fossilen Brennstoffen aus. Man denke beispielsweise an das Anlegen von Kohledepots entlang der wichtigsten Dampfschiffrouten. Solche Fragen nach den Auswirkungen technischer Abläufe in Mobilitätstechnologien interessieren die Technikgeschichte.
Sie will aber ebenso wissen, warum sich bestimmte Technologien in eine bestimmte Richtung entwickelt haben, warum sie sich durchsetzen konnten oder aber wieder verschwanden. Ein gutes Beispiel aus der Mobilitätsgeschichte findet sich diesbezüglich in der Arbeit des niederländischen Historikers Wiebe E. Bijker, der wesentlich an der Entwicklung eines sozialkonstruktivistischen Zugangs zur Technikgeschichte beteiligt war. Bijker hat sich unter anderem mit der Geschichte des Fahrrads beschäftigt und gefragt, warum sich das praktische und sichere Niederrad – also das Fahrrad, wie wir es auch heute kennen – über den Umweg des unpraktischen und unsicheren Hochrads entwickelt hat, wenn doch alle technischen Voraussetzungen für das Niederrad zuvor bereits gegeben gewesen seien. Er findet die Antwort auf seine Frage eben in der sozialen Konstruktion von Technologien, die Abwägungen der Praktikabilität und Sicherheit hier zugunsten soziokultureller Faktoren wie etwa der Unterstreichung von Mut, Männlichkeit und sozialem Status in den Hintergrund rücken lässt (siehe Kapitel III.6).[12]
Schon in diesen exemplarischen Fragestellungen aus technikhistorischer Perspektive wird deutlich, dass sich diese nicht trennscharf von anderen Erkenntnisinteressen unterscheiden lassen. Blickt man auf den Brennstoffbedarf der Dampfmaschine, so landet man ebenso schnell in der Wirtschaftsgeschichte wie in der Globalgeschichte. Fragt man nach dem Hochrad, so gibt es kein Vorbeikommen an der Kulturgeschichte. Wie bereits erwähnt, sind die genannten Zugänge daher nicht als jeweils separate Felder zu betrachten, sondern lediglich als unterschiedlich gelegte Gewichtungen.
Jürgen Osterhammel ist in seinem umfassenden Werk zur Verwandlung der Welt im langen 19. Jahrhundert auch auf die Rolle von Transport- und Kommunikationstechnologien eingegangen. Er hält im Abschnitt über die Dampfschifffahrt einleitend fest, dass „[i]n der Geschichte des Verkehrs […] oft kein Weg an einem milden technologischen Determinismus“ vorbeiführt. Neue Verkehrsmittel würden nicht auftreten, weil sie „kulturell ersehnt werden, sondern weil jemand auf die Idee kommt, sie zu bauen“.[13] Obwohl diese Auslegung des Begriffs nicht ganz dem technikhistorischen Verständnis von technologischem Determinismus entspricht, so ist Osterhammel im grundlegenden Befund wohl zuzustimmen. Angesichts der übergeordneten Vernetzungs- und Globalisierungsprozesse der Moderne, haben viele neue Transport- und Kommunikationstechnologien ihre Trägergesellschaften tatsächlich auf eine Art und Weise geprägt, die man im Sinne eines „sanften Determinismus“ interpretieren kann. Diese Idee geht auf Thomas P. Hughes zurück, der sich konzeptuell mit großen technischen Systemen auseinandergesetzt hat und schreibt: „Large systems with high momentum tend to exert a soft determinism on other systems, groups, and individuals in society.“[14] Da Mobilitäts- und Kommunikationstechnologien häufig in solchen großen, vernetzten Systemen organisiert sind, ist die Idee eines „sanften Technikdeterminismus“ in einer technikhistorischen Betrachtung von Mobilität und Kommunikation durchaus zu berücksichtigen.
[5] Heßler, S. 18.
[6] Ebd., S. 17.
[7] Edgerton, From Innovation to Use.
[8] Ebd., S. 116; ders., Shock of the Old, S. 45‒47.
[9] Ders., From Innovation to Use, S. 120f.
[10] Gleitsmann, Kunze u. Oetzel, S. 36.
[11] Heßler.
[12] Bijker, S. 19‒100.
[13] Osterhammel, Verwandlung, S. 1012.
[14] Hughes, S. 54f.
3. Wirtschaftsgeschichtliche Perspektiven
Welche Bedeutung hatte die Telegrafie für die Geschichte internationaler Finanzmärkte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts? Welche Rolle spielte der Ausbau von grenzübergreifenden Transportinfrastrukturen für den globalen Handel? In welchem Ausmaß werden Transport- und Kommunikationsmittel wie beispielsweise das Automobil oder das Mobiltelefon selbst zu wichtigen globalen Handelsgütern? Die Geschichte von Mobilität und Kommunikation ist kaum losgelöst von wirtschaftshistorischen Fragestellungen zu denken.
Menschen haben verschiedenste Bedürfnisse, manche grundlegender als andere, mit deren Befriedigung sie einen Gutteil ihres Lebens beschäftigt sind. Unter dem Begriff Wirtschaft versteht man die Gesamtheit aller Einrichtungen und Aktivitäten, die in einer Gemeinschaft auf die Herstellung und Verteilung von Ressourcen zur Bedürfnisbefriedigung (üblicherweise Waren oder Dienstleistungen) zielen. Diese Begriffsdefinition mag seltsam trocken und etwas artifiziell klingen. Sie hat aber den Vorteil, ganz unmittelbar klarzumachen, dass Wirtschaft nicht nur mit Fabriken und Hochfinanz, mit Banken und globalem Handel zu tun hat, sondern der Mensch als soziales Wesen immer wirtschaftet. Ähnlich wie dies auch im vorherigen Abschnitt zur Technik deutlich wurde, ist menschliches Denken und Handeln ohne ein Grundverständnis für die jeweiligen wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht zu verstehen. Die Wirtschaftsgeschichte ist dementsprechend ein wichtiger, seit langem fest etablierter Bereich der Geschichtswissenschaft (wie im Übrigen auch der Wirtschaftswissenschaft), dessen Ziel es ist, die Geschichte des menschlichen Wirtschaftens zu beleuchten. Sie will in diesem Zusammenhang Entwicklungslinien, Organisationsformen und Handlungslogiken verstehen und erklären und tut dies auf ganz unterschiedlichen Ebenen: zum Beispiel mit einem Fokus auf einzelne Menschen oder kleine Gruppen von Menschen, auf der Ebene von Haushalten bzw. Erwerbsgemeinschaften, auf Unternehmensebene oder auch mit Blick auf ganze Volkswirtschaften oder sogar globale Wirtschaftszusammenhänge.
In der Geschichtswissenschaft sind wirtschaftshistorische Fragestellungen seit etwa Ende des 19. Jahrhunderts wichtig geworden. Die entscheidenden Impulse kamen vor allem aus der Volkswirtschaftslehre. Insbesondere im Deutschen Bund beschäftigte sich seit Mitte des Jahrhunderts die Historische Schule der Nationalökonomie mit der Wirtschaftsgeschichte. Ihre Anhänger um Wilhelm G. Roscher (1817–1894) oder in späteren Jahren Gustav von Schmoller (1838–1917) waren davon überzeugt, dass zur Lösung aktueller wirtschaftlicher Probleme – wie zum Beispiel der so genannten „sozialen Frage“ – ein Studium der Geschichte der Wirtschaft wichtige Parameter liefern würde. Erklärtes Ziel war es, aus empirisch erhobenen historischen Daten induktiv ökonomische Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, denen man zwar nicht universelle Gültigkeit zusprach, aber an denen man sich in ähnlichen aktuellen Lagen zumindest orientieren konnte. Je mehr sich die Geschichtswissenschaft zur Jahrhundertwende und in den Folgejahrzehnten weg von einer reinen politischen Geschichte hin zu einer breiteren Gesellschaftsgeschichte entwickelte, desto gefragter wurde solche ökonomisch-historischen Ansätze auch im Fach selbst.[15] Im Deutschen Reich erfolgten in dieser Zeit die ersten Zeitschriftengründungen, die explizit die Wirtschaftsgeschichte im Namen trugen. Der wohl wesentlichste Impuls für den Ansatz kam aber nach dem Ersten Weltkrieg aus Frankreich. Marc Bloch (1886–1944) und Lucien Febvre (1878–1956) legten dort in den 1920er-Jahren die wissenschaftlichen Fundamente für die so genannte Schule der Annales . Diese wandte sich ganz explizit der Untersuchung sozialer und ökonomischer Fragestellungen in der Geschichte zu, erschloss dazu neues, quantitatives Quellenmaterial und entwickelte neue Methoden zu dessen Auswertung. Die Annales legten in diesem Zusammenhang besonderes Augenmerk auf langfristige Entwicklungen und die Herausbildung langlebiger Strukturen. Ihre Fragestellungen und Gewichtungen spielen in der Geschichtswissenschaft bis heute eine große Rolle.
In den 1950er- und 1960er-Jahren entstand zunächst in den Vereinigten Staaten von Amerika die so genannte New Economic History , die in der deutschsprachigen Wissenschaft vor allem als Kliometrie bekannt wurde. Zentrales Merkmal dieses neuen wirtschaftshistorischen Zugangs war es, ökonomische Theorien und Methoden auch auf historisches Material anzuwenden. Dazu musste das erhobene historische Datenmaterial besonders dicht sein. Bekannte Vertreter dieser Forschungsrichtung, die sich ab ca. den 1970er-Jahren auch im deutschsprachigen Raum etablierte, waren etwa die US-amerikanischen Ökonomen Robert W. Fogel (1926–2013) und Douglass C. North (1920–2015), die für ihre einschlägigen Arbeiten im Jahr 1993 gemeinsam mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurden. In den letzten drei Jahrzehnten hat die Wirtschaftsgeschichte zunehmend Impulse aus der so genannten Neuen Institutionenökonomik – einer volkswirtschaftlichen Theorie, die vor allem die Rolle institutioneller Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln betont und untersucht – und aus der Kulturgeschichte aufgenommen. Fragen der kulturellen Prägung wirtschaftlichen Handelns spielen nun zunehmend eine Rolle. Mit dieser Aufnahme kulturhistorischer Ansätze, die auch in der Neuen Institutionenökonomik mit angelegt ist, hat sich auch der traditionell starke Fokus der Wirtschaftsgeschichte auf die Entstehung moderner Wirtschaftssysteme geweitet. Während das Fach lange einen Schwerpunkt auf die Untersuchung der wirtschaftlichen Voraussetzungen und Konsequenzen beispielsweise der Industriellen Revolution gelegt hat, erfahren mittlerweile verschiedenste Formen des Wirtschaftens in den unterschiedlichsten Zeiten und Räumen analytische Aufmerksamkeit.
Wirtschaftsgeschichte wird oft in Kombination mit Sozialgeschichte genannt, zum Beispiel in der Benennung von Lehrstühlen oder Fachbereichen. Sozialgeschichte im ursprünglichen Sinn bezeichnet die historiografische Untersuchung ganzer Gesellschaften und ihrer Organisation oft mit einem speziellen Fokus auf die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und ihr Verhältnis zueinander. In den 1950er-Jahren entstand in Deutschland um die Historiker Otto Brunner (1898–1982) und Werner Conze (1910–1986) eine neue Ausprägung der Sozialgeschichte, der es hauptsächlich um die Analyse langlebiger Strukturen gesellschaftlicher Organisation ging, wie das in weniger expliziter Form auch in den Annales angelegt war. Die Analyse wirtschaftlicher Strukturen spielte dabei eine zentrale Rolle.
Über dieses Interesse an gesellschaftlichen Strukturen, das sowohl der Wirtschafts- wie auch der Sozialgeschichte zu eigen ist, wird bereits einer von mehreren direkten Bezügen zur Mobilitätsgeschichte deutlich. Mobilität und Kommunikation sind Aktivitäten, die – wenn sie in einem größeren Zusammenhang stattfinden – im Normalfall auf eine stützende Infrastruktur angewiesen sind, etwa auf ein Straßennetz, auf Telegrafenkabel oder Schienenwege, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese Infrastrukturen sind für die Strukturgeschichte von großem Interesse, da sie ganz eigene Funktions- und Entwicklungslogiken an den Tag legen.[16] Als üblicherweise große und teure Gebilde wohnt ihnen eine gewisse Trägheit und Persistenz inne, da die Amortisation der Investitionskosten häufig einen langfristigen Einsatz nötig macht und Dynamik behindert. Ein Beispiel dafür ist das in Frankreich mit ca. einem Jahrzehnt Verzögerung einsetzende Aufkommen der elektrischen Telegrafie. Frankreich verfügte als einziges europäisches Land über ein optisches Telegrafennetzwerk nennenswerter Größe, dessen hohe Baukosten einen Anreiz zur langfristigen Nutzung boten und den Einsatz neuere Kommunikationstechnologien verzögerten. Das Studium von Transport- und Kommunikationsnetzwerken ist daher für strukturgeschichtliche Ansätze wie die Wirtschafts- und Sozialgeschichte überaus ertragreich.
Aber auch über diese spezifischen strukturellen Interessen hinaus hat die Wirtschaftsgeschichte einen stark ausgeprägten Bezug zu Fragen der Mobilität und der Kommunikation. Volkswirtschaften können ohne den Transport von Waren, der Bewegung erwerbstätiger Menschen oder der Kommunikation von Preisen oder anderen ökonomisch relevanten Informationen nicht funktionieren und ohne deren Untersuchung nicht adäquat interpretiert werden. Das wurde schon in den Arbeiten vieler Vertreter der erwähnten Historischen Schule der Nationalökonomie deutlich. Einer ihrer frühen Adepten war der deutsche Ökonom Karl Knies (1821–1898), der sich in seinen Schriften bereits in den 1850er-Jahren mit der Eisenbahn und dem Telegrafen auseinandersetzte.[17] Auch Werner Sombart (1863–1941), der zumindest in einigen Punkten der jüngeren Historischen Schule nahestand, legte Anfang des 20. Jahrhunderts in seinem dreibändigen Werk über den Kapitalismus großen Wert auf die wirtschaftliche Bedeutung neuer Transport- und Kommunikationstechnologien.[18]
Dieses grundlegende Interesse an der Bewegung von Waren, Menschen und Information blieb der Wirtschaftsgeschichte bis in die Gegenwart erhalten. Es gibt dabei eine Vielzahl untersuchter Fragestellungen. So fragen viele Studien ob „Transportinnovationen Antriebskräfte der Industrialisierung [sind] oder deren Folge“.[19] Welche ökonomischen Auswirkungen entfaltete der Einsatz neuer Transport- und Kommunikationstechnologien? Eine konkrete Problemstellung kann in dieser Hinsicht sein, wie sich sinkende Transportkosten auf Prozesse der Arbeitsteilung in der Warenherstellung niedergeschlagen haben. Umgekehrt wird aber zum Beispiel auch danach gefragt, welche sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen besonders innovationsfreundlich sind, oder danach, welche Rollen private und staatliche Akteure in der Unterhaltung von Verkehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen als öffentliches Gut gespielt haben. Diese Liste produktiver Fragestellungen und Zugänge lässt sich beliebig erweitern.
Ein wichtiges Werk zur Mobilitätsgeschichte stammt aus der Feder des britischen Historikers Philip Bagwell. Schon der Titel seines erstmals 1974 erschienenen Buches „The Transport Revolution from 1770“ verrät, dass Bagwell in den verkehrs- und kommunikationstechnischen Entwicklungen seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert große soziale und wirtschaftliche Umwälzungen angelegt gesehen hat. Seine umfassende Studie konzentriert sich auf die Entwicklungen in Großbritannien und betont neben den üblichen Untersuchungsgegenständen des Straßen- und Kanalbaus, der Eisenbahn und des motorisierten Straßenverkehrs vor allem auch die Rolle der Küstenschifffahrt. Bagwell betrachtete die einzelnen Verkehrsmittel in ihrem Zusammenspiel und fragte vor allem nach ihren Auswirkungen auf das wirtschaftliche Wachstum Großbritanniens. Interessanterweise wandte er sich in Einleitung und Schluss seines Buches an die Verkehrsplaner seiner Zeit. Bagwell ermahnte diese, dass Fortschritte im Transportwesen nur dann der Öffentlichkeit zugutekämen (zum Beispiel in der Form wirtschaftlichen Wachstums), wenn in der Verkehrsplanung ein praktischer Erfindergeist mit staatsmännischer Klugheit zusammengeführt werde.[20]
Ebenfalls in einem nationalen Rahmen führte der bereits erwähnte Robert Fogel seine zehn Jahre ältere Studie zur wirtschaftlichen Bedeutung des amerikanischen Eisenbahnsystems durch. Während Bagwell einen integrierten Blick auf das britische Transportsystem und dessen wirtschaftliche Bedeutung warf, kehrte Fogel in seiner vieldiskutierten Untersuchung „Railroads and American Economic Growth“ die Blickrichtung um. Bisher hatte kaum ein Wirtschaftshistoriker Zweifel an der grundlegenden ökonomischen Bedeutung der Eisenbahnen in den Vereinigten Staaten des späten 19. Jahrhunderts geäußert. Fogel stellte in zwei von vier Abschnitten seines Buches nun eine kontrafaktische Überlegung an: Wie hätte sich die Wirtschaft entwickelt, hätte es keine Eisenbahn gegeben? Er kam in seiner kliometrischen Untersuchung unter Anwendung wirtschaftswissenschaftlicher Theorien zu dem Schluss, dass die Eisenbahn natürlich sehr wichtig für die amerikanische Wirtschaft war, aber nicht unersetzlich. Seinen Berechnungen zufolge hätten andere Verkehrsformen wie zum Beispiel der Kanaltransport die Lücke gefüllt und zu einem etwas verzögerten, aber vergleichbaren Wachstum geführt.[21] Fogels Studie erfuhr aufgrund ihrer neuen Methoden, dichten Datenbasis und radikalen Ergebnisse große Beachtung. Sie wurde aber auch mit dem Argument substantiell kritisiert, dass Fogel sein kontrafaktisches Gedankenexperiment auf falschen Grundannahmen aufgebaut hätte oder seine ökonometrischen Überlegungen der energetischen Leistungsfähigkeit der alternativen Transporttechnologien nicht gerecht würden.[22] In jedem Fall kann sie als anschauliches Beispiel für einsichtsreiche wirtschaftshistorische Fragestellungen im Bereich der Mobilität und Kommunikation dienen.
Schließlich lohnt der Blick in eine etwas jüngere Studie der Kanadier Dwayne Winseck und Robert Pike. Der Kommunikationswissenschaftler Winseck und der Soziologe Pike untersuchen darin die Entstehung und Bedeutung eines – in ihren Worten – „global media system“ seit den 1860er-Jahren. Mit diesem globalen Mediensystem ist das Zusammenspiel einer weltweiten telegrafischen Kommunikationsinfrastruktur mit neuen Mechanismen der Informationsbeschaffung und -verteilung, zum Beispiel durch Nachrichtenagenturen, gemeint. Die Autoren können dabei zeigen, dass Aufbau und Funktion dieses Systems weit weniger stark von den Interessen der Imperialmächte geprägt wurden als bisher angenommen. Vielmehr spielten die unternehmerischen Überlegungen großer Kommunikationskartelle eine wesentliche Rolle. In einem größeren Zusammenhang untersuchen Winseck und Pike in ihrer Studie zum einen, wie die weltweite Ausbreitung kapitalistischen Wirtschaftens sich auf die Entstehung dieses Mediensystems auswirkte und welche Bedeutung umgekehrt globale Informationsflüsse auf den Finanz- und Handelssektor hatten. Quantitatives Material spielt in dieser Studie insgesamt eine untergeordnete Rolle.[23]
Wirtschaftshistorische Erkenntnisinteressen spielen in vielen Betrachtungen der Geschichte der Mobilität nach wie vor eine wichtige Rolle – ob vorder- oder hintergründig. Angesichts der grundlegenden Bedeutung der Bewegung von Waren, Menschen und Informationen für die wirtschaftliche Entwicklung ist dies dem Gegenstand nur angemessen und sollte auch in Zeiten einer anhaltenden kulturwissenschaftlichen Konjunktur immer mitgedacht werden.
[15] Buchheim, S. 8.
[16] Van Laak.
[17] Knies, Eisenbahnen; ders., Telegraph.
[18] Sombart.
[19] Winiwarter u. Knoll, S. 230.
[20] Bagwell, S. 12.
[21] Fogel.
[22] Winiwarter u. Knoll, S. 231f.
[23] Winseck u. Pike.
4. Kulturgeschichtliche Perspektiven
Das Automobil bewegt nicht nur im räumlichen, sondern auch im emotionalen Sinn. Es ist Fortbewegungsmittel ebenso wie kulturelles Symbol, dessen Bedeutung zentral vom jeweiligen Interpretationskontext abhängt. Verspricht es den einen Status und Freiheit, so steht es für andere für Bequemlichkeit und Umweltzerstörung. Nicht weniger gegensätzlich ist der zeitgenössische Diskurs über das Mobiltelefon, das für manche eine vernetzungstechnische Verheißung, für andere eine schlichte Zumutung darstellt. Die Geschichte von Mobilität und Kommunikation ist geprägt von solchen Bedeutungszuweisungen und -veränderungen. Ihnen spürt die Kulturgeschichte nach.
Was Kulturgeschichte ist und wonach sie fragt, hängt zuallererst vom zugrunde liegenden Begriffsverständnis ab. In der Umgangssprache schwang im Begriff der Kultur lange Zeit fast automatisch die so genannte Hochkultur mit. Mit der Verwendung des Wortes verwies man zumeist auf künstlerische Erzeugnisse oder Aktivitäten, denen eine Gesellschaft hohe Qualität und damit große Bedeutung attestierte und die damit den Status eines Kulturgutes innehatten. Dieses enge Begriffsverständnis ist auch in der Umgangssprache mittlerweile weitgehend einem breiteren Gebrauch gewichen. Wie der britische Historiker Peter Burke festhält, sprechen wir heute in ganz alltäglichen Zusammenhängen von Kultur, etwa von „Jugendkultur“, einer „Kultur der Angst“ oder einer „Unternehmenskultur“, um nur einige seiner Beispiele zu nennen.[24] Der wissenschaftliche Gebrauch des Kulturbegriffs hat sich in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ebenfalls grundlegend erweitert. Allerdings geht hier im Zuge der so genannten „kulturellen Wende“ (cultural turn ) die Begriffserweiterung nicht in die Breite und versucht, mehr Gegenstände zu fassen. Vielmehr geht es hier um eine neue Beobachtungsweise, die sich prinzipiell auf jeden Gegenstand anwenden lässt.[25]
Die etymologischen Wurzeln des Wortes Kultur liegen im lateinischen colere bzw. im abgeleiteten Substantiv cultura. Ursprünglich bezeichnete das Verb colere das Bestellen und Bewirtschaften von Land. Diese Wortbedeutung lebt bis heute in der Rede von der Agrikultur fort. Der Begriff wurde aber bald erweitert und auch für pflegende Tätigkeiten außerhalb der Landwirtschaft verwendet. Der Historiker Achim Landwehr nennt als Beispiele die Pflege der Wissenschaften und der Künste oder die Verehrung von Gottheiten. So entwickelte sich laut Landwehr ein engerer Kulturbegriff, der bestimmte Lebensbereiche wie etwa die Kunst, die Wissenschaft oder auch die Religion von anderen Bereichen wie der Politik, der Wirtschaft oder dem Recht abtrennte und als Kultur definierte.[26] Mit einem solchen natürlich immer wieder leicht veränderten und erweiterten Kulturbegriff hat sich auch die Geschichtswissenschaft schon früh auseinandergesetzt. Burke sieht die Anfänge einer solchen Kulturgeschichtsschreibung um 1800 und spricht zunächst von einer klassischen Phase der Kulturgeschichte, die bis weit ins 20. Jahrhundert gereicht habe und von Historikern wie Jacob Burckhardt (1818–1897) oder Johan Huizinga (1872–1945) geprägt gewesen sei. Das Ziel etwa der Arbeiten von Burckhardt oder Huizinga sei es gewesen, umfassende „Porträts einer Zeit“ zu erschaffen. Eine solche Kulturgeschichte habe verschiedenste künstlerische Ausdrucksformen in Verbindung gebracht und so den spezifischen Geist einer Epoche spürbar machen wollen. Burke sieht eine zweite Phase kulturgeschichtlichen Arbeitens in einer „Sozialgeschichte der Kunst“, die für ihn um 1930 beginnt. Hier sei es vor allem um das Verhältnis von Kultur und Gesellschaft gegangen, also beispielsweise um die Frage, ob sich gesellschaftliche Entwicklungen in kulturellen Erzeugnissen spiegeln. In einer dritten Phase habe nach Burke eine Wendung hin zur populären Kultur stattgefunden. Die Kulturgeschichte habe nun vermehrt der Bedeutung der so genannten Volkskultur in historischen Entwicklungen nachgespürt. Burke nennt die britischen Historiker Eric Hobsbawm (1917–2012), der unter einem Pseudonym im Jahr 1959 eine Studie zur Jazzmusik und ihrer soziopolitischen Bedeutung vorlegte,[27] und Edward P. Thompson (1924–1993) mit seinem berühmten Buch zur Entstehung der englischen Arbeiterklasse[28] als wichtige Vertreter.[29] Während der Kulturbegriff in diesen drei groben Phasen immer wieder unterschiedlich interpretiert und erweitert wurde, blieb er aber immer auf bestimmte Lebensbereiche gerichtet.