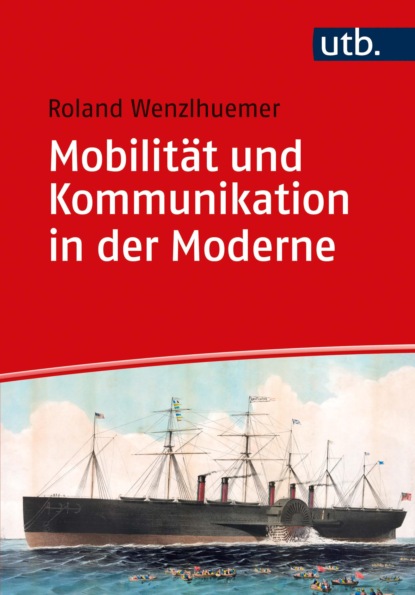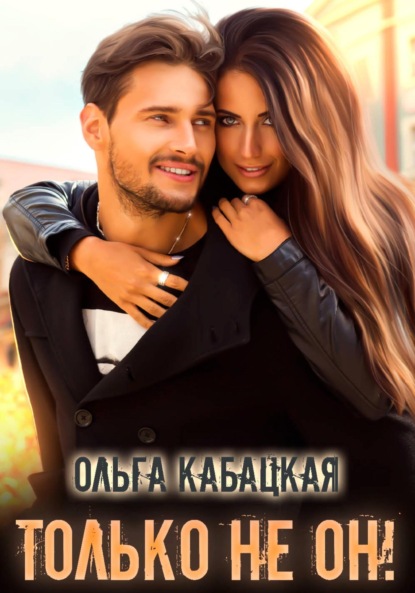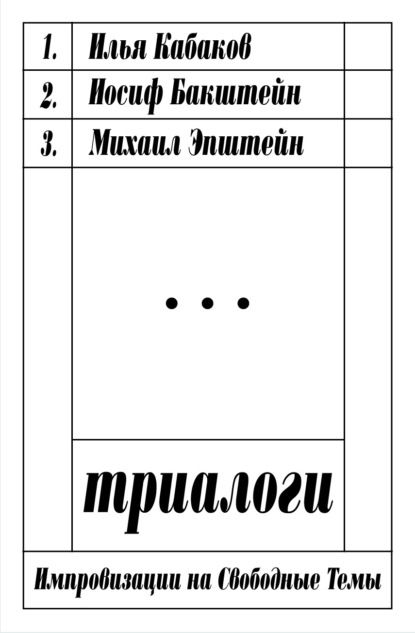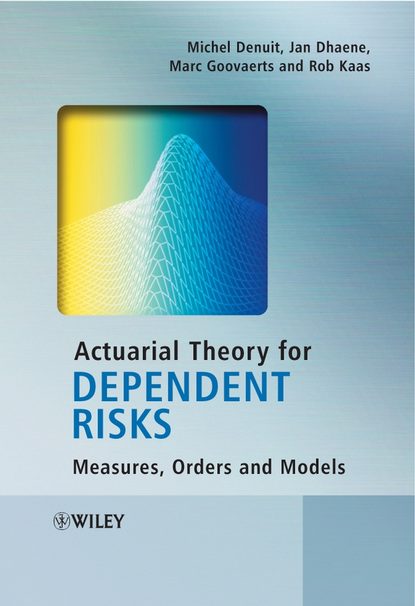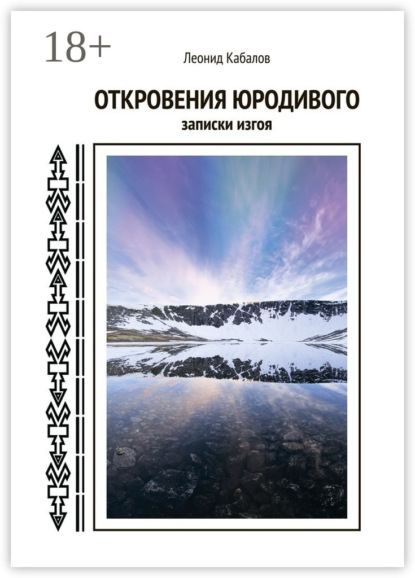- -
- 100%
- +
Eine vierte Phase stellt für Peter Burke die so genannte Neue Kulturgeschichte dar, die hinsichtlich ihrer bevorzugten Gegenstände mitunter auf die genannten Vorarbeiten aufsetzt, deren Kern aber eigentlich in einer neuen Sichtweise auf ihren Forschungsgegenstand besteht. Diese Form der Kulturgeschichte, die viele heutige Forschungsansätze informiert, hat ihre wesentlichen Impulse aus der so genannten „linguistischen“ (linguistic turn ) und der darauffolgenden „kulturellen Wende“ (cultural turn ), die im Prinzip eine Erweiterung ersterer darstellt, erhalten. Seit dem frühen 20. Jahrhundert haben sich Wissenschaftler in den verschiedensten Fachgebieten mit der Frage beschäftigt, wie Sprache unser Bild von der Welt bestimmt und letztlich den Menschen definiert. Solche vom Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889–1951), dem Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure (1857–1913) und vielen anderen formulierten Gedanken verfestigten sich schließlich zur größeren These, dass eine Realität außerhalb der Sprache schlicht nicht vorstellbar und damit auch nicht zu erforschen ist. Im Zuge des cultural turn wurde diese These von der Sprache auf jede Art von Bedeutungszuschreibung ausgeweitet. Eine von solchen kulturellen Zuschreibungen losgelöste Realität, falls es sie überhaupt gäbe, wäre aus dieser Sicht weder für den Menschen im alltäglichen Leben noch für die Wissenschaft erschließbar. Sinnstiftung und damit auch Lebensrealitäten entstünden durch Bedeutungszuschreibung. Damit wandelte sich auch die Reichweite des Kulturbegriffs. So wie sich Ethnologie und Anthropologie zu Leitwissenschaften entwickelten, so wurde eine Definition des amerikanischen Ethnologen Clifford Geertz (1926–2006) für das neue Verständnis von Kultur prägend. Nach einem berühmt gewordenen Satz von Geertz sei Kultur ein Bedeutungsgewebe, das der Mensch selbst gesponnen habe.[30]
Aus diesen Einsichten, die heute in den Geisteswissenschaften zumindest in ihren Kernannahmen weitgehend konsensfähig sind, ergeben sich für die Kulturgeschichte weitreichende Konsequenzen. Achim Landwehr sieht nach der Erweiterung des landwirtschaftlichen Referenzrahmens auf andere Lebensbereiche eine „abermalige Übertragungsleistung“ und eine Weitung des Kulturbegriffs, der nun nicht mehr einen bestimmten Lebensbereich, sondern „das Ganze menschlichen Lebens“ umfasst. In Landwehrs Worten eröffnet Kultur „damit keine Sektoral-, sondern eine Totalperspektive, es ist kein Teil-, sondern ein Integrationsbegriff.“[31] Will die Geschichte menschliches Handeln in der Welt erklären und verstehen, so muss sie aus kulturgeschichtlicher Warte das vom Menschen selbst gesponnene Bedeutungsgewebe betrachten oder – in einer gemäßigteren Variante – zumindest mitbetrachten. Kultur ist aus dieser Sicht eben kein von Politik und Gesellschaft trennbarer Teilbereich menschlichen Tuns, sondern die Grundlage jeder Weltbeschreibung. Demnach ist die Kulturgeschichte auch keine Teildisziplin der Geschichtswissenschaft, sondern hat den Anspruch, die Historiografie insgesamt auf eine andere Grundlage zu stellen.[32]
Ute Daniel verzichtet in ihrem eloquenten „Kompendium Kulturgeschichte“ konsequent auf eine Definition von Kultur und Kulturgeschichte. Sie schreibt: „Kultur(geschichte) definieren zu wollen, ist Ausdruck des Anspruchs, trennen zu können zwischen dem, was Gegenstand von Kultur(geschichte) ist und was nicht. Ich kann mir jedoch keinen Gegenstand vorstellen, der nicht kulturgeschichtlich analysierbar wäre.“[33] Das schließt auch den Gegenstand der Mobilität (unter expliziter Einbeziehung der Kommunikation) ein, mit dem sich die Kulturgeschichte lange und intensiv beschäftigt hat. Dieses Interesse an der Bewegung von Menschen, Waren und Informationen ist auch deshalb nicht überraschend, da die Kulturgeschichte zumindest auf zwei unterschiedlichen Ebenen enge Bezüge zum Thema unterhält. Da ist einmal ihr oben skizziertes Interesse an der Bedeutung, die Menschen verschiedenen Elementen der Wirklichkeit, zu der auch die Mobilität und ihre Mittel gehören, geben. Aus dieser Sicht geht es in einer kulturhistorischen Betrachtung von Verkehr und Kommunikation zum Beispiel um die Wahrnehmung und Darstellung des Unterwegs-Seins oder von Transporttechnologien in einer Gesellschaft. Wie wurden mobile Menschen gesehen? Welche Attribute schrieb man ihnen zu? Wie wurden Technologien wie die Eisenbahn oder das Dampfschiff zu Symbolen von Fortschritt oder Völkerverständigung? Diese etwas vereinfachten Fragestellungen verweisen auf oft verfolgte kulturhistorische Erkenntnisinteressen im Bereich der Mobilität.
Darüber hinaus gibt es noch eine andere Ebene, auf der Mobilität aus kulturhistorischer Sicht hochrelevant ist. Gemeint ist die Frage, wie die Bewegung von Menschen, Waren und Informationen sich selbst auf Prozesse der Bedeutungszuschreibung und Sinnstiftung, die grundlegend auf Austausch und Kommunikation basieren, auswirkt. Wie also verändert die Tatsache, dass Menschen reisen, Waren ausgetauscht und Informationen übermittelt werden, die Bedeutungen, die bestimmte Erscheinungen in bestimmten Kulturen haben? Auch auf dieser Ebene kann man zumindest zwei unterschiedliche Fragenkomplexe erkennen. Einer dreht sich um Bedeutungsveränderungen, die im Wesentlichen aus Kulturkontakt resultieren, der wiederum durch Mobilität entsteht. Eine solche transkulturelle Perspektive will demnach wissen, wie sich unterschiedliche Bedeutungsgewebe im Kontakt miteinander verändern und neue Bedeutungen hervorbringen. Hier ist in vielerlei Hinsicht eine große Nähe zu globalgeschichtlichen Erkenntnisinteressen, die im nächsten Abschnitt vorgestellt werden, gegeben. Ein zweiter Fragenkomplex interessiert sich aus einer medienwissenschaftlichen Perspektive dafür, wie die Bewegung bzw. die Kommunikation über bestimmte Mittel sich auf die Erzeugung von Bedeutung auswirkt, also wie bestimmte Eigenschaften eines Mediums sich kulturell niederschlagen. Ein Beispiel kann die Kommunikation per Telegraf sein, die aufgrund technosozialer Bedingungen kurze, prägnante Inhalte privilegierte und sich so natürlich auf die Wahrnehmungen der Korrespondenten auswirkte.
Die Kulturgeschichte blickt also mit vielen ganz unterschiedlichen Erkenntnisinteressen auf Mobilität und Kommunikation. Ein exzellentes Beispiel für den frischen Blick der Kulturgeschichte auf das Transportwesen findet sich in Wolfgang Schivelbuschs Studie zur „Geschichte der Eisenbahnreise“, die erstmal 1977 veröffentlich wurde. Es ist kein Zufall, dass Schivelbusch im Titel seines schnell berühmt gewordenen Buches nicht von der Eisenbahn, sondern von der Reise mit selbiger spricht. Er spürt in seiner Untersuchung der neuen Reiseerfahrung nach, den durch diese Art der Fortbewegung veränderten Wahrnehmungen von Raum und Zeit. Schivelbusch zeigt in eindrucksvollen Formulierungen, wie sich der Blick des Reisenden aus der Bahn heraus auf die Landschaft wandelte. Er nennt dies mit dem der Kulturgeschichte eigenen Hang zum Prägen neuer Begriffe „panoramatisches Reisen“. Er untersucht aber auch wie die Eisenbahn zum Symbol und Inbegriff schnellen, bequemen und sicheren Reisens wurde – und wie diese Bedeutungszuschreibung durch Unfälle und Katastrophen kontrastiert wurde. Die mittlerweile mehr als vierzig Jahre alte Studie ist hervorragend gealtert und zieht mit ihren grundlegenden Fragen und ihrer fesselnden Prosa bis heute Leser in ihren Bann.[34]
Die Eisenbahn als Transportmittel spielt auch in Hartmut Rosas „Beschleunigung“ eine indirekte Rolle – als Symbol, als Verkörperung der „großen Beschleunigung“[35] in der Moderne. Der Soziologe Rosa hat mit seiner 2005 erschienenen Habilitationsschrift eine auch geschichtswissenschaftlich hochrelevante Arbeit vorgelegt, die – wie der Untertitel besagt – den Veränderungen der Zeitstrukturen in der Moderne nachspürt. Die neuen technischen Bedingungen von Transport und Kommunikation sowie die sich verändernden Mobilitätspraktiken bilden in ihrem Zusammenspiel die Grundlage für das von Rosa untersuchte Phänomen der sozialen Beschleunigung. Weder die Kulturgeschichte noch die Mobilität stehen begrifflich im Vordergrund und doch durchziehen sie wie ein roter Faden das eigentlich soziologische Gewebe dieser lesenswerten Studie.[36]
Bernhard Rieger und Dagmar Bellmann beschäftigen sich in ihren jeweiligen Arbeiten wiederum mit dem Dampfschiff als zentralem Symbol der Moderne und den verschiedenen Funktionen und Erwartungen, die mit ihm verbunden waren. Rieger thematisiert in „Technology and Culture of Modernity in Britain and Germany 1890–1945“ mehrere symbolträchtige Verkehrs- und Kommunikationstechnologien, darunter eben auch die „schwimmenden Paläste“. Er fragt dabei vor allem danach, wie immer größere und prächtiger ausgestattete Dampfer zu „modernen Wundern“, zu Symbolen des Fortschritts, aber auch nationalen Stolzes wurden.[37] Bellmann nimmt den Topos der schwimmenden Paläste im Titel ihres Buches auf, fügt aber noch den Gegenbegriff des Höllengefährts hinzu. Sie konstatiert am Beispiel der Atlantiküberquerungen in ihrem Beobachtungszeitraum einen Wandel in der Wahrnehmung der Dampfschifffahrt von etwas Unbequemen und Gefährlichem zu etwas Luxuriösem, Sicherem.[38]
Schon anhand dieser wenigen Beispiele wird deutlich, welche wertvollen neuen Sichtweisen und Blickwinkel die jüngere Kulturgeschichte einer traditionell eher technik- und wirtschaftshistorisch inspirierten Beschäftigung mit Mobilität eröffnet haben. Die Globalgeschichte wiederum baut auf vielen kulturgeschichtlichen Erkenntnissen, zum Beispiel im Bereich der transkulturellen Geschichte[39], auf und stellt entsprechend abgewandelte Fragen an den Gegenstand.
[24] Burke, Kulturgeschichte, S. 9.
[25] Landwehr, S. 11.
[26] Ebd., S. 8.
[27] Newton.
[28] Thompson.
[29] Burke, Kulturgeschichte, S. 15‒32.
[30] Geertz, S. 9
[31] Landwehr, S. 8.
[32] Daniel, Kulturgeschichte, S. 13.
[33] Ebd., S. 8f.
[34] Schivelbusch.
[35] Bayly, S. 451‒487.
[36] Rosa.
[37] Rieger.
[38] Bellmann.
[39] Herren-Oesch, Rüesch u. Sibille.
5. Globalgeschichtliche Perspektiven
Die Geschichtswissenschaft beschäftigt sich zentral mit dem Menschen als sozialem Wesen, das sich in den verschiedensten Formen von Gemeinschaften organisiert. Solche sozialen Gebilde gehen aus den Verbindungen bzw. aus den Austauschprozessen hervor, die Menschen untereinander unterhalten. Diese Verbindungen zwischen Individuen und Gruppen sowie ihre Entwicklung durch die Zeit sind Grundbeobachtungselemente einer Geschichtswissenschaft, die das Denken und Handeln historischer Akteure erklären und verstehen will. Allerdings ist dieses Interesse an sozialen Verbindungen für jede Wissenschaft vom Menschen so grundlegend, dass es kaum einmal explizit gemacht wird. Die Verbindungen, die Menschen bewusst und unbewusst zueinander unterhalten, können ganz unterschiedlicher Natur sein – emotional oder pragmatisch, freiwillig oder erzwungen, bereichernd oder belastend. Und sie können unterschiedlichste Distanzen überbrücken. Angeregt auch durch die Globalisierungserfahrungen, die viele Menschen seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert in ganz intensiver Form machen, interessieren sich die Geistes- und Sozialwissenschaften mittlerweile zunehmend für Verbindungen, die sich über weite Entfernungen erstrecken und dabei räumliche, nationale oder kulturelle Grenzen überwinden. In der Geschichtswissenschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten der Forschungsbereich der Globalgeschichte entwickelt, der sich spezifisch mit solchen globalen oder transregionalen Verbindungen und ihrer Rolle in der Geschichte auseinandersetzt.
Christopher Baylys grundlegendes Werk über die Geburt der modernen Welt trägt im englischen Original den Untertitel „Global connections and comparisons“.[40] Daran direkt oder indirekt anschließend ist in der Folge häufig der historiografischer Zugang der Globalgeschichte beschrieben worden, in dessen „Mittelpunkt […] grenzüberschreitende Prozesse, Austauschbeziehungen, aber auch Vergleiche im Rahmen globaler Zusammenhänge“[41] stehen würden, wie Sebastian Conrad es in seiner deutschsprachigen Einführung in die Globalgeschichte zusammenfasst. Patrick O’Brien hat dieselbe Definition in seinem Prolegomenon zur ersten Ausgabe des Journal of Global History im Jahr 2006 unternommen.[42] Versteht man den Vergleich als wissenschaftliche Methode und damit als ein Untersuchungsinstrument, so bleiben globale Verbindungen als grundlegende Untersuchungseinheiten der Globalgeschichte übrig. Sie sind die Bausteine für jede Form von transregionalem Kontakt, Austausch und Vernetzung. Ein zentrales Interesse der globalhistorischen Forschung gilt dabei Fragen nach der Entstehung solcher Verbindungen und nach ihrer Bedeutung für die historischen Akteure. Sie werden als geschichtsmächtig identifiziert und hinsichtlich ihrer Bedeutung innerhalb der wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Entwicklungszusammenhänge einer bestimmten Region oder Zeit untersucht. Im Zentrum eines solchen Zugangs steht die Überzeugung, dass wir das Denken und Handeln historischer Akteure – und damit die Geschichte selbst – nicht verstehen und erklären können, wenn wir nicht auch die überregionalen Verbindungen, ihre lokalen Manifestationen und deren Zusammenspiel untersuchen.
Transregionale Verbindungen sind somit die Grundbeobachtungselemente der Globalgeschichte. Dass die Mobilität von Menschen, Waren und Informationen in diesem Zusammenhang ganz entscheidend ist, bedarf kaum einer weiteren Erklärung. Transport- und Kommunikationsmittel sind die Träger globaler Verbindungen. Sie etablieren und unterhalten globale Konnektivität. Das Studium von Transport- und Kommunikationstechnologien, ihrer Entwicklung und ihrer Nutzung spielt daher für die Globalgeschichte eine grundlegende, kaum zu hintergehende Rolle. Das Interesse der Globalgeschichte beschränkt sich dabei nicht auf Mobilitätspraktiken von potentiell weltumspannendem Charakter wie zum Beispiel der Dampfschifffahrt oder der Telegrafie. Sie blickt genauso auf Verkehrs- und Kommunikationsmittel, die in regionalen oder nationalen Kontexten zur Anwendung kamen, insgesamt aber in größere Mobilitätszusammenhänge und globale logistische Ketten eingebettet waren. Die Eisenbahngeschichte hält diesbezüglich besonders viele anschauliche Beispiele bereit, wie etwa in Kapitel III.1 zu sehen sein wird.
Die globalhistorische Beschäftigung mit Mobilität und ihren Trägermedien ist dabei von einem Verständnis globaler Verbindungen geprägt, das zunehmend analytischer und differenzierter wird. Lange wurden auch in der Globalgeschichte Verbindungen hauptsächlich von ihren Enden her gedacht. Untersuchungen fokussierten auf die Menschen, Orte oder Dinge, die in Verbindung miteinander standen oder in Verbindung gebracht wurden. Dort suchte man nach den Effekten von Kontakt und Austausch und studierte selbige als Faktoren menschlichen Denken und Handelns. Der Schwerpunkt solcher Arbeiten lag hauptsächlich auf dem Verbundenen, nicht auf der Verbindung selbst. Verbindungen wurden oft als quasi neutrale Zwischenglieder gesehen. Zudem war die globalgeschichtliche Forschung lange vor allem auf den Nachweis einer Verbindung zwischen Gegenständen konzentriert, die man bisher als nicht verbunden wahrgenommen hatte. Das hieß in der Praxis häufig, dass globale Verbindungen binär gedacht wurden, als existent oder nicht existent. Mittlerweile hat sich der Blick der Globalgeschichte auf ihre hauptsächlichen Untersuchungseinheiten aber verfeinert. Aktuelle Studien nehmen globale Verbindungen als eigenständige historische Phänomene ernst, die einen eigenen Raum und eine eigene Zeit aufweisen. Sie sind bemüht, Verbindungen als Mediatoren zu betrachten, die selbst einen prägenden Einfluss auf die jeweiligen Austauschprozesse und damit auf das Verbundene haben. Außerdem hat die globalhistorische Forschung erkannt, dass ein binäres Verständnis von Verbindungen der Komplexität historischer Sachverhalte nicht gerecht werden kann. Verbindungen treten immer im Plural auf und verhalten sich zueinander. Beziehungen zwischen einzelnen Akteuren und deren Gemeinschaften basieren immer auf einem ganzen Bündel verschiedener Verbindungsformen.
Die Globalgeschichte fragt daher nicht bloß, welche Transport- und Kommunikationssysteme globale Vernetzung ermöglichen, sondern sie interessiert sich für die verschiedenen Formen von Mobilität, die sich daraus ergeben. Die Art und Weise, wie Verbindungen als Mediatoren wirken, speist sich zu einem großen Teil aus den Mobilitätsformen, die diese Verbindungen stützen. Dampfschiffpassagen können hier als Beispiel dienen. Im späten 19. Jahrhundert dauerte eine Atlantiküberfahrt auf einem Dampfer zwischen sieben und zehn Tage. Zwischen Europa und Asien war man mehrere Wochen unterwegs, nach Australien gerne zwei Monate und mehr. Während dieser Zeit lebten Passagier und Crew auf dem engen Raum des Schiffes zusammen und waren in ein besonderes soziales Gewebe eingebunden. Die Schiffspassage war für viele ein entsprechend prägendes, einschneidendes Erlebnis, das ihre Sicht auf Abfahrts- und Ankunftsort veränderte. Der Schiffsverbindung fiel damit die Qualität eines Mediators zu. In abgeänderter Form lässt sich das für jede mediatisierte Verbindung festhalten. Ähnlich ist es hinsichtlich der Pluralität von Verbindungen, die sich ebenfalls in unterschiedlichen Mobilitäten widerspiegelt. Um bei diesem Beispiel zu bleiben, kann man sagen, dass eine Dampfschiffpassage ihren besonderen Charakter erst in der Zusammenschau mit anderen Formen von Transport und Kommunikation bekommt. Sie war eingebettet in ein Ensemble von Segelschiffüberfahrten, weltweiten Telegrafenkabeln oder auch der Unmöglichkeit anderer Verbindungen, die Wasserflächen nicht überqueren können. Die Dampferpassage hat eine bestimmte Rolle in diesen vielfältigen Verbindungsbündeln. Die Globalgeschichte will auch dieser spezifischen Bedeutung in der Pluralität von Verbindungen nachspüren.
Die Fragen, die sich daraus für die Globalgeschichte ergeben, sind vielschichtig. Die Freilegung historischer Transport- und Kommunikationsstrukturen von globaler Bedeutung und die Frage nach ihrer Funktionsweise und ihrer Leistungsfähigkeit spielen eine grundlegende Rolle. Vor allem aber interessiert sich die Globalgeschichte dafür, welches Potential als Mediatoren bestimmte Mobilitätstechnologien und -praktiken entfalten konnten. Wie haben sie den Charakter einer Verbindung mitgeformt? Welche Inhalte wurden hauptsächlich transportiert bzw. gegenüber anderen Inhalten privilegiert? In welche technologisch-sozialen Ensembles waren bestimmte Transport- und Kommunikationssysteme eingebettet? Gerade diese letzte Frage ist beispielsweise auch in Valeska Hubers anschaulicher Studie zur Geschichte des Sueskanals von entscheidender Bedeutung. Darin findet Hubers zu Beginn dieses Kapitels bereits erwähntes Konzept der multiple mobilities konkrete Anwendung im Rahmen einer klar umrissenen Fallstudie. Die Historikerin untersucht den 1869 eröffneten Sueskanal, der gemeinhin als verkehrstechnische Entwicklung von größter Bedeutung gilt, aus einer weniger fortschrittsorientierten, differenzierten Perspektive. Sie zeigt, wie der Kanal durch die Verkürzung der Route zwischen Europa und Asien Transport- und Kommunikation beschleunigte, gleichzeitig aber selbst zu einer Zone der Entschleunigung oder teilweise sogar des Stillstands wurde. Huber zeichnet die Beziehungen der Dampfschifffahrt durch den Kanal zu anderen Formen des Transports wie zum Beispiel Kamelkarawanen oder einheimischen Dhaus nach. Dadurch ebenso wie durch die Betonung verschiedenster Reisearten und -erfahrungen durch den Kanal bringt sie Leben in ihre Idee multipler Mobilitäten und kann eindrucksvoll zeigen, dass der Sueskanal den Schiffsverkehr eben nicht nur vereinfacht und beschleunigt, sondern auf viel komplexere Weise geprägt hat.[43]
Ein anderes Beispiel für eine globalgeschichtliche Auseinandersetzung mit Transport und Kommunikation findet sich in meiner eigenen Arbeit zur Entstehung eines globalen Telegrafennetzwerks im 19. Jahrhundert. Darin habe ich zum einen versucht, die Struktur dieses Netzes nachzuzeichnen und herauszuarbeiten, was es hieß, telegrafisch angebunden zu sein oder nicht. Darüber hinaus wollte ich aber vor allem wissen, was globale telegrafische Kommunikation verbindungsgeschichtlich bedeutet hat, welche Informationen eigentlich telegrafisch übermittelt wurden und welche nicht, welche unmittelbaren Auswirkungen eine solche Auswahl und die damit verbundene Komprimierung der versendeten Inhalte hatte. Es hat sich im Verlauf der Untersuchung herausgestellt, dass telegrafische Verbindungen einen ganz deutlichen Charakter als Mediatoren hatten und durch ihre spezifische Funktionsweise nachhaltig auf die übermittelten Inhalte und deren Wahrnehmung durch die Korrespondenten wirkten.[44]
Es versteht sich von selbst, dass keine der vier hier vorgestellten Perspektiven auf die Geschichte der Mobilität die eine richtige ist; dass keine Forschungsrichtung wichtigere oder relevantere Fragen stellt als ein andere. Die Liste der bestenfalls kursorisch vorgestellten Ansätze und der Versuch, deren Zugang zur Mobilitätsgeschichte aus ihren breiteren Erkenntnisinteressen herzuleiten, müssen exemplarisch bleiben. Es geht nicht darum, einen vollständigen Überblick darüber zu geben, aus welchen Winkeln man auf die Geschichte von Transport und Kommunikation blicken kann, um am Ende dann ein möglichst komplettes Bild zu haben. Viel wichtiger ist es nachzuzeichnen, auf wie vielen unterschiedlichen Ebenen ein analytisches Verständnis der menschlichen Mobilität, ihrer historischen Entwicklung, der technischen Grundlagen und der verwobenen kulturellen Praktiken für das Verständnis menschlicher Gesellschaften grundlegend ist. In diesem Zusammenhang wurden hier nur vier exemplarische Zugänge vorgestellt. Jenseits dieser Auswahl sind aber viele andere Fragenkomplexe aktuell und hochrelevant. Die Umweltgeschichte interessiert sich für den historischen Zusammenhang zwischen Mobilität, Natur und Umwelt. Fragen der Nutzbarmachung von Energiequellen sind hier beispielsweise von zentraler Bedeutung. Die Emotionsgeschichte wiederum untersucht die emotionalen und psychopathologischen Auswirkungen von Mobilität und greift damit ein für das frühe 21. Jahrhundert hochaktuelles Thema auf. All diese und viele andere Zugänge zur Geschichte der Mobilität seit dem 18. Jahrhundert werden in den folgenden Kapiteln immer wieder in miteinander verwobener Form auftauchen. Sie zeugen von der Prägekraft und historischen Wirkmächtigkeit des Gegenstands.
[40] Bayly.
[41] Conrad, Globalgeschichte, S. 9.
[42] O’Brien, S. 4.
[43] Huber, Channelling Mobilities.
[44] Wenzlhuemer, Connecting.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.