Euroskeptizismus auf dem Vormarsch
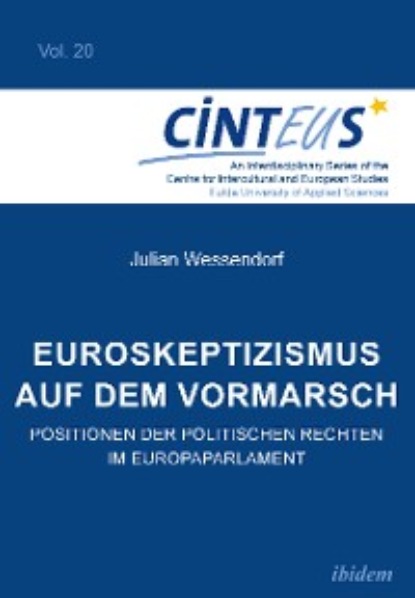
- -
- 100%
- +

ibidem-Verlag, Stuttgart
Der europäische Integrationsprozess, der in gut 70 Jahren einen in der bisherigen Geschichte und gegenwärtigen Welt singulären Staatenverbund, die heutige Europäischen Union, hervorgebracht hat, war von Beginn an auch von kritischen Stimmen und ablehnenden Haltungen begleitet.
Dabei haben sich im Laufe der Jahrzehnte die politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen über Ziele, Zwecke, Mittel und Formen der Integration verändert. Während der öffentliche Europadiskurs lange Zeit durch einen „permissive consensus“ charakterisiert war, der sich dadurch auszeichnete, dass Bevölkerungsmehrheiten dem Integrationsgeschehen wohlwollend aber passiv gegenüberstanden, führten die weitreichenden Veränderungen des Integrationssystems in den 1980er und 1990er Jahren (Binnenmarktvollendung, Währungsunion, mehrere Erweiterungsrunden etc.) zu einer sukzessiven Politisierung. Mit dem Kompetenzzuwachs der EU rückten neben grundlegenden Architektur- und Finalitätsfragen (wirtschaftlicher Zweckverband oder föderale Politische Union) auch einzelne EU-Politikfelder (die mittlerweile von A, wie Agrarpolitik, bis Z, wie Zuwanderung reichen) in den Fokus öffentlicher Kontroversen in den Mitgliedstaaten der Union.
Vor diesem Hintergrund eines sich ausdifferenzierenden und intensivierenden Europadiskurses hat sich innerhalb der EU-Integrationsforschung ein Forschungsstrang entwickelt, der sich unter dem Begriff des „Euroskeptizismus“ mit EU-kritischen gesellschaftlichen Strömungen auseinandersetzt und der die verschiedenen politischen Erscheinungsformen des Euroskeptizismus thematisiert, welcher von konstruktiven und moderaten Kritiken an Teilbereichen der EU bis zu einer fundamentalen Kritik und Ablehnung des Gesamtsystems reicht.
Dieser Forschungsansatz wurde und wird durch Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart sowohl empirisch als auch theoretisch mit zahlreichen neuen Fragen konfrontiert. Denn die Überlagerung gleich mehrerer Krisen historischen Ausmaßes in der vergangenen Dekade – Weltfinanzmarktkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise – hat dazu geführt, dass in der EU neben ökonomischen und sozialen Disparitäten auch soziokulturelle Identitätskonflikte zugenommen haben, was nicht zuletzt mit einer Stärkung rechtspopulistischer Parteien und nationalistischer Kräfte einhergegangen ist. Diese Entwicklungen und Kräfteverschiebungen haben wiederum Politikergebnisse hervorgebracht, die bis vor kurzem noch undenkbar waren, wie etwa das britische Votum für einen EU-Austritt oder Regierungen in einzelnen EU-Mitgliedstaaten, deren Grundhaltung und Praxis antidemokratisch ist und die sich einer nationalistischen, integrationsfeindlichen Rhetorik bedienen.
In diesem europapolitischen Kontext, der in seinen zentralen Konfliktlinien durch die heute noch nicht absehbaren integrationspolitischen Folgen der Corona-Pandemie eine weitere Politisierung erfahren dürfte, ist die vorliegende Studie angesiedelt.
Julian Wessendorf leistet in seiner Untersuchung „Euroskeptizismus auf dem Vormarsch. Positionen der politischen Rechten im Europaparlament “ einen wichtigen Beitrag zur politikwissenschaftlichen EU-Forschung. Die Studie reiht sich zugleich ein in jüngere und laufende Forschungsarbeiten des Center for Intercultural and European Studies (CINTEUS), darunter Arbeiten zur politischen Rechten in Europa, zur Frage einer kollektiven Europäischen Identität und zur demokratischen Legitimation der EU.
Die Untersuchung widmet sich den europapolitischen Vorstellungen EU-kritischer, rechtspopulistischer Parteien in der EU. Dazu werden fünf Parteien ausgewählt, deren Programmatik und politisches Agieren im Zeitraum der vergangenen Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2014 - 2019) und der jüngsten EP-Wahl 2019 analysiert werden: der französische Front National, die United Kingdom Independence Party (UKIP), die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), die Alternative für Deutschland (AfD) und die italienische Lega Nord. Die empirische Grundlage der Untersuchung bilden die jeweiligen Partei- und Wahlprogramme, die – angeleitet durch Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse – systematisch ausgewertet und verglichen werden.
Um diese Befunde in historischer und politischer Hinsicht angemessen einordnen und bewerten zu können, wird die Programmanalyse in zwei Schritten theoretisch eingebettet. In einem ersten Schritt präsentiert der Autor kenntnisreich und sorgfältig die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand der Euroskeptizismus-Forschung und gewinnt aus einer kritischen Auseinandersetzung ein eigenes Kategoriensystem, das die empirische, inhaltsanalytische Untersuchung anleitet. In einem zweiten Schritt wird der Stand der Parteienforschung mit Blick auf den Untersuchungsgegenstand reflektiert und rezipiert. Das dadurch gewonnene begriffliche Raster entlang einschlägiger Parteientypologien (national-konservativ, rechtspopulistisch, rechtsextrem etc.) trägt seinerseits dazu bei, die empirischen Befunde differenziert zu erfassen und vergleichend einzuordnen.
Gerade in dieser gelungenen Verbindung von relevanten Theoriebeständen der Euroskeptizismusforschung und Rechtspopulismusforschung mit einer vergleichend angelegten empirischen Untersuchung der europäischen Programmatik maßgeblicher Rechtsparteien in fünf europäischen Ländern liegt das besondere Verdienst dieser Untersuchung. Denn auf diese Weise gelingt es Julian Wessendorf, ein differenziertes, empirisch fundiertes Bild der Europapolitik der politischen Rechten im geschichtlichen und gegenwärtigen Spektrum euroskeptischer Diskurse zu zeichnen und zugleich die Bedingungen und Grenzen des Zusammenwirkens dieser Parteien auf europäischer Ebene sichtbar zu machen.
Die Studie bietet methodische, konzeptionelle und inhaltliche Anregungen für eine weitergehende wissenschaftliche Debatte. In Zeiten einer Gefährdung des europäischen Projekts und eines mühsamen politischen Ringens um dessen Zukunft liefert sie zugleich auch wichtige politische Erkenntnisse für einen aufgeklärten gesellschaftlichen Europa-Diskurs.
Hans-Wolfgang Platzer,
im Januar 2021
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Euroskeptizismus und die politische Rechte
2.1 Was ist Euroskeptizismus?
2.1.1 Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Euroskeptizismus und der aktuelle Forschungsstand
2.1.2 Schwierigkeiten mit der Begrifflichkeit des Euroskeptizismus
2.1.3 Erklärungen für Euroskeptizismus
2.2 Das (ideologische) Spektrum der politischen Rechten
3 Euroskeptizismus im Europaparlament
3.1 Methodisches Vorgehen und Untersuchungsansatz
3.2 Historische Betrachtung des Euroskeptizismus im Europäischen Parlament
3.3 Schwierigkeiten der Fraktionsbildung in der 8. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments
3.4 Analyse ausgewählter Parteien des Europaparlaments
3.4.1 Der Front National
3.4.2 Die United Kingdom Independence Party
3.4.3 Die Freiheitliche Partei Österreichs
3.4.4 Die Alternative für Deutschland
3.4.5 Die Lega Nord
3.5 Erstes Zwischenfazit: Einordnung der Ergebnisse
3.5.1 Einordnung der Parteien in das politische Spektrum
3.5.2 Dimensionen des Euroskeptizismus in den Parteiprogrammen
3.6 Analyse der Wahlprogramme zu den Europawahlen 2019
3.6.1 Das Rassemblement National
3.6.2 Die United Kingdom Independence Party
3.6.3 Die Freiheitliche Partei Österreichs
3.6.4 Die Alternative für Deutschland
3.6.5 Die Lega
3.7 Zweites Zwischenfazit: Einordnung der Ergebnisse
4 Abschließende Betrachtung
5 Literatur- und Quellenverzeichnis
5.1 Literaturverzeichnis
5.2 Quellenverzeichnis
6 Anhang
1 Einleitung
Der Prozess der Europäischen Integration war bei allen Erfolgen stets auch von Krisen und heftigen Kontroversen begleitet, in denen unterschiedliche Formen von Euroskeptizismus zum Ausdruck kamen. Skeptische Haltungen gegenüber der Europäischen Integration als Gesamtes oder auch nur gegen vereinzelte Ausprägungen der europäischen Zusammenarbeit sind demnach kein neues Phänomen. Dennoch erreichten die Krisen und die damit verbundene Kritik in der vergangenen Dekade nochmal eine neue Qualität.
So wurden durch die Eurokrise die kritischen Stimmen gegenüber der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und der seit 1999 bestehenden Eurozone immer lauter. Obwohl die Finanzkrise nicht von Europa ausging, wurde der Euro zum „scapegoat for all socio-economic inequalities endured from 2008 onwards“ (Startin 2018: 81) erklärt. Mit der Migrationskrise seit 2015 fanden euroskeptische Stimmen ein neues Thema. In diesem Zusammenhang beruft man sich u. a. auf die große Belastung für die europäischen Außengrenzen und die Unfähigkeit der EU mit solch einer humanitären Krise umzugehen. Zusätzlich wird die Angst vor illegaler Einwanderung und einer möglichen Bedrohung durch den Islam geschürt. Aber auch noch nie dagewesene Entwicklungen, wie der 2016 durch Referendum beschlossene Brexit oder die Anti-EU-Propaganda durch amtierende europäische Regierungen, stellen die EU in der jüngsten Vergangenheit vor bisher unbekannte Herausforderungen. Insbesondere die Tatsache, dass der EU-Austritt in Großbritannien per Volksentscheid beschlossen wurde, stärkte in der Folge auch in anderen europäischen Ländern den Wunsch nach einem Referendum und die Bestrebungen nach größerer Autonomie und Souveränität. Insbesondere rechte Parteien stachen in den vergangenen Jahren hervor, wenn es darum ging, die EU zu kritisieren und deren Existenz in Frage zu stellen. Noch nie zuvor bedrohte eine Krise die europäische Staatengemeinschaft und ihre Werte so sehr, wie diese.
In Zeiten, in denen rechte Parteien die treibende Kraft im euroskeptischen Diskurs bilden und der Nationalismus wieder als echte Bedrohung für die EU angesehen werden muss, ist es wichtig, sich mit aktuellen Entwicklungen in der Politiklandschaft auseinanderzusetzen. In der Forschung wurde der Euroskeptizismus lange Zeit zumeist auf nationaler Ebene untersucht ohne gesamteuropäische Zusammenhänge zu betrachten. Hierbei lag der Fokus oftmals lediglich auf der Erstellung bestimmter Länderprofile oder der Erfassung der öffentlichen Meinung (vgl. u. a. Ray 1999; Szczerbiak & Taggert 2008). Auch scheint es so, als würden – trotz einer Öffnung zu einer größeren Praxisorientiertheit in den letzten Jahren (vgl. u. a. Sørensen 2008; Vasilopoulou 2018) – weiterhin die theoriebezogenen Ansätze aus den Anfängen der Euroskeptizismusforschung das Feld dominieren (vgl. u. a. Taggert & Szczerbiak 2001; Kopecký & Mudde 2002; Miliopoulos 2017). Um der Diskussion um Euroskeptizismus eine neue Perspektive zu bieten, werden in der vorliegenden Studie ausgewählte Parteien der europäischen politischen Rechten bezüglich ihrer EU-Programmatik untersucht, um eventuelle Verbindungen zwischen nationalistischer Ideologie und euroskeptischer Einstellung herauszuarbeiten und parteiübergreifende Gemeinsamkeiten auszumachen. Aus diesem Grund wird der folgenden Forschungsfrage nachgegangen: Wie artikuliert sich der Euroskeptizismus in der Parteipolitik der politischen Rechten des europäischen Parlaments und was leistet die theoretische Euroskeptizismusdebatte, um die europapolitische Programmatik rechtspopulistischer Parteien angemessen zu verorten?
Der erste Teil der Untersuchung verschafft zunächst einen Überblick über die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Euroskeptizismus, den aktuellen Forschungsstand und die Schwierigkeiten, die Begrifflichkeit ‚Euroskeptizismus‘ zu erklären. Zum Abschluss des theoretischen Teils wird das ideologische Spektrum der politischen Rechten im Verständnis der vorliegenden Untersuchung erläutert, da dieses eine signifikante Rolle in der Analyse der Parteiprogramme spielt. Im zweiten Teil wird eine Untersuchung durchgeführt, die sich lose an den Rahmenbedingungen der qualitativen Inhaltsanalyse orientiert. Nach der Erklärung des genauen methodischen Vorgehens in der Untersuchung und einer historischen Betrachtung des Euroskeptizismus im Europaparlament wird im Anschluss zunächst auf die 8. Legislaturperiode und die Schwierigkeiten der Fraktionsbildung eingegangen. Darauf folgt die Analyse der Wahl- und Parteiprogramme fünf ausgewählter Parteien der politischen Rechten – Front National, United Kingdom Independence Party (UKIP), Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), Alternative für Deutschland (AfD) und Lega Nord – im Zeitraum von 2014 bis 2018. In einem ersten Zwischenfazit werden die untersuchten Parteien zunächst in das politische Spektrum eingeordnet und anschließend in Bezug auf die jeweilige euroskeptische Ausrichtung in die bestehenden Typologisierungsmodelle des Euroskeptizismus einsortiert. In einer weiteren Teilbetrachtung werden abschließend noch einmal die Parteiprogramme der untersuchten Parteien zur Europawahl 2019 synchron betrachtet und in einem zweiten Zwischenfazit mit den Ergebnissen der historisch-genetischen Betrachtung aus dem ersten Teil in Relation gesetzt. In der Schlussbetrachtung werden schließlich alle relevanten Ergebnisse noch einmal zusammengefasst und ein Ausblick auf mögliche weitere Forschungsansätze gegeben.
2 Euroskeptizismus und die politische Rechte
Um die anschließende Analyse in einen theoretischen Kontext setzen zu können, wird in den nächsten Kapiteln zunächst näher auf das Phänomen Euroskeptizismus und den aktuellen Forschungsstand eingegangen. Dabei wird versucht, die gängigsten Typologisierungsmodelle für Euroskeptizismus aufzuschlüsseln, um ein für diese Untersuchung angemessenes Verständnis herauszuarbeiten. Im nächsten Schritt wird auf die allgemeinen Schwierigkeiten der Begrifflichkeit des Euroskeptizismus eingegangen, um danach die konkreten Herausforderungen für das Forschungsfeld ‚Euroskeptizismus‘ zu erläutern. Abschließend werden einige Erklärungen für den Euroskeptizismus aufgeführt, um diesen im Kontext weltpolitischer Ereignisse zu betrachten. Danach wird ein kurzer Überblick über das politische Spektrum rechter Parteien gegeben, um die in der Analyse untersuchten Parteien im Anschluss den jeweiligen Ausprägungen entsprechend zuordnen zu können.
2.1 Was ist Euroskeptizismus?
Der Euroskeptizismus ist kein unbekanntes oder neuaufgetretenes Phänomen. Die französische Politikwissenschaftlerin Cécile Leconte (2010: 3) weist darauf hin, dass bereits Mitte der 1960er Jahre, während Charles de Gaulle Präsident Frankreichs war, der Begriff Eurocrat in französische Wörterbücher aufgenommen wurde und schon damals den Unterschied zwischen der europäischen Elite und den durchschnittlichen BürgerInnen Europas klar hervorhob. Nichtsdestotrotz bemerkt sie auch, dass der Begriff zwar nicht synonym zu Euroskeptizismus verwendet werden kann, die Aufnahme des Begriffs in das französische Wörterbuch jedoch belege, dass bereits in den Anfängen der EU einige Grundideen des euroskeptischen Diskurses vorhanden waren (ebd.). Später verwendeten vor allem britische Medien den Begriff in Zusammenhang mit explizit britischem Euroskeptizismus und bezeichneten im Zuge dessen auch die ehemaligen Premierminister Winston Churchill (1940-1945 und 1951-1955), Harold Wilson (1964-1970 und 1974-1976) und Margaret Thatcher (1979-1990) allesamt als Euroskeptiker bzw. Euroskeptikerin, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen: Churchill (1946) war der Meinung, dass sich vor allem Kontinentaleuropa zu einem Staatenverbund zusammenschließen sollte, während er Großbritannien explizit außerhalb einer solchen Konstellation sah. Wilson (1974) hingegen war zwar ein grundsätzlicher Befürworter der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), versprach aber im Zuge seiner Wahlkampagne 1974 eine Neuverhandlung der Mitgliedsverträge Großbritanniens und stimmte einem Referendum zum Verbleib in der EWG zu, welches schließlich 1975 stattfand. Auch Thatcher (1988) hob immer wieder hervor, wie wichtig die Wahrung nationaler Interessen sei, da Europa nur unter dieser Prämisse funktionieren könne. In einer Rede zur Zukunft Europas am College of Europe in Brügge betonte sie diesbezüglich, es sei am besten, eine aktive Kooperation zwischen den unabhängigen und souveränen Mitgliedstaaten der Union aufrechtzuerhalten und zu pflegen, um eine erfolgreiche europäische Gemeinschaft aufzubauen. Sie unterstrich vor allem, dass es schädlich sei, die „nationhood“ zu unterdrücken und Europa entsprechend stärker wäre, wenn „France as France, Spain as Spain, Britain as Britain, each with its own customs, traditions and identity“ (Thatcher 1988) fortbestünde. Dennoch merkte sie an, dass es ihr besonders wichtig sei, ein geeinigtes Europa zu schaffen, welches ein gemeinsames Ziel verfolgte, auch wenn sie an dieser Stelle erneut darauf hinwies, dass dies nur bei ausreichendem Schutz nationaler Traditionen, politischer Machtverhältnisse und des jeweiligen Nationalstolzes der unterschiedlichen Länder möglich sei. Im Laufe ihrer Amtszeit gelang es ihr, in zahlreichen Punkten vorteilhafte Sonderregelungen für Großbritannien – wie bspw. den sog. Britenrabatt – auszuhandeln, die anderen Mitgliedstaaten jedoch nicht eingeräumt wurden.
Bei Aufkommen des Terminus Euroskeptizismus wurde dieser in Großbritannien zunächst vornehmlich synonym zu dem Begriff „anti-marketeer“ verwendet. Als „anti-marketeer“ bezeichnete man diejenigen Personen, die grundsätzlich gegen den Beitritt Großbritanniens zum Europäischen Binnenmarkt waren und diese Position auch nach dem britischen Referendum 1975 weiterhin beibehielten. Mit der Zeit entwickelte sich die Verwendung des Terminus Euroskeptizismus aber immer mehr zu einem generischen Sammelbegriff britischer Zweifel in Bezug auf Europa (vgl. Spiering 2004: 128). Später öffnete sich der Begriff etwas und fasste von nun an verschiedenste kritische Haltungen gegenüber der Europäischen Integration im Allgemeinen und der EU im Speziellen zusammen. Harmsen und Spiering (2004: 13) gingen sogar noch einen Schritt weiter und sprachen von einem eindeutig britischen Phänomen, dass dazu beitragen sollte, „a sense of the country’s ‚awkwardness‘ or ‚otherness‘ in relation to a Continental European project of political and economic integration“ hervorzuheben. Beschränkte sich die Euroskeptizismusforschung zu Beginn noch vornehmlich auf die westeuropäischen Staaten (u. a. Taggert 1998), so öffnete sich die Debatte mit der ersten Osterweiterung 2004 auch für die Staaten aus Mittel- und Osteuropa (u. a. Hooghe & Marks 2007; Szczerbiak & Taggert 2008).
2.1.1 Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Euroskeptizismus und der aktuelle Forschungsstand
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema des Euroskep-tizismus wurde hauptsächlich von der Öffnung des Begriffs und seiner Erweiterung auf ganz Europa vorangetrieben. Die Diskussion erfuhr aber auch durch verschiedenste politische Entwicklungen in den 1990er Jahren zusätzliche Aufmerksamkeit, wie bspw. die Unterzeichnung der Einheitlichen Europäischen Akte (1986) oder des Vertrags von Maastricht (1992). In dieser Zeit wurden vor allem zwei Ebenen des Euroskeptizismus wissenschaftlich untersucht: parteibasierter Euroskeptizismus und Masseneuroskeptizismus.1 Szczerbiak und Taggert (2003: 6) bemerken hierzu, dass die alleinige Verwendung des Sammelbegriffs Euroskeptizismus zur Beschreibung und Analyse der Auswirkung der Europäischen Integration auf Innenpolitik und Parteiensysteme vor allem dann Schwierigkeiten hervorbringe, wenn versucht würde, das Phänomen des Euroskeptizismus vergleichend – und hierbei im Speziellen – pan-europäisch zu untersuchen.
Aus diesem Grund versuchte der britische Politikwissenschaftler Paul Taggert (1998) eine allgemeine Definition des Euroskeptizismus, welche vor allem für den politischen Diskurs verwendbar sein sollte und eine präzisiere Differenzierung erlaubte. In diesem Zusammenhang unterteilte er den Euroskeptizismus zunächst in drei verschiedene Arten, die sich mit der Einstellung zur EU erklären lassen. In der ersten Kategorie definiert er den Euroskeptizismus im Sinne eines vollständigen Widerstandes gegen die europäische Integration und damit auch gegen die EU an sich (Taggert 1998: 365). Während diese Kategorie eine klar ablehnende Haltung gegenüber der EU impliziert, ist die Unterscheidung der anderen beiden Charakterisierungen nicht so eindeutig. Beide richten sich nicht prinzipiell gegen die europäische Integration, stehen jedoch der Annahme skeptisch gegenüberstehen, die EU verfolge die beste Art der Integration. Kategorie 2 argumentiert, die EU sei zu inklusiv und versuche Dinge zusammenzuführen, die zu unterschiedlich sind. Taggert (1998: 366) fasst hierunter diejenigen SkeptikerInnen zusammen, die der Meinung sind, die Rechte der einzelnen Staaten würden eingeschränkt werden und eine europäische Integration würde zwangsläufig große Migrationsströme mit sich ziehen. Typus 3 hingegen argumentiert, die EU sei sowohl auf geografischer als auch auf sozialer Ebene zu exklusiv. Hier bezieht sich Taggert vor allem auf diejenigen KritikerInnen, die bspw. meinen, die EU sollte auch außereuropäische Länder aufnehmen oder sie würde die Interessen der internationalen Arbeiterklasse übergehen. Zusammenfassend stellt Taggert (1998: 366) fest, dass Euroskeptizismus „the idea of contingent or qualified opposition, as well as incorporating outright and unqualified opposition to the process of European integration” ausdrückt. Nur kurze Zeit später konkretisierten Taggert und Szczerbiak Taggerts ursprüngliche Definition des Euroskeptizismus und führten die Unterscheidung zwischen weichem und hartem Euroskeptizismus ein, um vor allem den Grad der Ablehnung der europäischen Integration in der Definition deutlicher zu differenzieren. Demnach sehen sie im harten Euroskeptizismus einen generellen Widerspruch zur Europäischen Integration, der per definitionem die Forderung nach dem EU-Austritt nach sich zieht (Taggert & Szczerbiak 2001: 10).2 Auf der anderen Seite bezeichnen sie es als weichen Euroskeptizismus, wenn nur ein anteiliger Widerspruch gegen die Europäische Integration und die Mitgliedschaft in der EU besteht, die VertreterInnen dieser Form des Euroskeptizismus aber nicht grundsätzlich antieuropäisch eingestellt sind (Taggert & Szczerbiak 2001: 10). Einen zusätzlichen Unterscheidungsfaktor sehen Taggert und Szczerbiak im politisch und nationalistisch motivierten Euroskeptizismus (ebd.). Während der politisch motivierte Euroskeptizismus vor allem eine oppositionelle Haltung gegenüber vereinzelter politischer Themenfelder oder Verfahrensweisen darstellt, die je nach Aktualität oder individuellen Neigungen variieren können, bezeichnet der nationalistisch motivierte Euroskeptizismus das vehemente Eintreten für nationale Interessen auf europäischer Ebene. Bei dieser Unterteilung ist jedoch zu beachten, dass sich beide Formen des Euroskeptizismus nicht gegenseitig ausschließen müssen und es vereinzelt zu Überschneidungen kommen kann.
Vor allem am Begriff des weichen Euroskeptizismus kritisiert Miliopoulos (2017: 61), dass nach dieser Differenzierung keine Möglichkeit bestehe, zwischen weichem Euroskeptizismus und konstruktiv gemeinter EU-Kritik zu unterscheiden und dementsprechend fast jede kritische Haltung gegenüber der Politik der EU als weich euroskeptisch bezeichnet werden müsste.3 Auch Kopecký und Mudde (2002) kritisieren eine fehlende Präzision in der Unterscheidung der unterschiedlichen Ausprägungen des Euroskeptizismus.4 Ihre Kritik zielt vor allem auf vier Punkte ab. Wie auch Miliopoulos (2017) merken sie an, dass der Begriff des weichen Euroskeptizismus so weit gefasst sei, dass nahezu jede Nichtübereinstimmung mit einer EU-politischen Entscheidung in dieser Kategorie angesiedelt werden müsse und die Definition daher überinklusiv sei (Kopecký & Mudde 2002: 300). Zudem kritisieren sie, bereits die vermeintlich klare Unterteilung in hart und weich würde von Taggert und Szczerbiak selbst verwischt werden, da sie behaupten, der harte Euroskeptizismus könne als grundlegender Einwand gegenüber dem aktuellen Zustand der europäischen Integration in der EU identifiziert werden, was nach eigener Definition eher dem weichen Euroskeptizismus entspräche (Kopecký & Mudde 2002: 300). Der dritte Punkt ihrer Kritik zielt darauf ab, die Autoren würden sich nicht dazu äußern, weshalb es so schwierig sei, die Existenz verschiedener Arten des Euroskeptizismus zu unterscheiden, da die expliziten Kriterien, die zur Unterscheidung zwischen hart und weich verwendet wurden, unklar bleiben. Abschließend bemerken sie, eine Kategorisierung in harten und weichen Euroskeptizismus würde der Unterscheidung zwischen den Ideen der europäischen Integration und der EU als Körperschaft dieser Ideen nicht ausreichend gerecht werden. Folglich sei diese Definition des Begriff Euroskeptizismus fälschlicherweise Parteien und Ideologien zugeschrieben, die sowohl grundsätzlich pro-europäisch als auch gänzlich antieuropäisch eingestellt sein können. Dies könnte in der Folge dazu führen, dass es in parteipolitischen Systemen zu einer Über- aber auch zu einer Unterschätzung der Stärke dieses Phänomens kommt und dementsprechend entweder mehr oder weniger Euroskeptizismus erkennen lässt als tatsächlich vorhanden ist (ebd.).

