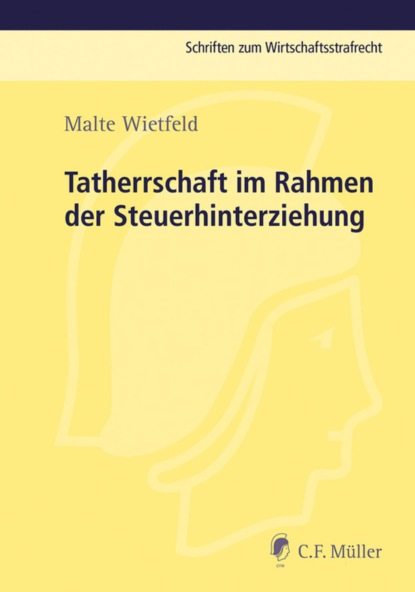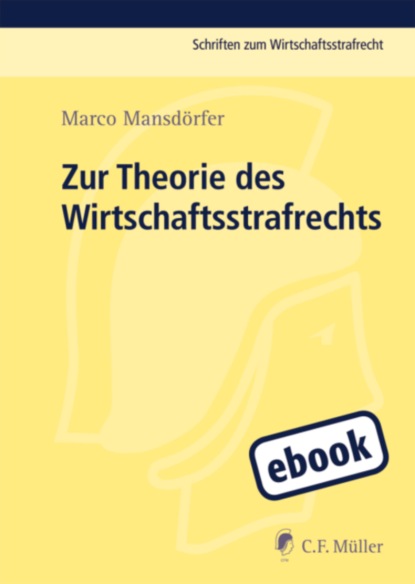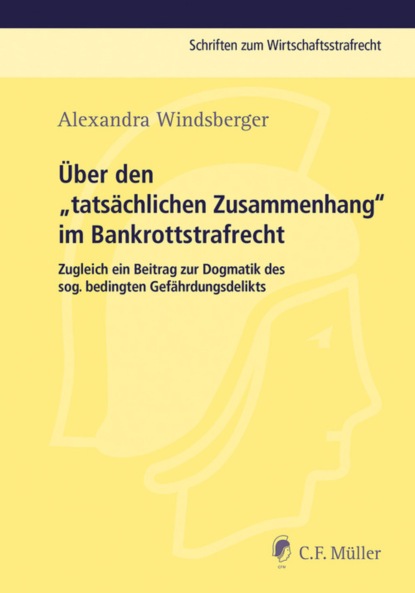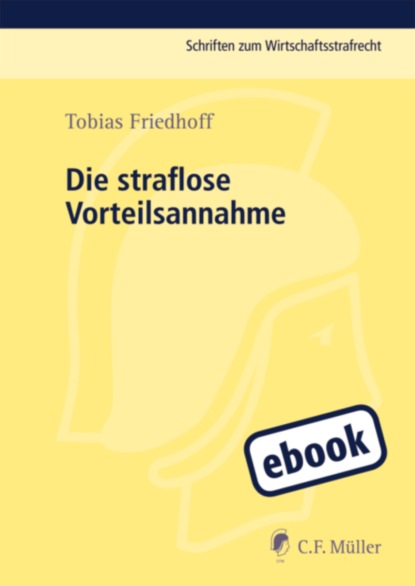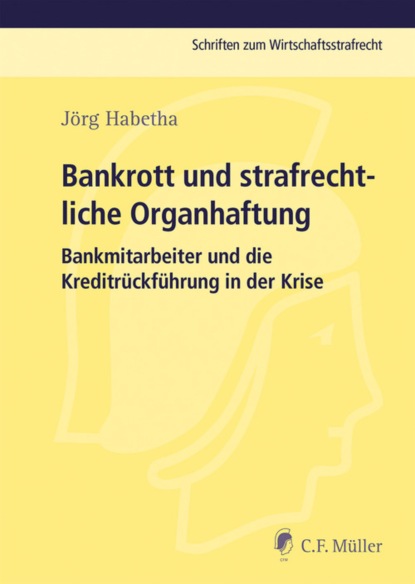- -
- 100%
- +
[3]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 33.
[4]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 33.
[5]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 33.
[6]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 33.
[7]
Siehe etwa Rudolphi FS Bockelmann, S. 369 (373).
[8]
Siehe etwa Roxin Strafrecht Allgemeiner Teil, § 25 Rn. 188.
[9]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 34 ff., 36 ff.
[10]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 35, 36.
[11]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 34.
[12]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 37.
[13]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 39.
G. Verlust des objektiven Tatbezuges der Tatherrschaftslehre
25
Weiterhin wird der Tatherrschaftslehre der Verlust eines objektiven Tatbezugs vorgeworfen.[1] Unter objektivem Tatbezug wird die Einordnung der Tatherrschaftslehre in den objektiven Deliktstatbestand verstanden. Dieser Einwand wird in erster Linie auf die Anwendung der Äquivalenztheorie im Rahmen des objektiven Tatbestandes zurückgeführt. Die Äquivalenztheorie gehe von der Gleichwertigkeit sämtlicher Bedingungen auf der objektiven Ebene aus. Der Verursachungsbeitrag des Teilnehmers führe also ebenso zum Erfolg wie derjenige des Täters. Es stelle sich dann aber die Frage, warum nur dem Täter Handlungsherrschaft zugesprochen werde, wenn doch sämtliche Bedingungen – und damit auch der Tatbeitrag des Teilnehmers – gleich seien. Auf der Basis der Äquivalenztheorie sei es im Grunde nicht möglich, bereits auf der objektiven Ebene zu einer Abgrenzung von Handlungsherrschaft und bloßen Teilnahmehandlungen zu kommen.[2] Es bleibe allein der Ausweg, die verschiedenen Tathandlungen nach ihrer unterschiedlichen Gefährlichkeit einzustufen, wonach dann Täter derjenige sei, dessen Tathandlung die größere Gefährlichkeit aufgewiesen habe. Dieser Weg habe jedoch zur Konsequenz, dass die solchermaßen definierte Tatherrschaft zu einer von der objektiven Tatbegehung losgelösten Eigenschaft des Täters werde.[3] Dies führe allerdings zu einem reinen Gesinnungsstrafrecht.[4] Insgesamt sei hieran der Verlust des objektiven Tatbezuges der Tatherrschaftslehre abzulesen.
Auch Kriterien der objektiven Zurechnung seien nicht geeignet diesem Problem abzuhelfen.[5] Es werden nämlich grundlegende Einwände gegen die Lehre von der objektiven Zurechnung gesehen. Diese werden vornehmlich an dem Kriterium des unerlaubten Risikos fest gemacht. Dessen Anwendung führe zwangsläufig dazu, dass unterschiedliche Bedingungen bereits auf der objektiven Ebene nicht als gleichwertig angesehen werden könnten, denn anders lasse sich nicht erklären, warum das vom Täter geschaffene unerlaubte Risiko ein anderes sein solle als das des Teilnehmers. Ein solches Verständnis lasse sich jedoch nicht mit der Äquivalenztheorie, die von einer objektiven Gleichwertigkeit aller Bedingungen ausgehe und auf deren Erkenntnissen die Lehre von der objektiven Zurechnung fuße, in Einklang bringen.[6]
Insgesamt sei es also nicht möglich, auf der objektiven Ebene ein dogmatisches Kriterium festzulegen, das geeignet sei, täterschaftliches Handeln von Teilnehmerhandeln zu unterscheiden. Ein solches Kriterium könne allenfalls beim Täter persönlich gefunden werden. Dies berge für sich genommen allerdings wiederum die Gefahr, dass Tatherrschaft zu einer bloßen Gesinnung entwertet würde.[7] Das Kriterium der Tatherrschaft weise demnach insgesamt keinen ausreichenden Bezug zur objektiven Tatseite auf, sondern müsse vielmehr in einer Zwischenebene zwischen objektivem und subjektivem Tatbestand eingeordnet werden.[8]
Dieser Einwand, der sich mit einem Verlust des objektiven Tatbezugs der Tatherrschaftslehre auseinandersetzt, weist einen inhaltlichen Zusammenhang zu der Kritik auf, die gegen das Kriterium der Handlungsherrschaft vorgetragen wird. Auch hier geht es um die Problematik, dass auf der Basis der Äquivalenztheorie Tatbeiträge von unterschiedlicher Intensität dazu in der Lage sind, den tatbestandlichen Erfolg zu verursachen. Dies verhindere eine Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme auf objektiver Tatbestandsebene, weil sich die maßgebliche Tatbestandshandlung nicht konkret definieren lasse.
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung von Tatherrschaft im Rahmen der Steuerhinterziehung lässt sich dieser Einwand gegen die Tatherrschaftslehre nur dann entkräften, wenn es gelingt, aus dem Tatbestand des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO eine konkrete Tatbestandshandlung abzuleiten, deren Vornahme zwingend zu einer täterschaftlichen Verantwortung führt. Sollte dies gelingen, wäre eine Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme im Rahmen der Steuerhinterziehung bereits auf objektiver Ebene möglich und der Vorwurf, die Tatherrschaftslehre leide an einem Verlust des objektiven Tatbezuges, ließe sich insoweit für die Fälle des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO entkräften.
Anmerkungen
[1]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 40 ff.
[2]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 41 f.
[3]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 42.
[4]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 43.
[5]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 43 ff.
[6]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 45 f.
[7]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 42 f.
[8]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 46 f.
H. Zwischenfazit zur neuesten Kritik an der Tatherrschaftslehre
26
Auch die Einwände gegen die Tatherrschaftslehre, die sich vornehmlich mit den rechtsdogmatischen Grundlagen dieser Täterlehre auseinandersetzen, lassen sich möglicherweise auf das Steuerstrafrecht übertragen und werfen dort die Frage nach der Tauglichkeit des Tatherrschaftskriteriums im Rahmen der Steuerhinterziehung auf. Von Interesse ist hierbei zunächst, ob für die Anwendung der Tatherrschaftslehre auf die Steuerhinterziehung eine normative Einordnung des Tatherrschaftskriteriums notwendig ist und wie eine solche sich unter Umständen herleiten ließe. Sodann ist klärungsbedürftig, ob im Rahmen der funktionellen Tatherrschaft des Mittäters allein auf das eigene Tatverhalten des potentiellen Mittäters abgestellt werden kann, oder ob es darüber hinaus einer Zurechnung fremder Verursachungsbeiträge bedarf und inwieweit eine derartige Verhaltenszurechnung überhaupt möglich ist. Schließlich gibt diese Kritik Anlass zu der Untersuchung, ob sich im Rahmen der Steuerhinterziehung ein konkretes Tatverhalten definieren lässt, welches eine Unterscheidung von Täterschaft und Teilnahme bereits auf der objektiven Tatbestandsebene ermöglicht und daher den Vorwurf entkräftet, die Tatherrschaftslehre leide an einem Verlust des objektiven Tatbezuges.
Teil 3 Neueste Kritik an der Tatherrschaftslehre › H. Zwischenfazit zur neuesten Kritik an der Tatherrschaftslehre › I. Tatherrschaft bei „Verursachungsdelikten“
I. Tatherrschaft bei „Verursachungsdelikten“
27
Die Kritik an der Tatherrschaftslehre setzt sich wiederholt mit der Frage auseinander, wie sich Tatherrschaft bei sogenannten Verursachungsdelikten verhält.[1] In diesem Bereich ähneln sich die Argumentationsmuster von Rotsch und Marlie.[2] Unter dem Begriff „Verursachungsdelikt“ wird auch bei Rotsch ein Tatbestand verstanden, bei dem es für die Deliktsbeschreibung nicht auf eine konkrete Tatbestandshandlung, sondern ausschließlich auf die Verursachung des tatbestandlichen Erfolges ankommen soll.[3] Eine der Kernthesen besteht hierbei darin, dass sich der ganz überwiegende Teil aller Straftatbestände des Strafgesetzbuches nur als reine Verursachungsdelikte interpretieren ließen.[4] Dieser Umstand führe zu erheblichen Problemen im Rahmen der Täterlehre.[5]
Ansatzpunkt der Analyse dieses Problems ist die „Relativität des Tatherrschaftsbegriffes“. Darunter wird die Abhängigkeit der Tatherrschaft von dem tatbestandsmäßigen Geschehen verstanden. Tatherrschaft lasse sich nur dann adäquat bestimmen, wenn vorab feststehe, welches Verhalten der Täter beherrschen müsse, um Tatherrschaft zu haben und damit Täter zu sein.[6] Diese Grundvoraussetzung der Tatherrschaftslehre werde von ihren Anhängern jedoch in zweifacher Hinsicht missachtet. Dies äußere sich zum einen darin, dass Täterschaft bei Anwendung der Tatherrschaftslehre weitgehend „wertend“ und „ohne Maßstab“ bestimmt werde.[7] Grund hierfür soll sein, dass bei Verursachungsdelikten nicht auf ein konkret eingrenzbares Verhalten, das beherrscht werden müsse, abgestellt werden könne. Zwingende Folge aus diesem Umstand sei, dass der gesamte Kausalverlauf beherrscht werden müsse, um von Tatherrschaft sprechen zu können, weil ein einzelnes Verhalten nicht abstrakt festgelegt werden könne. Problematisch hieran sei jedoch, dass der „gesamte Kausalverlauf“ eines Deliktes keinen ohne weiteres bestimmbaren Anfang habe, weil sich die Kausalkette auf der Basis der Äquivalenztheorie bis ins Unendliche ausdehnen lasse. Dennoch oder gerade deswegen bedürfe es einer Eingrenzung, welches Verhalten beherrscht werden müsse. Diese Eingrenzung könne bei Anwendung der Tatherrschaftslehre nur in der Tatherrschaft selbst gesehen werden, weil die Tatherrschaftslehre darüber hinaus kein weiteres Abgrenzungskriterium anbiete. Das Kriterium der Tatherrschaft diene also zusätzlich dazu, das Verhalten einzugrenzen, welches beherrscht werden müsse. Vor dem Hintergrund, dass der Begriff der Tatherrschaft für sich genommen jedoch inhaltsleer und damit ausfüllungsbedürftig sei, könne eine derartige Eingrenzung nicht objektiv, sondern allenfalls „wertend“ und „ohne trennscharfen Maßstab“ bestimmt werden.[8] Dies sei der erste Umstand, den die Anhänger der Tatherrschaftslehre bei Anwendung des Tatherrschaftsgedankens auf Verursachungsdelikte nicht beachteten.
Hieran anschließend sei aber noch ein zweiter, etwas anders gearteter Vorwurf an die Tatherrschaftslehre zu richten. Sie beachte nicht ausreichend, dass der Begriff der Tatherrschaft bereits aufgrund seiner relativen, beziehungsweise „adjektivischen“ – Abhängigkeit zum Oberbegriff des tatbestandlichen Erfolges nichts zu einer näheren Konkretisierung der Tatbestandshandlung beitragen könne.[9] Der Umstand, dass die Tatherrschaftslehre im Rahmen von Verursachungsdelikten ihren eigenen Bezugsrahmen selbst mitdefinieren müsse, überstrapaziere die Möglichkeiten dieses – allein adjektivisch zu verwendenden – Begriffes. Zur Begründung dieser These wird darauf verwiesen, dass der Begriff der Tatherrschaft denknotwendig in einer relativen Abhängigkeit zu dem tatbestandlichen Erfolg der Tat als Oberbegriff stehe. Tatherrschaft könne demzufolge nur adjektivisch verstanden werden und die Tat nicht konstituieren. Deshalb könne die Tatherrschaftslehre nicht formulieren: „Es tötet nur, wer mit Tatherrschaft tötet“, sondern sie könne allenfalls behaupten: „Es könne nur derjenige Täter eines Totschlags im Sinne von § 212 StGB sein, der das Tötungsgeschehen als Zentralgestalt (mit „Tatherrschaft“) beherrsche.“[10] Es sei also nicht denkbar, dass der Begriff der Tatherrschaft aus sich selbst heraus festlege, wer Täter sei. Die Tatherrschaftslehre könne sich dem Täterbegriff vielmehr ausschließlich beschreibend nähern. Illustriert am Beispiel einer Alltagssituation sind diese Ausführungen wie folgt zu verstehen: die Aussage „der Pullover ist blau“ gestattet keinerlei Rückschlüsse darauf, was mit der Farbe Blau an sich gemeint ist. Die Farbe Blau muss also schon vorab definiert sein, um die Aussage verstehen zu können, weil das Adjektiv blau nur den Zustand des Pullovers beschreiben kann. Übertragen auf die Lehre von der Tatherrschaft bedeutet dies, dass unabhängig von dem Begriff der Tatherrschaft vorab feststehen muss, welches das tatbestandsmäßige Geschehen ist, das der Täter beherrschen muss, um als solcher zu gelten. Hierbei, müsse aber beachtet werden, dass das Tatherrschaftskriterium aufgrund seiner relativen Abhängigkeit zum Oberbegriff des tatbestandlichen Erfolges nicht dazu geeignet sei, derartige Kriterien aus sich selbst heraus zu bestimmen.[11]
Anmerkungen
[1]
Rotsch „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 290 ff.
[2]
Siehe zum Ansatzpunkt Marlies oben Rn. 17 ff.
[3]
Siehe etwa Rotsch „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 198.
[4]
Rotsch „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 280 f.
[5]
Rotsch „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 210; 290 ff.
[6]
Rotsch „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 291.
[7]
Rotsch „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 291.
[8]
Rotsch „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 291.
[9]
Rotsch „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 292.
[10]
Rotsch „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 292.
[11]
Rotsch „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 292 f.
J. Zirkelschluss der Tatherrschaftslehre
28
Des Weiteren wird der Tatherrschaftslehre vorgeworfen, in Bezug auf das tatbestandsmäßige Geschehen an einem unauflöslichen Zirkelschluss zu leiden.[1] Wenn sich die Frage nach Tatherrschaft und damit Täterschaft danach entscheiden solle, wer die zentrale Gestalt des tatbestandsmäßigen Geschehens sei, sei es ausgeschlossen, das Tatherrschaftskriterium bereits für die Frage heranzuziehen, was genau das tatbestandsmäßige Geschehen denn eigentlich sei. Die Tatherrschaftslehre mache die folgenden Kriterien zur Voraussetzung für das tatbestandsmäßige Geschehen: Verursachung des tatbestandsmäßigen Erfolgs, objektive Zurechnung und Tatherrschaft. Vor diesem Hintergrund könne das Kriterium der Tatherrschaft darüber hinaus nicht auch noch darüber entscheiden, wer die zentrale Gestalt dieses tatbestandsmäßigen Geschehens sei, denn die Frage nach Tatherrschaft werde bereits auf der unteren Ebene zur Bestimmung des tatbestandsmäßigen Geschehens herangezogen. Bei einer solchen Vorgehensweise laufe der Begriff der Tatherrschaft daher Gefahr, zur Voraussetzung seiner selbst zu werden.[2] Dieser Zirkelschluss habe zur Folge, dass der Tatherrschaftsbegriff sich nicht zur Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme eigne. Dies ergebe sich zusätzlich aus Folgendem: Wenn Tatherrschaft erst das tatbestandsmäßige Geschehen konstituiere, sei es ausgeschlossen, Teilnehmer als Teil des tatbestandsmäßigen Geschehens anzusehen, denn Teilnehmer hätten eben gerade keine Tatherrschaft. Wenn aber Teilnehmer – was die zwingende Folge wäre – außerhalb des tatbestandsmäßigen Geschehens stünden, könne das tatbestandsmäßige Geschehen für Teilnehmer im Rahmen der Tatherrschaftslehre auch nicht der Bezugsrahmen für ihre Strafbarkeit sein. Zwingende Folge wäre also, dass Täterschaft und Teilnahme einen unterschiedlichen Bezugsrahmen hätten.[3]
Anmerkungen
[1]
Rotsch „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 293 f.
[2]
Rotsch „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 293.
[3]
Rotsch „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 294.
K. Zwischenfazit zur neuesten Kritik an der Tatherrschaftslehre
29
Die weitere Kritik an der Tatherrschaftslehre lässt sich in zwei verschiedene Kategorien unterteilen, denen jedoch derselbe Kern innewohnt. Dadurch, dass für eine Vielzahl von Delikten das tatbestandsrelevante Verhalten nicht hinreichend geklärt sei, sei die Tatherrschaftslehre gezwungen, dieses selbst zu konstituieren. Hierzu sei sie jedoch nicht in der Lage, weil sie zum einen keinen objektiven Bewertungsmaßstab enthalte und weil sie zum zweiten stets in einer relativen Abhängigkeit zum Oberbegriff des tatbestandsmäßigen Erfolges stehe. Darüber hinaus – und dies ist der vordringlichster Einwand – verlange die Tatherrschaftslehre jedoch Unmögliches, wenn sie fordere, dass der Begriff der Tatherrschaft sowohl unrechtskonstituierend (Bestimmung des tatbestandsmäßigen Geschehens) als auch unrechtsbewertend (Bewertung des tatbestandsmäßigen Geschehens) wirken solle.
Sämtliche der vorstehend geschilderten Einwände gegen die Tatherrschaftslehre verdeutlichen, dass die Anwendbarkeit des Tatherrschaftskriteriums auf einen bestimmten Straftatbestand maßgeblich von der Frage abhängt, inwieweit sich für diesen Tatbestand die Tatbestandshandlung konkret definieren lässt. Wenn dies nicht möglich ist und statt auf ein bestimmtes Verhalten allein an die irgendwie geartete Verursachung des tatbestandlichen Erfolges angeknüpft werden kann, gerät die Tatherrschaftslehre in nachhaltige Schwierigkeiten, weil sie für die Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme maßgeblich auf die Vornahme der Tatbestandshandlung abstellt. Wenn die Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme, sowie die dogmatische Herleitung von Täterschaft im Rahmen der Steuerhinterziehung, anhand des Kriteriums der Tatherrschaft geschehen soll, bedarf es einer Klärung der Frage, welches die spezifische Tatbestandshandlung der Steuerhinterziehung gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO ist.
L. Fazit zur neuesten Kritik an der Tatherrschaftslehre
30
Vorstehend wurde eine Reihe von Einwänden gegen die Tatherrschaftslehre vorgestellt, die sich möglicherweise auf den Bereich der Steuerhinterziehung übertragen lassen. Einige dieser Einwände beschäftigen sich mit den dogmatischen Grundlagen, andere mit den praktischen Auswirkungen der Tatherrschaftslehre. Sie alle eint die Auffassung, dass die Tatherrschaftslehre insgesamt nicht geeignet sei, einerseits die einzelnen Varianten von Täterschaft untereinander und andererseits Täterschaft von Teilnahme hinreichend sicher abzugrenzen. Ein Ziel der sich anschließenden Untersuchung von Tatherrschaft im Rahmen der Steuerhinterziehung ist es, diese Kritik aufzugreifen und zum wertenden Korrektiv für die Frage nach der Anwendbarkeit des Kriteriums der Tatherrschaft für die Herleitung von Täterschaft im Rahmen der Steuerhinterziehung zu machen.
Teil 4 Grundsätzliches zur Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme bei der Steuerhinterziehung
31
Um die Probleme bei der Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme im Rahmen der Steuerhinterziehung auf der Grundlage der aktuellen Entwicklungen in der wissenschaftlichen Diskussion bezüglich der Tatherrschaftslehre näher untersuchen zu können, bedarf es zunächst eines Blicks auf den Tatbestand der Steuerhinterziehung. Der Straftatbestand der Steuerhinterziehung ist innerhalb des § 370 AO in sieben Abschnitte eingeteilt. Für die Untersuchung von Tatherrschaft bei der Steuerhinterziehung steht der erste Absatz im Zentrum des Interesses, der normiert, wer sich wegen Steuerhinterziehung strafbar macht. Die nachfolgenden Absätze, die sich unter anderem mit der Strafbarkeit des Versuchs (Abs. 2), der Regelung eines besonders schweren Falles (Abs. 3) und einer Beschreibung des Taterfolges (Abs. 4) auseinandersetzen, sind im Rahmen der vorliegenden Untersuchung dagegen von untergeordneter Bedeutung.
Normative Grundlage für die Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme im Rahmen der Steuerhinterziehung ist § 369 Abs. 2 AO. Danach gelten für Steuerstraftaten die allgemeinen Gesetze über das Strafrecht, soweit die Strafvorschriften der Steuergesetze nichts anderes bestimmen. Im Hinblick auf Täterschaft und Teilnahme gibt es keine speziellen Regelungen in den Strafvorschriften der Steuergesetze, was die Anwendbarkeit des § 25 StGB mitsamt den hierzu vertretenen Täterlehren zur Folge hat. Wie einleitend ausgeführt, wird für die Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme ganz überwiegend „die Tatherrschaftslehre“ zugrunde gelegt.[1] Es findet sich jedoch zumeist keine klare Aussage dazu, welche der verschiedenen denkbaren Formen der Tatherrschaftslehre[2] konkret zur Grundlage gemacht wird.[3] Vor diesem Hintergrund fokussiert sich die nachfolgende Untersuchung von Tatherrschaft im Rahmen der Steuerhinterziehung auf die Tatherrschaftslehre im von Roxin verstandenen Sinne. Bereits in der Einleitung wurde darauf hingewiesen, dass diese Lehre heute wohl als gedanklicher Ausgangspunkt aller Tatherrschaftslehren herangezogen werden kann, was den Ansatz nahe legt, eine Untersuchung von Tatherrschaft im Rahmen der Steuerhinterziehung in erster Linie an diesem Maßstab zu messen. Auf dieser Grundlage soll nachfolgend zunächst untersucht werden, inwieweit die Tatherrschaftslehre im von Roxin verstandenen Sinne überhaupt dem Grunde nach auf die Steuerhinterziehung übertragbar ist. Hintergrund dieser Frage ist der Umstand, dass Roxin das Tatherrschaftskriterium lediglich im Bereich sogenannter „Allgemeindelikte“ für anwendbar hält, wohingegen im Bereich sogenannter „Pflicht-“ und „eigenhändiger“ Delikte die Tatherrschaft nicht das entscheidende Kriterium bei der Bestimmung von Täterschaft sein soll.[4] Vor diesem Hintergrund bedarf es nachfolgend zunächst einer Einordnung des Deliktscharakters der Steuerhinterziehung. Daran anschließend soll der Blick kurz auf die Bestimmung von Täterschaft im Rahmen des § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO gerichtet werden. Sodann geht es um die Frage, zu welchen Ergebnissen die Tatherrschaftslehre im von Roxin verstandenen Sinne im Rahmen der Steuerhinterziehung kommt und zu welchen Schwierigkeiten ihre Anwendung in Bezug auf die Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme führt. Diese Untersuchung wird sich an der von § 25 StGB vorgegebenen Struktur orientieren und demzufolge jeweils gesondert die Anwendbarkeit des Tatherrschaftskriteriums auf die unmittelbare-, die mittelbare- und die Mittäterschaft untersuchen.
Anmerkungen
[1]
Siehe dazu bereits obenRelativität des Rn. 1 ff.
[2]
Siehe bzgl. einer ausführlichen Darstellung verschiedener Tatherrschaftslehren Schild Tatherrschaftslehren, insbesondere S. 33 ff.
[3]
Soweit ersichtlich stellt allein Ransiek Kohlmann Steuerstrafrecht, § 370 AO Rn. 98.1 ausdrücklich auf das von Frister geprägte Kriterium der „Entscheidungsherrschaft“ ab. Siehe dazu Frister Strafrecht Allgemeiner Teil, S. 351 ff.
[4]
Siehe dazu bereits oben Rn. 14 ff.
Teil 5 Der Deliktscharakter des § 370 Abs. 1 AO
Inhaltsverzeichnis
A. § 370 Abs. 1 AO als reines Pflichtdelikt
B. § 370 Abs. 1 AO als reines Allgemeindelikt
C. Stellungnahme
32
Zunächst ist somit der Deliktscharakter des § 370 Abs. 1 AO und damit die Frage von Bedeutung, inwieweit es sich bei § 370 Abs. 1 AO um ein Allgemeindelikt oder ein Pflichtdelikt handelt.
Ausgehend vom Wortlaut des § 370 Abs. 1 AO lässt sich dessen Deliktscharakter dem ersten Anschein nach umstandslos einordnen. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen der Nr. 1 einerseits und den Nrn. 2 und 3 andererseits. Wegen Steuerhinterziehung durch Unterlassen (§ 370 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 AO) macht sich strafbar, wer pflichtwidrig handelt. Die Strafbarkeit wegen Steuerhinterziehung setzt damit in den Unterlassungsvarianten dem Wortlaut nach die Verletzung einer spezifischen Pflicht voraus. Es scheint daher alles dafür zu sprechen, dass § 370 Abs.1 Nr. 2 und Nr. 3 AO als Pflichtdelikte im von Roxin verstandenen Sinne zu kategorisieren sind.[1] Anders verhält sich dies dagegen bei einer Betrachtung des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO. Hier verzichtet der Gesetzgeber dem Wortlaut des Tatbestandes nach auf die Verletzung einer spezifischen Verpflichtung und knüpft stattdessen ganz allgemein an das Tätigen unrichtiger oder unvollständiger Angaben als Tathandlung an. Damit scheint auch der Deliktscharakter des § 370 Abs.1 Nr. 1 AO auf der Hand zu liegen: Dadurch, dass der Gesetzgeber positiv an ein tatbestandsmäßiges Handeln und gerade nicht an ein pflichtwidriges Unterlassen anknüpft, wirkt die Steuerhinterziehung in der Begehungsvariante des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO geradezu als Prototyp eines Herrschaftsdeliktes, das keine spezifische Pflichtverletzung voraussetzt und in dessen Rahmen es zur Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme deshalb auf das Kriterium der Tatherrschaft ankommen müsste. Bei unbefangener Betrachtung des Steuerhinterziehungstatbestandes zeichnet sich demnach insgesamt ein verhältnismäßig eindeutiges Bild von dessen Deliktscharakter. Trotzdem werden gegen die Differenzierung des § 370 Abs. 1 AO in ein Allgemeindelikt (§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO) und zwei Pflichtdelikte (§ 370 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 AO) verschiedene Einwände vorgetragen.