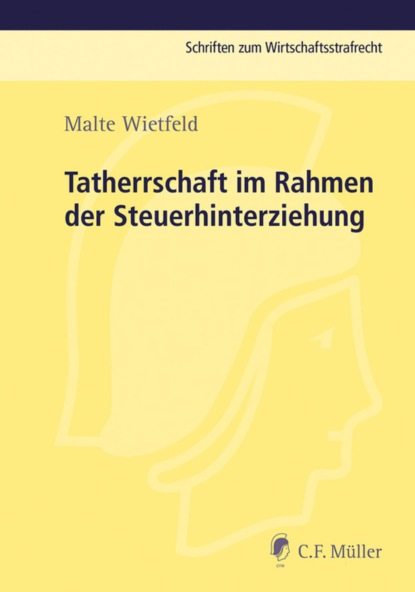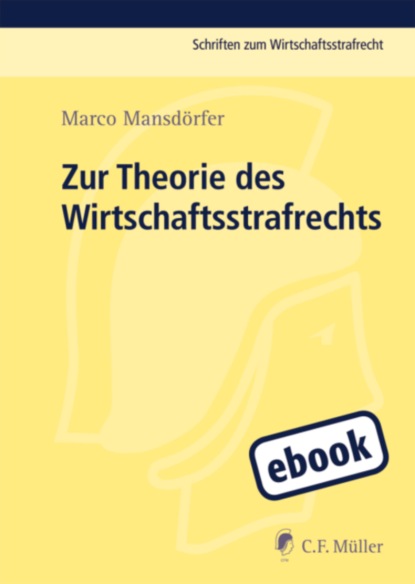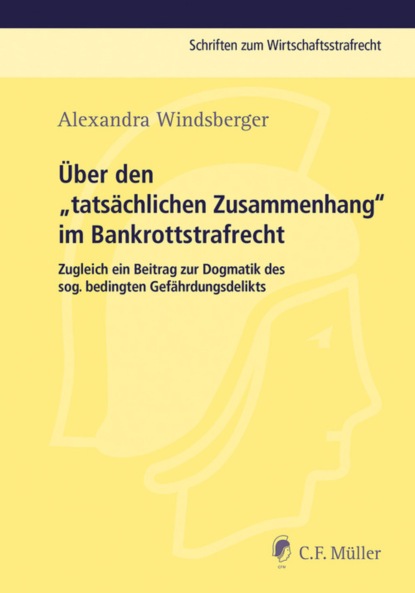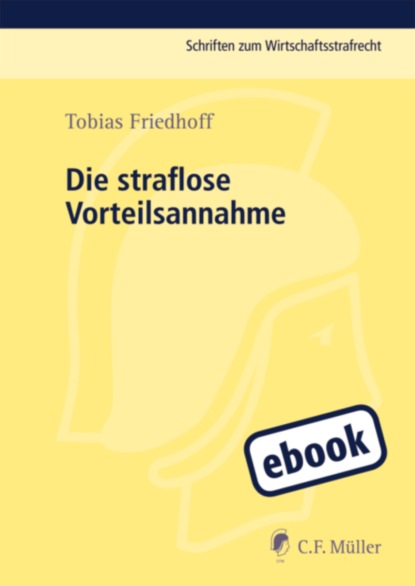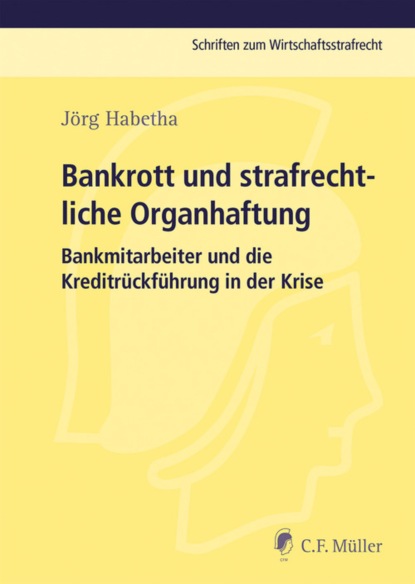- -
- 100%
- +
Anmerkungen
[1]
BGH v. 24.10.2002, 5 StR 600/01, wistra 2003, 100 (102); v. 12.11.1986, 3 StR 405/86, wistra 1987, 147; Ransiek Kohlmann Steuerstrafrecht § 370 AO Rn. 87, 276; MünchKommStGB/Schmitz/Wulf § 370 AO Rn. 282, 351; Seer Steuerrecht, § 23 Rn. 26.
A. § 370 Abs. 1 AO als reines Pflichtdelikt
33
Es gab und gibt bis heute vereinzelte Stimmen, die § 370 Abs. 1 AO als reines Pflichtdelikt interpretieren wollen.[1] Bei unterstellter Richtigkeit dieser Auffassung sowie einer strengen Anwendung der Tatherrschaftslehre im Sinne Roxins wäre das Tatherrschaftskriterium dann nicht das maßgebliche Kriterium, um Täterschaft und Teilnahme im Rahmen der Steuerhinterziehung voneinander abzugrenzen.
Ursprünglich konnte sich diese Auffassung noch auf den Wortlaut des § 392 RAO 1931 stützen, der Steuerstraftaten für eine „Verletzung von Pflichten, die Steuergesetze im Interesse der Besteuerung auferlegen“, hielt.[2] Nach dem ersatzlosen Wegfall des § 392 RAO 1931 im Zuge des 2. AOStrafÄndG wurde diesem Argument jedoch die Grundlage entzogen.[3]
Heute wird der Versuch unternommen, diesen Ansatz auf ein neues Fundament zu stellen. Hierzu wird die Auffassung vertreten, dass das tatbestandliche Unrecht des § 370 Abs. 1 AO insgesamt in der Verletzung einer steuerlichen Mitwirkungspflicht gesehen werden und daher § 370 Abs. 1 AO vollständig als Pflichtdelikt interpretiert werden müsse.[4] Gedanklicher Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist, dass es im Rahmen der Abgrenzung zwischen einer Steuerhinterziehung durch aktives Tun und einer Steuerhinterziehung durch Unterlassen zu – zum Teil unüberbrückbaren – Abgrenzungsschwierigkeiten komme. Diese könnten nur dann vermieden werden, wenn § 370 Abs. 1 AO einheitlich als Pflichtdelikt interpretiert werde.[5]
Die Steuerhinterziehung stelle in ihrem eigentlichen Kern ein Unterlassungsdelikt dar. Grund hierfür sei, dass der Fiskus in aller Regel keine eigene Kenntnis von dem ihm zustehenden Steueranspruch habe, sondern für dessen Ermittlung auf die Mitwirkung der Steuerpflichtigen durch Abgabe ihrer steuerrelevanten Daten angewiesen sei. Hieraus ergebe sich eine echte Mitwirkungspflicht. Werde diese verletzt, liege eine Steuerhinterziehung durch Unterlassen vor.[6] Nur in Ausnahmefällen sei von einer Steuerhinterziehung durch aktives Handeln auszugehen. Dies sei nur dann der Fall, wenn der Fiskus ausnahmsweise selbst – ohne auf Mitwirkungspflichten angewiesen zu sein – Kenntnis von seinem Steueranspruch habe.[7] Dies wiederum sei dann der Fall, wenn der Fiskus selbst über die notwendigen Informationen zur Steuerfestsetzung verfüge. Steuerhinterziehung durch aktives Tun stelle sich in diesen seltenen Fällen als „Abbruch eines rettenden Kausalverlaufes“ dar, weil der Fiskus ohne das nachträgliche aktive Eingreifen durch das Tätigen falscher Angaben seinen berechtigten Steueranspruch hätte durchsetzen können.[8] Tatgerichte hätten also bisweilen die schwierige Aufgabe, zwischen aktivem Handeln und Unterlassen zu unterscheiden. Hierbei ergäben sich jedoch erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht. In objektiver Hinsicht sei beispielsweise in vielen Fällen problematisch, dass die Strafgerichte im Zeitpunkt der Hauptverhandlung – „also regelmäßig Jahre nach Abgabe der unrichtigen Erklärung“[9]- noch festzustellen hätten, ob der Fiskus ohne die unrichtigen Angaben zu einer zutreffenden Steuerfestsetzung gekommen wäre und damit ein rettender Kausalverlauf vorgelegen habe, der erst durch die falschen Angaben abgebrochen worden sei. Eine solche Feststellung sei aufgrund des regelmäßig hohen Zeitablaufs in der überwiegenden Zahl der Fälle jedoch nicht mehr mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit zu treffen.[10] Schwierigkeiten ergäben sich darüber hinaus aber auch bei der Feststellung des subjektiven Tatbestandes. Hier sei es zumeist schwierig, dem Angeklagten im Prozess nachzuweisen, dass der rettende Kausalverlauf, also die Tatsache, dass die Finanzbehörde zu einer zutreffenden Steuerfestsetzung gekommen wäre, wenn er keine falschen Angaben gemacht hätte, von seinem Vorsatz umfasst war. Dies sei vor allem deshalb problematisch, weil es sich bei der Steuerfestsetzung regelmäßig um einen internen Behördenvorgang handele, von dem der Angeklagte im Normalfall keinerlei Kenntnis haben könne. Ohne genaue Kenntnis von einem Umstand sei es jedoch nur schwer möglich, Vorsatz auf genau diesen Umstand zu haben, beziehungsweise für die Gerichte, diesen Vorsatz hinreichend sicher nachzuweisen.[11] Hieran verdeutlichten sich die Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen aktivem Tun und pflichtwidrigem Unterlassen im Bereich der Steuerhinterziehung.
In Anbetracht der Tatsache, dass § 370 Abs. 1 AO im Hinblick auf seinen persönlichen Anwendungsbereich so interpretiert werden müsse, dass eine Steuerhinterziehung durch Unterlassen nicht von jedermann, sondern nur von im konkreten Fall Erklärungspflichtigen begangen werden könne, komme der Abgrenzung zwischen aktivem Tun und Unterlassen jedoch ein extrem hoher Stellenwert zu. Dieser Stellenwert führe dazu, dass die skizzierten Abgrenzungsschwierigkeiten nicht hinnehmbar seien.[12] Denn, wenn sich nicht mit der für eine Verurteilung notwendigen Sicherheit feststellen lasse, ob ein Handeln oder ein Unterlassen vorgelegen habe, müsse eine Person, die nicht unter den persönlichen Anwendungsbereich des § 370 Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 3 AO falle, im Zweifel freigesprochen werden, weil in diesen Fällen eben nicht ausgeschlossen werden könne, dass nur ein Unterlassen vorlag.[13]
Derart unbefriedigende Ergebnisse ließen sich vermeiden, wenn der Unterscheidung zwischen Handeln und Unterlassen keine entscheidende Bedeutung bei der Bestimmung von Täterschaft zugemessen werden müsste. Dies sei aber nur dann möglich, wenn § 370 Abs. 1 AO insgesamt als Pflichtdelikt interpretiert werden könne, denn im Rahmen von Pflichtdelikten sei die konkrete Verhaltensform für die Bestimmung der Strafbarkeit weitgehend unerheblich. Das Verhaltensunrecht dieser Delikte bestehe nämlich allein in der Verletzung der konkreten Verpflichtung, wobei es nicht darauf ankomme, ob diese Pflicht durch aktives Tun oder durch Unterlassen verletzt werde.[14]
Werden somit die Motive für die Auffassung, die Steuerhinterziehung müsse insgesamt als Pflichtdelikt interpretiert werden deutlich, stellt sich die weitergehende Frage, auf welche dogmatische Grundlage diese Interpretation gestützt werden kann. In der steuerlichen Mitwirkungspflicht wird ein besonderes persönliches Merkmal im Sinne des § 28 StGB gesehen, das nicht auf § 370 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 AO beschränkt sei, sondern zusätzlich für § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO gelte und damit auch diesen Tatbestand einer Interpretation als Pflichtdelikt zugänglich mache.[15] Hier bestehen Parallelen zu der Pflichtdeliktslehre Roxins. Dieser knüpfe die Interpretation eines Straftatbestandes als Pflichtdelikt an bestimmte Voraussetzungen, wobei eine Analyse des § 370 Abs. 1 AO zeige, dass dieser Tatbestand sämtliche der von Roxin für ein Pflichtdelikt aufgestellten Voraussetzungen erfülle. Nach dem Verständnis Roxins sei konstituierende Voraussetzung von Pflichtdelikten, dass eine Person gegen ihr obliegende Leistungsanforderungen einer bestimmten sozialen Rolle verstoße, und dieser Verstoß die Funktionsfähigkeit eines bestimmten Lebensbereiches gefährdet habe.[16] Dieses Bild entspreche exakt dem abstrakten Regelungsgehalt des § 370 Abs. 1 AO. Außerstrafrechtliche, steuerliche Mitwirkungspflichten würden jedermann eine bestimmte soziale Rolle zuschreiben. Bei einem Verstoß gegen diese Pflichten komme es zu einer Verletzung der dem Verpflichteten zugeschriebenen sozialen Rolle. Hierdurch gefährde er das Steuersystem als geschützten Lebensbereich. Eine derartige Interpretation gelte insbesondere auch für den Tatbestand des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO, was dazu führe, dass § 370 Abs. 1 AO insgesamt als Pflichtdelikt interpretiert werden müsse.[17]
Neben den vorstehend geschilderten Überlegungen lassen auch systematische Überlegungen Raum für Spekulationen, ob nicht § 370 Abs. 1 AO insgesamt als Pflichtdelikt interpretiert werden müsste.[18] Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist ein Vergleich des § 370 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 AO mit § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO. Nach der zweiten Alternative der Nr. 1 des § 370 Abs. 1 AO macht sich wegen Steuerhinterziehung strafbar, wer über steuerlich erhebliche Tatsachen unvollständige Angaben macht. Nun sei zu überlegen, ob nicht das aktive Tätigen unvollständiger Angaben gleichsam als Kehrseite immer auch das Unterlassen vollständiger Angaben beinhalte.[19] Interpretiere man demgemäß § 370 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 AO als Unterlassungsdelikt, müsse auch die besondere Pflicht aus Nr. 2 und Nr. 3 hierher übertragen werden, weil ein strafrechtlicher Unterlassungsvorwurf nur dann gerechtfertigt sei, wenn den Unterlassenden korrespondierend eine Handlungspflicht treffe. Wenn als Folge derartiger Überlegungen neben § 370 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 AO auch § 370 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 AO als Pflichtdelikt zu interpretieren sei, könne dieser Umstand als systematisches Argument erwogen werden, auch § 370 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 AO und damit § 370 Abs. 1 AO insgesamt als Pflichtdelikt zu charakterisieren.[20]
Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass mit dem Vorstehenden zwei denkbare Argumentationsmuster dargetan sind, auf deren Grundlage § 370 Abs. 1 AO – entgegen seines scheinbar eindeutigen Wortlauts – insgesamt als Pflichtdelikt interpretiert werden könnte, was zu einer Unanwendbarkeit der Tatherrschaftslehre im von Roxin verstandenen Sinne führen würde.
Anmerkungen
[1]
Siehe in der Vergangenheit etwa Buschmann NJW 1968, 1613 (1614); Leise ZfZ 1965, 193 (198); Schulze DStR 1964, 416 (422) sowie heute Wulf Handeln und Unterlassen im Steuerstrafrecht, S. 212 ff.
[2]
Bender wistra 2004, 368 (371).
[3]
Joecks F/G/J Steuerstrafrecht, § 370 Rn. 18.
[4]
Siehe etwa Wulf Handeln und Unterlassen im Steuerstrafrecht, S. 217 f., 220 ff., 267; MünchKommStGB/Schmitz/Wulf § 370 AO Rn. 280, 384.
[5]
MünchKommStGB/Schmitz/Wulf § 370 AO Rn. 280.
[6]
MünchKommStGB/Schmitz/Wulf § 370 AO Rn. 283.
[7]
MünchKommStGB/Schmitz/Wulf § 370 AO Rn. 283.
[8]
Wulf Handeln und Unterlassen im Steuerstrafrecht, S. 196.
[9]
Wulf Handeln und Unterlassen im Steuerstrafrecht, S. 198.
[10]
Wulf Handeln und Unterlassen im Steuerstrafrecht, S. 198.
[11]
Wulf Handeln und Unterlassen im Steuerstrafrecht, S. 201.
[12]
Siehe bspw. Wulf Handeln und Unterlassen im Steuerstrafrecht, S. 267.
[13]
Wulf Handeln und Unterlassen im Steuerstrafrecht, S. 201.
[14]
Wulf Handeln und Unterlassen im Steuerstrafrecht, S. 210.
[15]
Wulf Handeln und Unterlassen im Steuerstrafrecht, S. 233, 238 ff.
[16]
Wulf Handeln und Unterlassen im Steuerstrafrecht, S. 221 f.
[17]
Wulf Handeln und Unterlassen im Steuerstrafrecht, S. 222.
[18]
Ransiek Kohlmann Steuerstrafrecht, § 370 AO Rn. 90.
[19]
In diesem Sinne auch Hellmann in HHSp., § 370 AO Rn. 69; MünchKommStGB/Schmitz/Wulf § 370 AO Rn. 225.
[20]
Ransiek Kohlmann Steuerstrafrecht, § 370 AO Rn. 90; der eine solche Interpretation zwar für denkbar, im Ergebnis jedoch nicht für überzeugend hält.
B. § 370 Abs. 1 AO als reines Allgemeindelikt
34
Im genauen Gegenteil dazu existiert eine andere Auffassung, die § 370 Abs. 1 AO insgesamt als Allgemeindelikt interpretiert.[1]
Bei unterstellter Richtigkeit dieser Auffassung könnte der Tatherrschaftsgedanke zur Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme auf sämtliche Varianten von § 370 Abs. 1 AO angewendet werden, ohne dass es zuvor einer Klärung der Frage bedürfte, ob die Tatherrschaftslehre – entgegen der Beteuerung Roxins – nicht unter Umständen doch auch auf solche Delikte angewendet werden kann oder muss, die das tatbestandliche Unrecht von der Verletzung einer bestimmten Pflicht abhängig machen.[2]
Wie bereits die zuvor dargestellte Auffassung zur Interpretation des § 370 Abs. 1 AO leiten auch die Vertreter dieser Auffassung ihre Thesen aus einer bestimmten praktischen Problematik der Anwendung des § 370 Abs. 1 AO her. War dies bei der zuvor geschilderten Auffassung noch die Schwierigkeit in der Praxis aktives Tun von Unterlassen abzugrenzen, geht es hier um die Schwierigkeit in Fällen des § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO Hintermänner strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Dies zeige sich vor allem in Fällen des Zollschmuggels.[3] Hier könnten oftmals nur die Transportpersonen, denen jedoch nur eine untergeordnete Rolle in der kriminellen Organisation zukomme, strafrechtlich belangt werden. Grund hierfür sei, dass nur diese eine Gestellungspflicht im Sinne des § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO treffe[4] und sich deshalb bei einem pflichtwidrigen Unterlassen der Gestellung auch nur diese nach § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO strafbar machen könnten. Straffrei blieben dagegen regelmäßig die nicht gestellungspflichtigen Hintermänner des Schmuggels, denen im Rahmen der Organisation in der Regel aber eine Hauptrolle zukomme. Dies sei ein unbefriedigendes Ergebnis.[5]
Hauptargument für eine mögliche Interpretation des § 370 Abs. 1 AO als reines Allgemeindelikt sei in erster Linie eine grammatikalische Auslegung des Tatbestandes. Eine solche zeige, dass der Gesetzgeber den persönlichen Anwendungsbereich des § 370 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 AO nicht auf speziell Verpflichtete habe beschränken wollen. Maßgeblich für die Bestimmung des persönlichen Anwendungsbereiches sei nämlich nicht die adverbiale Bestimmung „pflichtwidrig“, sondern das Indefinitpronomen „wer“, welches sich auf den gesamten Tatbestand des § 370 Abs. 1 AO beziehe. Die adverbiale Bestimmung „pflichtwidrig“ beschreibe dagegen lediglich die Art und Weise eines Verhaltens, begründe aber gerade keine „Pflichtenstellung mit einem persönlichen Einschlag“.[6]
Zusätzlich zu diesem grammatikalischen Argument deute darüber hinaus die Rechtsprechung des BGH auf eine Interpretation des § 370 Abs. 1 AO als reines Allgemeindelikt hin.[7] Der BGH hatte über die Frage zu entscheiden, ob es sich bei der in § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO genannten Pflicht um ein besonderes persönliches Merkmal im Sinne des § 28 StGB handele.[8] Hintergrund der dieser Entscheidung zugrunde liegenden Revision war eine erstrebte Strafmilderung des Angeklagten, die dieser auf § 28 StGB stützen wollte. Der BGH verwehrte dem Revisionsführer diese Strafmilderung jedoch unter Hinweis darauf, dass er zwischen täterbezogenen persönlichen Merkmalen – auf die § 28 Abs. 1 StGB anwendbar sei – und tatbezogenen Merkmalen – auf die § 28 Abs. 1 StGB nicht anwendbar sei – unterscheide.[9] Bei der in § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO genannten Pflicht handele es sich lediglich um ein tatbezogenes Merkmal, weshalb § 28 Abs. 1 StGB keine Anwendung finde. Dies sei daran zu erkennen, dass die von § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO gemeinten Pflichten aus gesetzlichen Regelungen wie beispielsweise der Auskunftspflicht nach § 93 AO folgten und damit an „objektive Vorgänge des täglichen Lebens“ [10] anknüpften. Hierin sei keine täterbezogene, sondern eine reine tatbezogene Pflicht zu sehen.[11]
Aus dieser Argumentation folge im Umkehrschluss, dass auch der BGH der Auffassung zuneige, § 370 Abs. 1 AO sei insgesamt als Allgemeindelikt zu interpretieren.[12] Denn wenn die aus § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO folgende Verpflichtung für den BGH keine besondere persönliche Pflicht im Sinne des § 28 StGB darstelle, hieße das zwingend, dass er diese Vorschrift insgesamt nicht als Pflichtdelikt interpretiert wissen wolle. Dies wiederum könne im Umkehrschluss nur bedeuten, dass der BGH die Vorschrift insgesamt als Allgemeindelikt einordne.[13]
Anmerkungen
[1]
Bender wistra 2001, 161 (165); ders. ZfZ 2003, 255 (256 f.); ders. wistra 2004, 368 (371); Kuhlen FS Jung, S. 445 (455 ff.); in diese Richtung auch Jäger F/G/J Steuerstrafrecht, § 370 Rn. 224c.
[2]
Siehe hierzu in Ansätzen bereits Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 54 f.
[3]
Siehe etwa Bender wistra 2004, 368 ff.
[4]
Aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union entfallen die Probleme der täterschaftlichen Erfassung von Hintermännern beim Schmuggel heute indes. Grund hierfür ist, dass Art. 139 Abs. 1 UZK die Gestellungspflicht auch auf Personen, in deren Namen oder in deren Auftrag die Person handelt, die die Waren in das Gebiet verbracht hat sowie auf Personen ausweitet, die die Verantwortung für die Beförderung der Waren nach dem Verbringen in das Zollgebiet der Union übernommen haben.
[5]
Siehe nur Bender wistra 2004, 368.
[6]
Bender wistra 2004, 368 (371); Jäger F/G/J Steuerstrafrecht, § 370 Rn. 224 c; Kuhlen FS Jung, S. 445 (457 f.).
[7]
Kuhlen FS Jung, S. 445 (458).
[8]
BGH v. 25.1.1995 5 StR 491/94, BGHSt 41, 1 ff.
[9]
BGH v. 25.1.1995 5 StR 491/94, BGHSt 41, 1 f.
[10]
BGH v. 25.1.1995 5 StR 491/94, BGHSt 41, 1 (4).
[11]
BGH v. 25.1.1995 5 StR 491/94, BGHSt 41, 1 (4).
[12]
Kuhlen FS Jung, S. 445 (458).
[13]
Kuhlen FS Jung, S. 445 (458).
C. Stellungnahme
35
Beide zuvor geschilderten Ansichten weisen zu Recht auf Missstände in der Struktur des § 370 Abs. 1 AO hin. Bestehende Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den einzelnen Verhaltensformen werden ebenso überzeugend dargestellt wie der Umstand, dass der Pflichtwidrigkeitscharakter der Unterlassungstatbestände des § 370 Abs. 1 AO die strafrechtliche Verfolgung von Hintermännern, speziell im Bereich des Zollschmuggels, erschwert.[1] Bei dem nachvollziehbaren Versuch einer Auflösung dieser Schwierigkeiten darf jedoch der Umstand, dass der Tatbestand des § 370 Abs. 1 AO sehr klar formuliert ist, nicht allzu weit in den Hintergrund treten.[2] In Anbetracht dieser klaren Formulierung überdehnen beide Ansichten, die für eine einheitliche Interpretation des Deliktscharakters des § 370 Abs. 1 AO, entweder als reines Pflicht- oder als reines Herrschaftsdelikt, eintreten, die Grenze des Wortlautes der Vorschrift.
Anmerkungen
[1]
Siehe jedoch oben 4. Fn zu Rn. 34.
[2]
So im Ergebnis zuletzt auch BGH v. 9.4.2013 1 StR 586/12, DStR 2013, 1177 (1181).
Teil 5 Der Deliktscharakter des § 370 Abs. 1 AO › C. Stellungnahme › I. Interpretation als reines Pflichtdelikt
I. Interpretation als reines Pflichtdelikt
36
Im Ergebnis vermag zunächst die Auffassung, § 370 Abs. 1 AO könne als reines Pflichtdelikt interpretiert werden, nicht zu überzeugen. Der gesetzgeberische Wille, nur im Unterlassungsbereich auf Pflichtwidrigkeit abstellen zu wollen, wird durch den Wortlaut der Vorschrift eindeutig dokumentiert. Für die Annahme, auch § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO wolle die Verletzung einer außerstrafrechtlichen, dem allgemeinen Steuerrecht entspringende, Verhaltenspflicht sanktionieren, findet sich dagegen keinerlei Andeutung im Wortlaut der Vorschrift. Hinzu kommt Folgendes: Im Rahmen dieser These wird ausgeführt, dass es einer wertenden Korrektur der herkömmlichen Tatbestandsinterpretation bedürfe, um Schwierigkeiten in der Abgrenzung von Handeln und Unterlassen zu umgehen.[1] Hierbei wird aber offensichtlich nicht beachtet, dass eine derart wertende Korrektur zwingend auch zu Verschiebungen im Bereich potentieller Tathandlungen führen würde. Im Rahmen von Pflichtdelikten werden weniger hohe Anforderungen an die Qualität der Tathandlung gestellt als dies im Bereich der Herrschaftsdelikte der Fall ist.[2] Dies ist eine logische Folge aus dem Umstand, dass bei Pflichtdelikten weniger die konkrete Handlung als mehr die Verletzung einer spezifischen Pflicht im Fokus steht. Die Haftung des Verpflichteten ist daher derjenigen eines Garanten angenähert.[3] Bei einer Interpretation der Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO als Pflichtdelikt, besteht die Gefahr, dass eine Person in den Fokus der Ermittlungsbehörden rückt, der zwar keine konkrete Tathandlung im Sinne des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO, wohl aber eine Pflichtverletzung vorgeworfen werden kann. Da nur § 370 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 AO ausdrücklich eine Pflichtverletzung genügen lassen, muss an das Verhalten, welches den objektiven Tatbestand des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO verwirklicht, im Gegensatz dazu ein erhöhter Maßstab angelegt werden. Die bloße Verletzung einer Pflicht darf gerade nicht ausreichen, um den Tatbestand zu erfüllen. Ohne eine entsprechende Änderung des Wortlautes von § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO würde eine Anwendung des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO bei bloßer Verletzung einer spezifischen Pflicht daher gegen den Grundsatz „nullum crimen sine lege“ aus Art. 103 Abs. 2 GG verstoßen.
Auch die systematischen Überlegungen, die scheinbar für eine Interpretation des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO als Pflichtdelikt sprechen, greifen im Ergebnis nicht durch. Das Tätigen unvollständiger Angaben im Sinne des § 370 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 AO ist im Ergebnis nicht mit dem Unterlassen steuerlicher Angaben im Sinne von § 370 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 AO vergleichbar.[4] Unvollständige Angaben im Sinne der Nr. 1 kann jedermann tätigen, der überhaupt steuerlich erhebliche Angaben macht. Auf eine spezielle steuerliche Erklärungspflicht kommt es hierbei nicht an. Demgemäß ist es zwar zutreffend, dass einer Person, die spezielle steuerliche Erklärungspflichten im Sinne von § 370 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 AO treffen, beim Tätigen unvollständiger Angaben im Rahmen von Nr. 2 und Nr. 3 gleichzeitig der Vorwurf gemacht werden kann, keine vollständigen Angaben im Sinne der Nr. 1 getätigt zu haben. Auf diese Personen beschränkt sich diese Möglichkeit aber nicht. Derselbe Vorwurf kann daneben auch noch an Personen gerichtet werden, die keine Erklärungspflichten nach Nr. 2 und Nr. 3 treffen. Dies erweitert den persönlichen Anwendungsbereich des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO über die Fälle der Nr. 2 und Nr. 3 hinaus und macht deutlich, dass auch nicht persönlich verpflichtete Personen in der Lage sind, einen derartigen Tatverlauf zu beherrschen.[5] Würden solche Personen nicht von dem Anwendungsbereich des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO erfasst, hätte dies vermeidbare Strafbarkeitslücken zur Folge.[6] Wollte man § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO als Pflichtdelikt begreifen, könnte sich hiernach jedoch konsequenterweise nur ein persönlich Verpflichteter strafbar machen.
Insgesamt kann der Auffassung, § 370 Abs. 1 AO sei vollständig als Pflichtdelikt zu interpretieren, deshalb nicht gefolgt werden.
Anmerkungen
[1]
Wulf Handeln und Unterlassen im Steuerstrafrecht, S. 210 f.
[2]
In diese Richtung Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 55.
[3]
In diese Richtung Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 55.
[4]
Ransiek Kohlmann Steuerstrafrecht, § 370 AO Rn. 91.