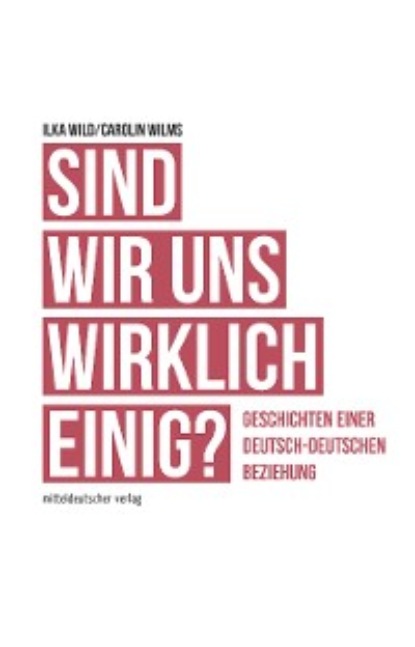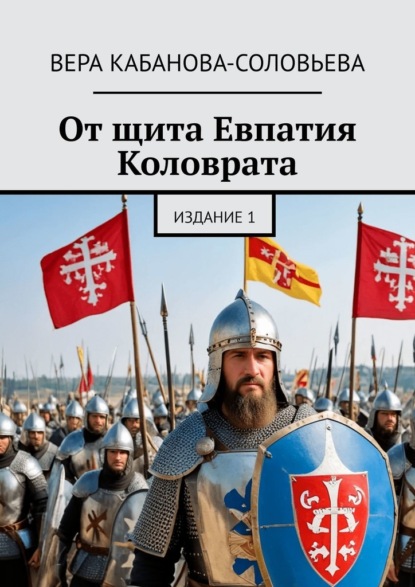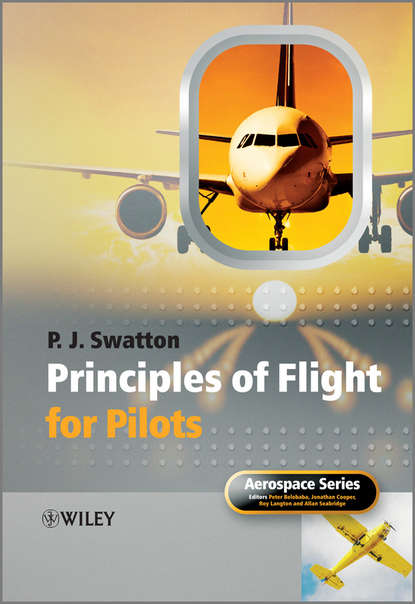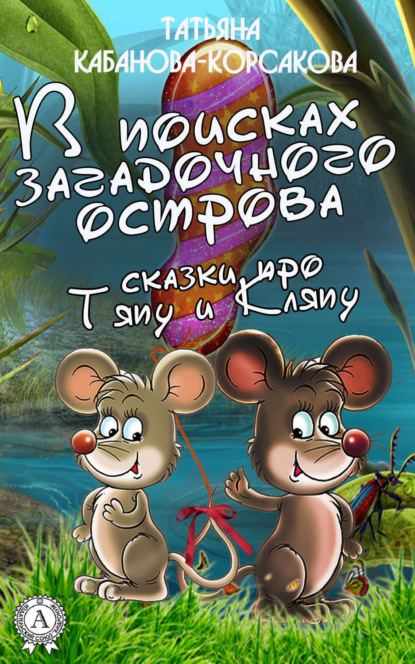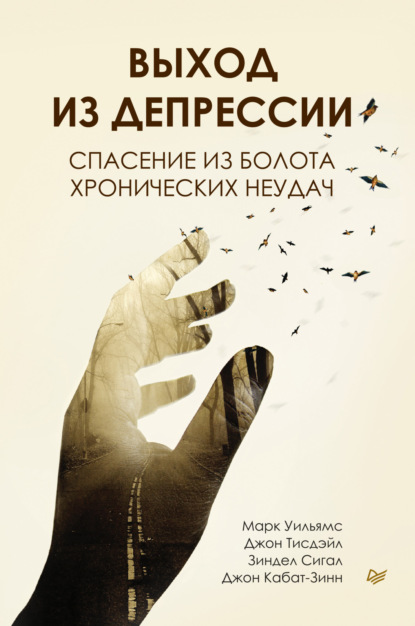- -
- 100%
- +
Doch die allermeisten haben den Systemwechsel genutzt, das Beste daraus gemacht und sich eine neue Existenz aufgebaut. Zwar ist vieles im Osten noch nicht mit dem Westen vergleichbar, das Lohnniveau hinkt noch immer hinterher und die Vermögen und Bankguthaben sind deutlich kleiner. Doch in der DDR wäre der Wohlstand immer sehr viel kleiner gewesen. Das sieht man daran, wie bescheiden der Luxus selbst in der Wandlitz- Siedlung war – die SED-Führung lebte auf dem miefigen Niveau der westdeutschen Mittelklasse.
So gibt es heute einige Ostdeutsche, die finanziell sehr erfolgreich sind und viele, die ein gutes oder mittleres Einkommen haben.
Trotzdem höre ich immer wieder eine gewisse Unzufriedenheit über die Situation im vereinigten Deutschland, selbst bei erfolgreichen Ostdeutschen wie Beamten, Ärzten, Unternehmern: Viele stimmen in einen fast larmoyanten Kanon ein. Sie empfinden, dass ihre Lebensleistung in der ehemaligen DDR nicht wertgeschätzt wird und über die DDR nur abfällig gesprochen wird. Dass Ost-Themen immer nur angesprochen werden, wenn es um rechtsradikale Auswüchse geht oder um sonstige Klischees, die man dem Osten so schön zuordnen kann. So mancher denkt manchmal wehmütig zurück an die späten 1980er Jahre, an die belebten Städte und die vielen jungen Menschen dort. Heute sind zahlreiche Regionen des Ostens überaltert, oft ist die Bevölkerung um 20 Prozent und mehr geschrumpft, weil die Jungen keine Perspektive in Gera, Rostock oder Finsterwalde sahen. Viele Ostdeutsche fragen sich, wer die Schuld dafür trägt, dass es nicht geklappt hat mit den „blühenden Landschaften“. Vielen fällt in diesem Zusammenhang nur die Treuhand ein.
Wie meine Co-Autorin Carolin Wilms sehe ich eine von einigen Ostdeutschen, oft aus dem linken Lager, geforderte Wahrheitskommission, die die Aktivitäten der Treuhand ‚aufarbeiten‘ soll, sehr kritisch. Ich bin nicht davon überzeugt, dass diese Kommission einen großen Beitrag zur Zufriedenheit der Ostdeutschen mit ihrer Rolle im vereinigten Deutschland leisten kann, auch wenn ich mir wünschen würde, dass es so einfach wäre. Klar, Ungerechtigkeit sollte offen angesprochen werden. Doch ich denke, damit müsste man ganz woanders anfangen, denn das Problem scheint deutlich komplexer zu sein und die Treuhand ist nicht der Schlüssel allen Übels.
Das erste Übel war, dass die DDR-Bürger 40 Jahre lang in einer sozialistischen Diktatur gelebt haben, mit allem was dazu gehört: Überwachung im Großen und Kleinen, Indoktrination, Willkür, Bedrohung der eigenen Person oder von Nahestehenden, Bevormundung. Das Schlimme war: Die meisten hatten sich irgendwann daran gewöhnt. Wie sich die meisten im Dritten Reich an die Schrecken der Nazi-Diktatur gewöhnt hatten. Man hat sich darin eingerichtet, man ist mit dem Strom geschwommen. Die Alltäglichkeit der Erniedrigung konnten die Menschen kaum anders ertragen, als sich damit zu arrangieren. Joachim Gauck hat in einem Fernseh-Porträt von einer „Erziehung der Gefühle“ gesprochen, als er einen seiner Söhne am Bahnhof gen Westen verabschiedete, da dessen Ausreiseantrag genehmigt worden war. Jeder in der DDR wusste, was das bedeuten konnte: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Familie für Jahre, Jahrzehnte getrennt war, war äußerst hoch. Und trotzdem verabschiedeten sie sich kühl und gefasst, nicht tränenreich und verzweifelt, wie es eigentlich einer solchen Trennung entsprochen hätte. Erziehung der Gefühle. So etwas bringt nun mal eine Diktatur hervor, genauso wie ein großes Maß an Unmenschlichkeit und Kälte.
Mir fehlt in der derzeitigen Diskussion, dass man sich diese Dinge noch einmal vor Augen hält, dass man sie klar benennt. Denn nur so werden, nach meinem Empfinden, die Vorgänge im Osten verständlich. Spreche ich Ostdeutsche, die heute im Rentenalter sind, darauf an, spüre ich ein gewisses Widerstreben, darüber zu reden. Diese Generation hat einen großen Teil ihres Berufslebens in der DDR verlebt. „Es war halt so“, höre ich oft, mal resignierend, mal trotzig. Manchmal spüre ich sogar einen gewissen Stolz: Wir haben es durch diese Zeit geschafft, mit Mut, mit möglichst viel Rückgrat, manchmal mit Härte. Erziehung der Gefühle.
Ich glaube, es bringt nichts, sich nur an den Westdeutschen abzuarbeiten. Es ist unbestritten, dass es in der Wendezeit und danach Konflikte mit Wessis gab, dass man sich, oft berechtigt, aber oft auch unberechtigt, von ihnen ungerecht behandelt fühlte und eine Besatzer-Mentalität gespürt hat. Es ist vielleicht einfacher, da es ein klar zuzuordnendes Feindbild gibt: die, die aus dem Westen kamen. Es lenkt auch wunderbar davon ab, dass wir uns in vieler Beziehung wichtigen Problemen noch immer nicht ausreichend gestellt haben, wie der Aufarbeitung unserer DDR-Diktatur und der Unmenschlichkeiten, die tagtäglich von unseren Mit-Ossis an uns begangen wurden.
Es ist an der Zeit, sich das einmal bewusst zu machen und die alltägliche Menschenfeindlichkeit offen anzusprechen, die in der DDR herrschte. Es ist eben nicht normal, sich gegenseitig auszuspionieren. Dass wir in der DDR nicht sagen durften, was wir gerade lesen. Dass die Kinder im Kindergarten gefragt wurden, wie denn die „Eins“ im Ersten Programm bei den Nachrichten im Fernsehen aussieht, um festzustellen, ob die Familie zu Hause Westfernsehen schaute. Dass es ein Problem war, wenn man konfessionell gebunden war oder auch sonst von der sozialistischen Gesellschaftsnorm abwich. Denn das ist, meiner Meinung nach, einer der Schlüssel für die Schieflage, die heute im Osten noch herrscht. Man kann bis heute dem kalten Hauch der Diktatur im Osten noch immer ein bisschen nachspüren. Auf Ämtern, in Schulen, in der Verwaltung, in Krankenhäusern. Immer dort, wo Menschen eine gewisse Machtposition über andere haben, findet man noch viel zu häufig Verhaltensweisen vor, die an die ehemalige DDR erinnern. Der Ton dem Bürger, dem Patienten, auch manchmal dem Kunden gegenüber ist oft äußerst rau, egal, ob derjenige vor dem Tresen aus dem Osten oder aus dem Westen kommt. Wenn bis heute darüber hinweggesehen wird, wenn wir uns dagegen nicht erwehren, wenn wir nicht klar machen, dass wir solche Verhaltensweisen nicht tolerieren, wird das Missempfinden im Osten bleiben. Das setzt aber auch voraus, dass man noch einmal deutlich macht, dass das systematische Kleinmachen der Bürger in der DDR Unrecht war und kein zu tolerierendes Verhalten. Ich konnte es vor ein paar Jahren kaum glauben, dass zwei demokratische Parteien im Rahmen von Koalitionsverhandlungen nach einer Landtagswahl ernsthaft darüber stritten, ob die DDR ein Unrechtsstaat gewesen sei oder nicht, und damit erniedrigendem Verhalten gegenüber Mitbürgern Vorschub leisteten. Eine Mentalität des „Das war nun mal so, so macht man das eben“ auch auf dieser Ebene wird das Miteinander unter den Menschen im Osten des Landes nicht verbessern. Aber das Aufstehen gegen eine solche Mentalität muss aus den Reihen der Ostdeutschen kommen, das können die Westdeutschen nicht für uns tun. Vielleicht braucht es eine wirkliche ostdeutsche „#Me-Too“-Bewegung.
Wind of Change
Von Ilka Wild und Carolin Wilms
Ilka Wild
Ich bin kein Fan der Scorpions, aber es gibt einen Song, der die Stimmung in der DDR im Jahre 1989 beschreibt wie kein anderer: ‚Wind of Change‘.
Schon im Jahr 1988 begann es. Es war etwas im Gange. Man spürte es in der Schule, auf Familienfeiern oder sogar im Zugabteil. Man sprach über Verbotenes, man diskutierte Missstände, es brannte den Leuten unter den Nägeln. Manchmal brach es aus ihnen heraus, und man merkte, dass sie erst später darüber nachdachten. Dann blickte man sich verstohlen an, verschwörerisch. Besonders, wenn das Gespräch mit wildfremden Leuten aufkam, war es nicht ungefährlich. Doch anders als in den Jahren zuvor hatten viele Menschen ihre Angst abgelegt oder waren zumindest weniger vorsichtig. Natürlich hatte das Ganze mit den Vorgängen in der Sowjetunion zu tun: Gorbatschow hatte bereits Mitte der 1980er Jahre mit seiner Perestroika Politik begonnen. Und auch das konnte man in der DDR spüren. Über das Westfernsehen erfuhren wir von Sacharows Rehabilitation und konnten das kaum glauben. Und auch das gesellschaftspolitische Magazin Sputnik aus der UdSSR, das in der DDR verkauft wurde, brachte Artikel, die man sich kaum traute zu lesen, so kritisch waren sie. Dieser ‚Wind of Change‘ war wohl genau das, was in dem gleichnamigen Lied beschrieben wurde. Die Rockband The Scorpions aus Hannover durfte im August 1989 in Moskau auftreten, die dortige Stimmung inspirierte die Band zu dem Song: In Russland änderte sich etwas.
Carolin Wilms
Auch im Westen nahm man die Veränderungen in Russland genau wahr und schöpfte Hoffnung: Das Wettrüsten und die nukleare Bedrohung hatten in den späten 1980er Jahren beängstigende Formen angenommen. Als Gegenentwurf dazu gab es im Westen eine sehr aktive Friedensbewegung. Die Menschen und vor allem die Jugendlichen waren politisch engagiert. NATO-Doppelbeschluss, Stationierung von Marschflugkörpern mit Atomsprengköpfen waren Themen, die im Westen nicht nur am sonntäglichen Kaffeetisch diskutiert wurden, und es gab – vereinfacht gesagt – zwei Lager: Die eher Konservativen wollten sich bis zu den Zähnen bewaffnen und aufrüsten, die Jungen wollten „Petting statt Pershing“.
„Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin!“ stand auf den Aufnähern, die auf unsere Parkas genäht waren. Der Look der Friedensbewegung war unverwechselbar: lange Haare, selbst gestrickte Pullis, Räucherstäbchen und Jute-Beutel. An eine militärische Konfrontation mit der DDR hatten dabei die wenigsten gedacht. Das Feindbild war die UdSSR. Mit Gorbatschow konnte man endlich etwas hoffnungsvoller gen Osten blicken. Dennoch schien bei den unmittelbaren Nachbarn im Osten – in der DDR – alles beim Alten geblieben zu sein: Die Opa-Fraktion mit Hut und falschem Gebiss nahm weiterhin die albernen Stechschritt-Paraden ab.
Und so war es größtenteils auch. Es gab in der DDR keine umwälzenden Veränderungen wie in Russland. Den Wandel konnte man nur minimal spüren: Etwa die Tatsache, dass der erwähnte russische Sputnik noch bis zu seinem Verbot im November 1988 gekauft und die kritischen Artikel darin von jedem gelesen werden konnten. Andere Minimal-Ausschläge am gesellschaftlichen Seismografen waren das Outing von Homosexuellen, womit man sich in den DDRJugend-Magazinen beschäftigte. So klein oder manchmal banal die Veränderungen auch waren: Es gab eine gewisse Öffnung. Es gab beispielsweise Platten von Michael Jackson zu kaufen. Zumindest, wenn man das Glück hatte, eine zu ergattern: Die sozialistische Mangelwirtschaft konnte die große Nachfrage nach derlei Produkten nicht im Entferntesten decken, und so bildeten sich lange Schlangen, falls es überhaupt einmal etwas zu kaufen gab, das irgendwie aus dem Westen kam. Die Platten von Künstlern aus dem Westen wurden in Lizenz von einem volkseigenen Betrieb hergestellt, die Qualität des Plattencovers war so dürftig, dass man auf den ersten Blick sah, dass es sich um ein DDR-Produkt handelte. Dennoch war jeder glücklich, der eine solche Platte sein Eigen nennen konnte.
Die DDR-Führung passte jedoch peinlich genau darauf auf, dass es nicht zu westlich zuging. Und somit musste es für Trends, die aus dem Westen kamen, aber die herrlich unpolitisch waren, ihre eigenen, teilweise peinlichen, DDR-Namen geben. So gab es die Bezeichnung Pop-Gymnastik für Aerobic, die DDR-Variante des Hamburgers hieß Grilletta und der ostdeutsche Hotdog war die Ketwurst, eine Kombi-nation aus Ketchup und Wurst.
Dieser Öffnung im unpolitischen Leben stand eine unerbittliche Haltung gegenüber allen Kritikern des Systems entgegen, ebenso gegenüber all denjenigen, die die DDR verlassen wollten. Und dies sogar bis in die unmittelbare Vorwendezeit hinein: Ein Freund unserer Familie äußerte sich im Sommer 1989 am Frühstückstisch in seinem Betrieb zum Thema Ungarnflüchtlinge sinngemäß so: „Ich hau dann auch bald ab, ist eh fast keiner mehr da!“ Obwohl scherzhaft gemeint, führte diese Äußerung dazu, dass er, drei Wochen später, als er seinen Jahresurlaub in der damaligen ČSSR antreten wollte, an der Grenze abgefangen wurde: Er saß bis November 1989 im Stasi-Gefängnis. Dieser Freund hat nach der Wende nicht Fuß fassen können und war viele Jahre arbeitslos.
Es war eine indifferente Stimmung, die schwer zu beschreiben ist, an die sich aber viele Ossis erinnern können: Ungefähr 18 Monate vor dem Fall der Mauer lag etwas in der Luft. Einerseits hoffnungsvoll, andererseits bedrohlich. „Es wird etwas passieren.“ Das ist der Satz, der für viele Ostdeutsche charakteristisch in dieser Zeit gewesen sein mag. Und man wusste nicht, ob es in eine positive oder eine negative Richtung ging. Schließlich gab es die Vorfälle am Platz des Himmlischen Friedens in Peking – dort war man mit Panzern und scharfer Munition gegen oppositionelle Studenten vorgegangen.
Angst und Hoffnung wechselten sich ab und vieles geschah im Verborgenen. Vielleicht ist damit zu erklären, dass man in Westdeutschland vom ostdeutschen ‚Wind of Change‘ nicht viel mitbekommen hat.
Mein Mann hatte im September 1989 mit seinem Schulfreund eine einwöchige Reise in die DDR unternommen und dessen ostdeutsche Familie besucht. Er sagt im Nachhinein, dass er selbst vor Ort nichts von diesem Wind of Change mitbekommen hatte. Vielleicht waren die Veränderungen zu subtil, dass sie ein Westdeutscher hätte spüren können. Vielleicht hatte die Familie schlichtweg Angst, denn mein Mann gehörte ja nicht dazu und hätte auch ein Stasi-Spitzel sein können. Wie wenig paranoid diese Überlegung war, zeigt bereits das Beispiel von dem Freund aus Ilka Wilds Familie, der an der tschechisch-slowakischen Grenze verhaftet wurde. Somit reiste mein Mann wieder nach Hause und konnte es nicht glauben, als keine sieben Wochen später die Mauer fiel. Ihn überkam das beklemmende Gefühl, überhaupt gar nichts in der DDR mitbekommen zu haben, obgleich sie individuell gereist waren und Verwandtschaft besucht hatten.
In unserer Familie war die Vorwendezeit persönlich eine ganz spezielle Zeit. Meine Schwester floh mit ihrem Mann und dem Trabant meiner Eltern über Ungarn in den Westen. Wir halfen ihr bei allen Vorbereitungen, mussten dies aber mit äußerster Vorsicht tun, damit die Pläne nicht aufflogen und in letzter Minute die Flucht misslang. Gleichzeitig mussten wir mit dem Gedanken leben, die Schwester eventuell für Jahre, Jahrzehnte nicht wiederzusehen, denn die Mauer war noch immer unüberwindbar.
Dieses Gefühl, die Wohnung der Schwester auszuräumen und nicht zu wissen, ob und wann man sie wiedersieht, werde ich nicht vergessen.
Derart zerrissene Gefühlswelten charakterisierten die Vorwendezeit. Und niemand, wirklich niemand, hätte damit gerechnet, dass sich die Lage derart weiterentwickelte.
Diese kollektive Erfahrung der Ostdeutschen, zu spüren, dass etwas im Gange war, wirkt bis heute nach. Es scheint, als haben die Ostdeutschen eine Sensibilität für derartige gesellschaftliche Situationen entwickelt. Vielleicht sind sie auch aufgrund derartiger Erfahrungen vorsichtiger, zurückhaltender. Vor allem aber eint dieses gemeinsame Erleben einer äußerst ungewissen Zeit. Egal, wie sehr ein Westdeutscher sich bemüht, eine Erfahrung wie diese kann man nicht wiederholen, nicht nachstellen. Diese Erfahrung ist ein ideeller Schatz, der viele Ostdeutsche in dieser Hinsicht reicher gemacht hat.
Tja und im Westen? Ich war bis September 1989 im Ausland und kann daher nicht sagen, ob auch im Westen der Wind of Change zu spüren war. Ich erinnere mich an die Bilder vom „Platz des himmlischen Friedens“, die ich in den USA im Fernsehen sah. Ich weiß, dass mich das rat- und fassungslos zurückließ. Ich konnte nicht nachvollziehen, was die chinesische Staatsführung dazu veranlasste, Panzer im Zentrum der Hauptstadt rumfahren zu lassen, bis sich einer mit Einkaufstüten in der Hand davorstellte. So fremd mir das war, so fern war es gleichzeitig. Der Gedanke, dass diese Bilder Angst bei den Menschen im Osten auslösten, ist mir nicht ansatzweise gekommen.
Überhaupt habe ich erst sehr viel später verstanden, dass sich die Berichterstattung im westdeutschen Fernsehen über die Ereignisse im Osten auch an die Zuschauer im Westen richtete. Sie war vor allem der Informationskanal für die Menschen im Osten.
Die verbotene Gewerkschaft Solidarność rief in Danzig zum Streik auf und auch andere sozialistische Staaten befanden sich in der Krise. Ob wir deshalb im Westen spüren konnten, dass sich durch Gorbatschow eine solche Veränderung abzeichnen würde? Eher nicht! Schließlich kam Lateinamerika damals mit dem Ende von Pinochet in Chile, der Wahl von Noriega in Panama und Aufständen in El Salvador auch nicht zur Ruhe und eine umfassende Erneuerung der Verhältnisse steht dort bis heute aus.
Wahnsinn! Der Mauerfall
Von Ilka Wild und Carolin Wilms
Ilka Wild
Pflicht-Demonstrationen sind das Brot- und Buttergeschäft einer sozialistischen Diktatur. So auch in der DDR: Sie hießen „Mai-Demonstration“ oder „Kampf-Demonstration zum Pfingstreffen“ und ihnen war eines gemein: Sie waren super organisiert. Man wusste genau, was einen erwartete. Und: Man musste teilnehmen. Die große Mai-Demonstration war jedes Jahr eine besonders lästige Pflichtübung. Bei meist nasskaltem Frühlingswetter mussten Eltern mit ihren Betrieben ebenso wie Kinder mit ihren Schulklassen stundenlang an Treffpunkten warten oder marschieren, bekamen Trageschilder, Transparente oder Fähnchen in die Hand gedrückt, mit denen sie nicht gegen, sondern für etwas demonstrierten, nämlich für die DDR, ihre führende Partei, ihre Lebensweise. Ich hasste diese Demonstrationen und ließ das Ganze über mich ergehen, da es bei Nichterscheinen ungemütlich werden konnte, der Staat bestand darauf, dass man ihm seine Ergebenheit demonstrierte.
Eine Demonstration der ganz anderen Art erlebte ich erstmals im Herbst 1989. Meine Mutter nahm mich mit. Ich wusste zunächst nicht so genau, wohin es ging. Oder was wir da tun sollen. Aber auf dem Weg von unserer Wohnung in die Innenstadt kamen immer mehr Menschen zusammen, die das gleiche Ziel hatten. Es waren Nachbarn, Bekannte, Menschen, die man aus dem Stadtbild kannte. Keine ausgewiesenen „Dissidenten“, sondern normale Leute. Wie sich später herausstellte, waren an diesem 29. Oktober 1989 auf dem Marktplatz von Gotha 20.000 Menschen versammelt. Die Thüringer Kleinstadt zählte in dieser Zeit knapp 60.000 Einwohner.
Auf der Demo selbst begriff ich lange Zeit nichts. Die Demonstranten waren schlecht ausgestattet, es gab wohl ein paar Transparente, auf Bettlaken und Tapeten standen Sprüche wie „Stasi in die Produktion“ oder „Von Schnitzler in den Ruhestand“. Die Menschen hielten Kerzen in der Hand. Geleitet und moderiert vom evangelischen Theologen Eckardt Hoffmann aus der Gothaer Augustinerkirche fand ein „Dialog“ statt: Bürger der Stadt stellten den Parteifunktionären der Stadt kritische Fragen und drangen auf Veränderung. Die hilflosen Sprechblasen der Noch-Elite, allesamt im DDR-Duktus, wurden von den Demonstranten mit Pfiffen und Buh-Rufen quittiert. Mir blieb der Mund offen. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Niemals hatte man vor einer so großen Menge von Leuten solch kritische Fragen gestellt, ohne dass sofort etwas passiert wäre. Man konnte die Angst der Menschen spüren, die Fragen stellten, aber auch die Angst derer, die antworten sollten. Es war eine aufgeladene Stimmung. Aber es blieb alles friedlich, was sicher der Moderation von Superintendent Hoffmann zu verdanken war.
Nach der Demo gingen wir nach Hause und fürchteten uns alle ein bisschen davor, dass uns im Nachgang etwas passierte. Aber es geschah: nichts. Bei 20.000 Menschen war wohl selbst die Stasi überfordert.
Carolin Wilms
Wie die Menschen in der DDR erfuhren wir durch das westdeutsche Fernsehen von diesen Demonstrationen: unscharfe Aufnahmen in der Dunkelheit, Transparente und Sprechchöre. Mit meinen 20 Jahren hat sich mir nicht annährend die Brisanz und die Außergewöhnlichkeit dieser Vorgänge erschlossen. Im Westen kannten wir Demos: gegen die Stationierung von Mittelstreckenwaffen, gegen „BAföG-Kahlschlag“, gegen die Atomkraft. Unsere Gesellschaft und unser politisches System waren gewohnt, dass wir unseren Unmut gegen die Politik auch auf der Straße ausdrückten. Dass es in der DDR besonderen Mut erforderte, sich diesen Demonstrationen anzuschließen, daran dachte ich überhaupt nicht, und wenn ich ganz ehrlich bin, es kümmerte mich auch nicht. Damals machte ich meine kaufmännische Ausbildung, musste frühmorgens aufstehen und da ich in der Zeit im Ersatzteillager eingeteilt war, musste ich viel stehen und laufen. Das war ich nicht gewohnt und so schaute ich mir todmüde die Fernsehbilder nur en passant an. Meinen Eltern ging es damit anders: Sie verfolgten die Geschehnisse gebannt und diskutierten, was das für Auswirkungen haben könnte.
Meist wurde aber nur über die Demos in den großen Städten wie Leipzig oder Berlin berichtet. Was das für die Menschen im Einzelnen bedeutete und dass sich auch in der Provinz Widerstand regte, war in der DDR und außerhalb zu diesem Zeitpunkt wenig bekannt.
Und es regte sich einiges, bereits ab Spätsommer 1989. Immer mehr Menschen verließen die DDR, besonders die jungen. Die Kirchen organisierten Friedensgebete und man sah nun viel öffentlicher, wie aktiv sie in der Veränderungsbewegung waren. Viele Menschen, auch normale Leute, wagten sich raus, wollten etwas verändern. Um den Sturz des Staatsapparates ging es damals noch nicht. Der saß vermeintlich noch viel zu sicher im Sattel. Verbreitung von Angst war ein Geschäft, das dieser Staat perfekt beherrschte. So begann das Aufbegehren der Ostdeutschen still und vorsichtig, die Kirchen waren ein guter Hort, da sie dort zumindest etwas Schutz genossen. Aus dieser Position und mit immer mehr Menschen, die sich beteiligten, wuchs der Widerstand, wurde lauter, deutlicher.
Die SED-Funktionäre versuchten noch immer, die Machtposition zu behalten. Besonders die militärischen Staatsorgane, die NVA und die Staatssicherheit, bauten weiterhin Drohkulissen auf. Ich hatte einen Freund, der in den letzten Wochen vor dem Mauerfall seinen Wehrdienst in der Nähe von Berlin leisten musste. Er hatte täglich Angst, zu den Berliner Demos ausrücken zu müssen. Im schlimmsten Fall hätte er auf die eigenen Leute schießen müssen. Er hatte noch monatelang Albträume.
Im Westen kamen immer mehr DDR-Flüchtlinge an und damit auch die Geschichten des Ostens. In den Notaufnahmelagern in Westdeutschland gab es viel Hilfe seitens der Bevölkerung. Viele Ostdeutsche fanden schnell einen Job und waren willkommene Fachkräfte. Wie lange die Zeit der Teilung noch dauern würde, wusste niemand. Wie viele Leute noch kommen würden, auch nicht.
Doch dann endlich und doch völlig unvermutet: der Mauerfall! Wir saßen am 9. November abends tatsächlich vorm Fernseher, als Günter Schabowski vom Blatt ablas, dass die Grenzen geöffnet werden sollten. Und zwar, so Schabowski: „… nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich.“
Dass das Ganze durch Zufall passiert war, dass ihm jemand diesen Zettel untergeschoben hatte, kam erst viel später heraus.
In Reportgen aus dieser Zeit, in der Ostdeutsche gleich nach der Maueröffnung etwas in die Kameras sagten, fällt fast immer das Wort „Wahnsinn“.
„Wahnsinn!“ – für mich das Wort des Jahres 1989. Das Wort kommt aus dem Mittelhochdeutschen, die Urform „wan“ bedeutet „leer, fehlend“. 1989 fehlten die Worte für das, was passiert war. Das Wort „Wahnsinn“ drückte für viele aus, was kaum auszudrücken war. Überraschung. Erleichterung. Freude. Erwartung. Man hörte es immer wieder. Wahnsinn.
Als die Mauer fiel, lag ich schon im Bett. Meine Mutter kam in mein Zimmer und berichtete mit tränenerstickter Stimme, was sie soeben im Fernsehen erfahren hatte. Ich glaube, dass ich nicht einmal aufgestanden bin, um mir die Bilder dieses historischen Moments im Fernsehen selbst anzuschauen. Scheinbar ging ich davon aus, dass dieses Ereignis nichts in meinem Leben ändern würde. Während in Berlin der Bär los war, schlief ich ein.
Bereits am 9. November machten sich DDR-Bürger auf den Weg in den Westen, einfach um mal zu sehen, wie es dort ist. Ungefähr 10 Prozent blieben gleich da, die meisten kamen jedoch erstmal wieder. Was auf die Rückkehrer zukam, lang völlig im Ungewissen.