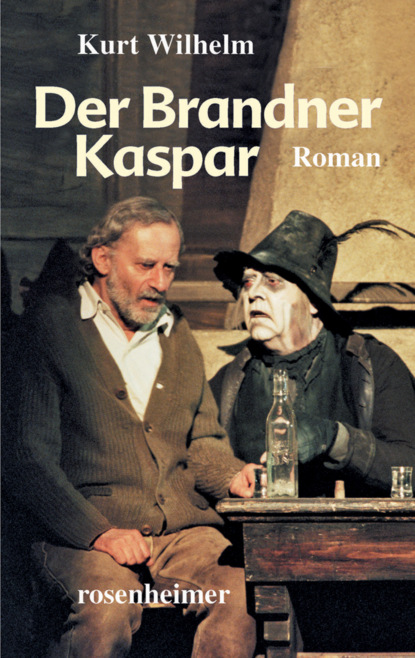- -
- 100%
- +
»Habt’s ihr in der Lotterie g’wunna?« ruft sie. Der Brandner antwortet ihr würdig: »Glei zwoamal, Vevi. Ich die Kutsch und sie des Ross, und jetzt samma so fürnehm, dass du künftig fei Sie sagen musst zu mir, und zu ihra gnädiges Fräulein!«, und dann feixen sie alle.
Sie überlegen den Weg, denn das einzelne Pferd kann den steilen Anstieg zum Hof gewiss nicht bewältigen. Das letzte Stück wird der Kaspar zu Fuß gehen oder auf dem ausgespannten Ross reiten müssen.
»Ich hatsch auffi, macht’s keine Krampf, ich bin doch scho wieder wie neu«, sagte er. »Kutschier du beim Westerhof auffi, so weit als es geht, dann kehrts ihr um und bringts den Wagen gleich z’ruck. Ich mag des Entgegenkommen net gar a so ausnutzen.«
Hinter ›Maria Schnee‹, der kleinen Kapelle, wo der Albach in den See sich ergießt, schlägt das Pferd selber den Weg hinauf ein. Es kennt ihn, er führt ja zum Lustschloss seines Herrn, Dr. Senger, und es zieht kraftvoll empor.
Die Sonne ist hinunter, die Silhouetten der Berge stehen scharf und blauschwarz vor dem in vielen Farben leuchtenden Himmel, und der Kaspar kann auf den schimmernden See hinabsehen. Er hat nicht die Wahrheit gesprochen, als er sagte, er sei schon wieder wie neu. Sirrend und klingend bedrängt seinen Schädel der unausweichliche Schmerz, und durch seine Glieder rieselt Kälte in Schüben und Wellen.
Ihm ist elend und fremd, und plötzlich fasst ihn der Gedanke, dass er das alles irgendwann ein letztes Mal sieht, dass das Sterben zu jeder Minute dicht beim Lebendigsein steht und dass er heut nicht einmal mehr Abschied hätte nehmen können von seiner Welt.
Ja, hätte er den Schädel um eines Fingers Breite zur Seite geneigt, er läge seit einer Stunde tot auf der Erde. Hätte er zur Mittagsstunde gedacht, dass ihn zu Abend eines Fingers Breite vom Tode trennt, von einem plötzlichen Sterben, das er nicht einmal wahrnehmen könnte? Dass er mitten aus seinem selbstverständlichen Leben ohne Abschied dahin gemusst hätte?
Wohin?
Erzählt der Herr Pfarrer jemals, wie das Sterben geschieht? Der sagt nur, dass vielleicht in einem lichten Himmel voll Engel und Heiliger das Paradies und die ewige Seligkeit warten, dass Sünder hinab ins Fegfeuer müssen. Was mir geschehen wäre, nachdem mich der Schuss aus dem Leben riss, davon schnauft er nichts.
Wär ich gestürzt ins Bewusstlose, Schwarze? In ein dunkles Reich, von dem alte Bücher und Weissagungen künden? Ich kann’s mir nicht ausmalen. Ist dieses Reich, unsichtbar, stets so dicht neben uns, dass in jeglicher Stunde eines Fingers Breite genügt, uns in seine ewige Finsternis zu stürzen? In jeder Minute unwahrnehmbar nah, ohne dass wir es merken? Wie geschieht die Verwandlung? Wie kann ein Geschöpf, Mensch oder Tier, grad noch voll Leben sein und gleich darauf unwiderruflich erloschen und tot? Wo ist das hin, das es lebendig hat sein lassen?
Herrschaft, was denk ich heut für a Zeug z’amm, schimpft er mit sich. Ich bin oft genug am Tode vorbeig’rutscht, und nie haben mich solche Gedanken bedrängt. Damals, wie auf der Pirsch am Setzberg der Steinschlag herunter ist mit Rumpeln und Poltern, wie links und rechts die Brocken eingehaut haben, da hätt mich, um des Fingers Breite, ein Trumm derschlagen können. Oder wie der Blitz neben mir in die Eiche gefahren ist, unter der ich den Augenblick vorher noch Schutz gesucht hab vor dem Gewitter. Wie oft werd ich, ohne es zu spüren, so nah am Tode gewesen sein?
Wenn ich’s nie gespannt hab, dass die nächste Minute die letzte sein könnt, warum hämmert’s mir heut so im Hirn? Ich bin wiederum unbeschadet davongekommen, mir droht keine Gefahr. Werd ich dappig und feig? Ich muss mich zusammenreißen.
»Dir is doch net gut, Großvater«, sagt das Marei besorgt, »du schaust drein, als wär dir net extra. Sollt ma anhalten, und du rastest dich aus?«
»Nix. Es ist alles, wie es sich g’hört. Wir sind ja gleich droben. Des Ross zieht ja wie der Deifi den Berg ’nauf, Sapristi!«
Ein paar hundert Schritte vom Haus wird der Weg zu steil und zu lehmig, da geht es nicht weiter, der Wagen bleibt stecken. Der Flori wirft die Zügel über den Weidezaun und schirrt so weit ab, dass das dampfende Tier sich beugen und grasen kann. Dann gehen sie das letzte Stück hinauf. Der Söllmann läuft vor ihnen her und kriecht gleich in seine Hütte beim Stall.
Dem Brandner sein Anwesen war früher einmal eine Hube. Heut ist es kein Lehen und nicht einmal mehr ein Halblehen, sondern nur noch eine Sölde, ein Sechzehntel von einem richtigen Hof.
Ihm gehört noch das niedrige Haus mit dem geneigten Schindeldach, der Altane aus Holz im ersten Stockwerk, den kleinen Fenstern, um die herum eine Lüftlmalerei verblasst. Die vielen Geranienkästen, die das Marei liebevoll pflegt, lassen es freundlich genug herschauen. Im Stall stehen drei Schafe, zwei Küh und zwei Ochsen, einer für die Arbeit und einer zur Mast, zum Erwerb. Früher waren da zwei Dutzend Milchvieh und die vier Rösser vom Fuhrgeschäft seines Vaters eingestellt, nun ja. Eine Loas mit vier Fackein liegt drinnen im Koben. Im Verschlag nebenan sind nur mehr zwei Enten und sieben, acht Hühner. Gäns gar keine mehr.
Der Wald hinterm Haus gehört schon lang nicht mehr ihm. Nur noch das Dicket aus Fichten und Buchen den Hang zum Albach hinunter. Der verläuft seit über vier Jahren außerhalb seiner Grenze, seit er, um dem Senftl Schulden zu zahlen, das Land mit dem Bach schweren Herzens dem Pfliegel verkauft hat, dessen stattlicher Hof im Dämmer in der Entfernung zu sehen ist.
Ans Haus grenzten einstmals sechzig Tagwerk bucklige Gründ. Zwölfe davon sind ihm verblieben. Das meiste ist Grasland, ein Acker Kartoffeln und ein Eckerl, wo der Roggen gedeiht, auf dass er sein eigenes Brot hat, das dankbar und fromm mit dem IHS des Brotstempels geweiht wird, und vor dem Anschneiden mit dem Messer bekreuzigt.
Im Stadel, an den das Brennholz sauber geschlichtet ist, stehen der große und der kleinere Wagen und der zum Odeln. Dort sind die alten Gerätschaften aufbewahrt: Strohschneider, Gsootbank, Schäffel, Dengelstock, Sattlerbank und die Hoanzlbank fürs Bearbeiten kleinerer Hölzer. Und natürlich das Heu für das Vieh. Voll wird er nimmer. Im Winter hacheln und kämmen er und das Marei dort das bissei Flachs, das oberhalb wächst, das sie zuvor geriffelt und am heißen Ofen gebrechelt haben, und das Marei ist tüchtig im Spinnen und Weben.
Am Stadel das Backhaus, daneben seine finstere Schlosserwerkstatt mit dem alten – zu alten – Werkzeug. Alles sauber geordnet und ein bissei heruntergekommen, weil es so lang schon am Nötigen fehlt.
Sie gehen durchs Sommergatterl in den Vorgarten mit den Blumen, dem Gmüs und den Krautern. Sie öffnen die Haustür, auf deren Stock das segnende 18 C + M + B 56 mit Kreide geschrieben steht. Hinter der Tür nimmt der Kaspar den Weichbrunn – heut ist ihm danach – und schlägt das Kreuz, dankbar für seine Heimkehr.
»Bring ma dich gleich ’nauf ins Bett?«, fragt das Marei, aber er mag noch nicht liegen, er will in die Stube, zum Lehnstuhl. Es ist bereits dunkel. Das Marei zündet die Petroleumlampe an, hockt sich nieder, zieht ihm die Stiefel aus und bringt die Hauspantoffeln mit den hölzernen Sohlen. Er lässt sich heut die Bedienung gefallen, weil er sich doch recht hart schnauft und keine Kraft in sich spürt.
»Ich mach dir was z’ essen.« Das Marei will in die Kuchl, doch er hält sie zurück:
»Dankschön, i mag nix. Ich brachtert nix nunter. Ich brauch bloß a Zeitl mei Ruh zum staad Sitzen und Ausschnaufen.«
Der Flori steht herum wie ein fremder Besuch und schaut ein bissei besorgt drein: »’s Beste is g’wiss, i druck mi und bring den Wagen zurück.«
»Das Marei soll mitfahren!«
»Geh, Großvater, ich lass dich doch jetzt net allein.«
»Und dein Treiberlohn? Wir ham’s net grad zum Verschenken, Madl. Du fahrst mit zur Jagdtafel und holst ihn dir ab. Da kann der Senftl nix machen dagegen. Nimm die Kraxen mit, dass d’ was heimschleppen kannst, im Fall was von der Strecke an die Treiber verteilt wird.«
Das Marei möchte schon gern zum Gelage, aber sie zögert: »Des wär doch net zum Verantworten, bei dei’m Zustand …«
Der Alte muss sie hinausstampern zum Umziehen, weil sie im Treibergewand, als Bub, dort nicht gut auftauchen kann. »Schleun di«, sagt er, »net dass die besseren Trümmer alle vergeben san.«
Das Marei lacht und gehorcht nur zu gern.
Während sie in ihrer Kammer sich putzt, mag der Flori in seiner jugendlichen Neugierde noch einmal über die Vorfälle reden:
»Du hast den Schwarzen doch ’kennt und magst es net sagen, aus Schonung für ihn. War’s dem Simmerl sein Schuss?«
»Is doch Wurscht. Es ist gut ausganga und damit vergessen. Ich hab niemand kennt und bin mir auch nimmer sicher, ob da wirklich wer war. Der Doktor wird schon Recht haben, es war a Traum, mehra net.«
»I glaub aber schon, dass es der Simmerl gewesen sein könnt.«
»Und wenn – ich wär ihm net gram, es wär net mit Absicht geschehn.«
Der Flori geniert sich ein wenig, ehe er allzu neugierig wissen mag:
»Is ’as Marei immer noch Freund mit dem?«
Der Kaspar schmunzelt, weil sich der junge Dutterer gar so plump über den Rivalen erkundigt:
»Des fragst sie selber. I schaug net dahinter – des is ihra Sach’.«
»Und die Drohung vom Senftl? Die war ja beinah wie a biblischer Fluch. Ich mein’, so ein Garneamd, wie ich, der richtet nix aus gegen ihn. Aber traut der sich wirklich an euch?«
»Bei dem weiß ma nie. Er is a tüchtiger Mann, er hat seine Verdienste, auch um die Gemeinde, aber halt a Ruach, a Geizkragen, a Zornniggel und a Gifthaferl dazu.«
»Des kannst aber laut sagen. Seine Knecht sind der Ansicht, sie derleben es noch, dass den der Schlag trifft, vor Giez und vor Geiz. Der werd amal blau im G’sicht und fallt um – auf des warten s’.«
»Man soll neamd nix Böses net wünschen, aber eine Vermahnung kunnt dem g’wisslich net schaden. Es war oft g’nua nah dran, dass s’ ihn ins Haberfeld treiben, so harb sein manche auf ihn. Was meinst, hat er’s dir gegenüber ernst g’meint?«
»Glaub schon. Ich geh nachert z’ruck auf sein Hof, in mei’ Kammer, und wart ab, was er morgen daherred’t. Kunnt aa sein, i triff ihn jetzt noch, drunten im Schloss, dass er da scho was sagt …«
»Geh ihm heut aus ’m Weg. Heut is er noch z’ gifti.«
»Vorhin, wie sich die Herrschaften um dich bekümmert ham, da war er ganz zahm und hat sogar aufs Marei a ganz a süße Fotzn hing’macht. Ihren Treiberlohn werd er na doch net verhindern, oder was meinst?«
Sie hätten noch mehr hin und her überlegt, wäre nicht das Marei hereingekommen, unternehmungslustig und voll Vorfreude. Im Feiertagsgewand mit dem Schalk sieht sie so zum Abbusseln aus, dass der Brandner ganz stolz auf sein ansehnliches Enkelkind wird.
»I waar ’s, Flori! Großvater, im Herd is noch Feuer, kanntst dir die g’schmalzene Brotsuppen aufwärmen, wenn dir danach is. Dann gehst aber ins Bett, des musst mir versprechen. Du schaugst zwar schon wieder ganz frisch her, aber besser is besser. Gib gut auf dich Obacht und mach keine G’schichten. Wenn’s dir schlechter gehn sollt, läutest die Glocken oben am Haus. Die hör ich bis drunten und bin glei bei dir.«
»Wenn ’s mir letz wurert, hätt i den allerbesten Nothelfer gleich bei der Hand«, sagt der Alte, holt den Kerschgeist des Simmerl aus seiner Tasche und lacht: »Jetzt druckt’s euch, ihr zwoa, vor i euch ’nausschmeiß! Hat ma denn niemals a Ruh vor euch Junge?«
Er ist so guter Dinge, wie er da sitzt in dem Lehnstuhl, dass sie fröhlich und sorglos davoneilen können. Er sieht durch das Fenster sie ins letzte Dämmerlicht laufen, hört ihre Stimmen, das Anschirren drunten, das Wenden des Wagens, das Schnauben des Sengerschen Pferdes. Sie rasseln davon, es wird still.
Da ist er allein und allem ausgeliefert, was kommt.
Der Tod
Der Schmerz im Schädel wird ihm wieder bewusst. Er verharrt unbeweglich, er kann sich nicht entschließen, in die Schlafkammer zu gehen, er wartet und weiß nicht, worauf. Er wickelt die Binde ab, die der Medicus um seinen Kopf geschlungen hat, tastet, schaut auf die Finger, ob noch ein Blut zum Sehen ist, aber da ist nichts mehr. Missmutig tatscht er an dem wehen Ohr herum.
Das elende Sirren und Klingen in seinen Ohren will nicht verstummen. Und seine Augen? Wohin er auch schaut, es ist ihm, als blicke er wieder durch Wände aus dickem Glas, die alles verzerren und krumm machen. Deifi noch amal, denkt er, ich hab doch schon ganz andere Sachen derlebt, und mir war net a so. Jeder Wehdam wird mit der Zeit g’ringer, und so damisch kann einem doch net sein von so a bissei am Streifschuss. Sollt ich aufstehn und mir a Essen bereiten? Ich hab seit in der Früh fast nix im Magen. Am End liegt’s an dem, dass ich so roglert beinand bin.
Er will sich erheben, aber es geht nicht. Die Mattigkeit presst ihn in den Lehnstuhl zurück. Er ächzt leise und wiegt den Kopf schmerzhaft hin und her, wie er es öfter hat tun müssen seit dem Peitschenschlag des Schusses im Wald.
Es ist still. Er hört nur die alte Uhr an der Wand unermüdlich die Minuten in Stücke hacken. Lauter als sonst, kommt ihm vor. Dass von draußen so gar nichts zu vernehmen ist? Kein Laut von den Viechern im Stall, kein Uhuschrei durch die Nacht?
»Ah was«, sagt er rau, reißt sich empor aus dem Sessel, stellt sich, so fest es gehen will, auf seine Füß und schlurft in die Kuchl hinüber zum Herd. Er vernimmt dabei nicht die eigenen Schritte, über das Sirren und Klingen im Schädel dringt nur das schmerzende Hacken der Uhr, sonst ist alles wie tot und verstorben, als lebe die Welt nicht mehr, als sei er allein geblieben in ihr.
»Und ’s Feuer is auch aus? Kein Fünkerl Glut mehr, nur Asche? Wo ’s Marei doch g’sagt hat, es brennt noch, und wo ’s doch ansonsten immer noch glimmt, auch wenn wir den ganzen Tag fort waren. Was g’schiecht denn bloß heut? Spinn ich? Is alles derquer?«
Eine Wut packt ihn. Er haut mit der Faust auf die laue eiserne Herdplatte. Für die Brotsuppen müsst ich den Herd erst wieder zünden. Ah was, a Stückl a Brot oder a Nudel wird’s auch tun, und zur Feier meiner Errettung vergönn ich mir a Trumm vom G’selchten und einen Schluck von dem Kerschgeist dazu. Wo hab ich die Flaschn denn hingetan?
Als er sie sucht und in die Stube zurückkommt, gleitet sein Blick über den Herrgott im Winkel über der Ofenbank. Ein Schein Mondlicht fällt just auf ihn. Still hängt er da, aber es ist ihm, als schaue er her, mit einem wahrhaftigen Blick aus wirklichen Augen, wo die doch nur aufgemalt sind.
»Weh tut’s«, sagt er leise zum schmerzhaften Herrgott hinüber, »und mir is so loami wie niemals zuvor, und schieach zum Verzagen. Ich war noch nie krank, bis zum heutigen Tag. Was hätt mich auf oamal ’packt, und ich kann mich nicht wehren?«
Blicken die gemalten Augen aus dem gesenkten Haupt wahrhaftig forschend herüber, oder macht nur das seltsame Mondlicht, dass es so scheint? Mondlicht? Ist denn nicht Neumond?
Dem Kaspar rieselt es über den Buckel. Des muss wahrhaftig a Krankheit sein, die mich am Schlafittl ’packt hat, und desterhalb fang ich ’as Spinnen an, von einer Stund auf die ander’. Er reißt die Tür auf ins Freie und schaut zum Himmel hinauf. Da ist kein Mond. Es ist rundum stockfinster.
Just in dem Augenblick kommt ein Wind auf. Von fern über die Blauberge rauscht er daher, wie oft, wenn ein Südwetter einfällt und erst einen Sturm vor sich her jagt. Mit jeder Minute kann er das Heulen und Sausen deutlicher hören, aber, g’spassig, kein Blattl regt sich dabei, kein Bröserl Staub wirbelt auf, nur einen eiskalten Hauch verspürt er auf seinem Gesicht.
Ein Sturm nach so einem sonnigen Tag, einem geruhsamen, leuchtenden Abend? Ein Wettersturz, der einen Schub Kälte vorausschickt, zu dieser Jahreszeit? Ist der heilige Petrus närrisch worden? Oder der heilige Michael, von dem man die guten Wetter erflehen muss? Kann der es heulen und sausen lassen, ohne dass die Busch, die Äst und die Bäume sich biegen?
Warum steht alles starr da und still? Die Kerze in seiner Hand flackert nicht einen Deut, als er ums Haus eilt, um zu sehen, was er nicht glauben mag. Aber es ist so, wahrhaftig: Der Söllmann liegt ruhig in der Hütte, den Kopf auf den Pfoten, und im Stall drinnen rührt es sich nicht, wo die Viecher doch sonst beim Sturm an den Ketten zerren, brüllen, scharren und an die Bretterwand dreschen vor Angst. Sie liegen friedlich und still, und nur etliche heben ein wenig die Köpf, als der Kaspar die Tür auftut und im Kerzenschein nach ihnen schaut.
Eisige Furcht kriecht in sein Ingreisch, und er flüchtet förmlich zurück in die Stube. Der Schnaufer geht schwer, er greift sich ans Herz, auf dem ein Gewicht lastet, und er murmelt: »Des kommt alles vom Magen. Was essen, na bin i glei wieder beinand.«
Sein Blick streift abermals den Herrgott im Winkel. Das seltsame Licht ist erloschen, die Augen schauen nicht mehr. Na alsdann, es werd ja schon wieder, denkt er. Da mischt sich in das nahende Brausen des Sturms der ferne Klang einer Glocke.
»Läuten die drunten im Schloss bei der Festlichkeit? Aber nein, das ist die Totenglocken, drunten, vom See, von Quirin! – Wer is denn da g’storben? Und seit wann läutet man die bei der Nacht?«
Er schlägt das Kreuz, er hockt sich zum Tisch in den Herrgottswinkel, er horcht auf das Wachsen des Sturms und das scheppernde Glöckchen und vermag sich nimmer zu rühren. Etwas zwingt ihn zum Stillsein und Warten, bis geschieht, was nunmehr geschehen muss. Nach einer Weile wird’s still. Nur die alte Uhr hackt die unendliche Zeit in die Stube.
Dann klopft es hart an die Tür, drei Mal. Der Brandner hebt seinen Blick und ruft laut:
»Nur eini!«
Die Türe fliegt auf, und draußen vor dem Dunkel der Nacht steht wer, dessen Umriss zu ahnen und dessen Gesicht nicht zu sehen ist. Er tut keinen Schritt und sagt keinen Mucks, bis es dem Brandner zu dumm wird und er ihn anredet, obwohl es ihm widerstrebt:
»Hab mir’s glei denkt, dass des a Fremder is. ’s Anklopfen is bei mir net der Brauch. Meine Tür is für a jeds offen«, sagt er.
Die Gestalt regt sich nicht. Sie scheint nur feindlich und bös aus dem Dunkel auf ihn zu starren. Der Kaspar spürt einen Ärger und merkt nicht, dass der Schmerz, dass das Klingen und Sirren im Kopf ausgelöscht sind, dass ihm der alte Mut und die gesunde Courage zurückkehren, als er den Fremdling in Ungeduld angeht:
»Alsdann, was geit’s? Red halt, was d’ willst?«
Keine Antwort.
Der Kaspar rückt ein wenig herzu auf der Bank, um die Gestalt besser erkennen zu können, und spricht dringlicher auf sie ein:
»Grad war i draußd vor der Tür. Da war weit und breit keine Seel net zum Sehen. Bist du eppa herg’flogen?«
Auf einmal krächzt es aus der Gestalt, sanft und seltsam:
»Kunnt scho sein.«
Was ist das für eine Stimm? Sie klingt wie von fern her, rissig und dünn, und ist doch ausfüllend nah in den Ohren, so als raune sie von keinem Ort, als spräche sie in ihm selber. Der Brandner kann sich nur wundern:
»Du bist mir einer«, und winkt: »Geh halt zuawi, steh net draußen vorm Haus und trag mir die Ruh aussi.«
Langsam, und scheinbar ohne die Füße zu regen, gleitet der Fremde herein in die Stube. Hinter ihm fällt die Türe ins Schloss, ohne dass er sie angerührt hätte, ganz von selber. Nun steht er am Tisch, neben dem Ofen, schwarz und still. Der Schein der Petroleumlampe streift ihn, und der Kaspar kann sich gar nicht genug wundern:
»Du bist mir einer. Zaundürr und klappert, bleich und hohlaugert, zum Derbarmen.«
Die Gestalt scheint zu lächeln.
»Kennst mich net?«, fragt sie so sanft, dass es dem Kaspar ganz anders wird und seine Angst ihn immer mehr ausfüllt. Er schüttelt den Kopf. Freilich, insgeheim kennt er ihn, freilich. Woher nur?
»Derratst mich denn net?«, fragt es lauernd.
Der Kaspar schüttelt erneut seinen Kopf, während es ihm kalt und kälter durchs Hirn und den Leib rieselt, weil er es weiß und es dennoch nicht wissen und wahrhaben mag. Er duckt sich zusammen, er wendet den Blick ab und raunzt feindselig zurück:
»Mir is’, als möcht ich dich net derraten.«
»Wir san uns doch heut scho begegnet, auf an winzigen Augenblick – du erinnerst dich doch ganz genau, Kaspar, geh zua!«
Er hebt seinen schwarzen Umhang vors Gesicht, akkrat so, wie der Kerl heut im Wald, als den Brandner der Schuss riss und er wie tot auf dem Boden gelegen ist. Freilich! Das ist er! Aber nein, der hat doch ganz anders ausg’schaut, und den hab ich mir lediglich ein’bildt, hat der Doktor gesagt. Nun steht er da in der Stube und redet mit einer unbegreiflichen Stimme, wie niemand auf Erden sonst redet.
Der Tod ist es, und er erscheint in jener Gestalt, wie sie in der Kirchen aufgemalt ist, an der Decke. Es ist wahr. Ich hab’s nicht gewusst und hab’s nicht geahnt. Die Stunde des Scheidens, die Stunde des Sterbens ist da, vor mir steht der Tod!
Der antwortet, ohne dass es gesagt oder gefragt worden wäre:
»Net gar so dramatisch, Kaspar. Sag ›Boanlkramer‹ zu mir, wie alle Leut, wenn s’ meinen Namen nicht aussprechen mögen aus begreiflicher Furcht. Schau, ich komm, weil ich dich fragen hab wollen, ob’st net eppa mit mir gehst.«
Mitgehen? Ergeben und ohne Widerred sterben? Der Brandner springt auf und versucht mit ein paar Schritten die Tür zu erreichen.
»Naa!« ruft er dabei. »Und i mag amal net!«
Da zwingt ihn die Stimme zum Stehen.
»Es muss dengerscht sein«, sagt sie ungerührt, unverändert und sanft: »Schau, Kaspar, der Büchsenschuss sollt dich vermahnen ans End von aller Zeitlichkeit.«
Der beginnt zu begreifen: »Ah, so geht des zu?! Du bist es g’wesen, der den Schuss auf mich g’lenkt hat.« Und als die Gestalt zu nicken scheint, setzt er höhnisch hinzu: »Und hast mich net amal ’troffen? Net amal des? An Prellschuss hast z’ammbracht, wie der belgische König, du sauberer Schütz.«
Dem Schwarzen scheint dieser Vorwurf unangenehm, sein Raunen klingt um einen Deut strenger:
»Nach dem Schuss sollten die Leut sagen: Er hat dieses Schrecknis nicht überstanden, weil es zu viel war fürs alte Herz. Es hat’s nimmer derpackt und ist stille gestanden in Frieden, in der nämlichen Nacht. Verstehst?«
Freilich versteht das der Kaspar. Ganz gut versteht er’s, aber er will’s nicht verstehen. Er will leben und nicht ergeben sich fügen, und so vergisst er, welch ein Bote da vor ihm erschienen ist, und raunzt ihn an, als sei es der Loichinger, der schelchaugerte, dumme Gendarm:
»Nix da, nix. Des san Sprüch und san Krampf. Der Schuss, der war net für mich.«
Mit einem Ruck schnellt der Schwarze augenblicks dicht vor ihn hin, als wollt er ihn zwingen:
»Der Tag is für dich! So is es dir aufgesetzet. Es geht aufs End!«
Er hebt den Zeigefinger wie ein strafender Schullehrer. Als der Brandner bemerkt, wie knochig und dürr dieser Finger ist, wird ihm wieder bewusst, mit wem er da redet, und er denkt im nämlichen Augenblick nur noch das eine: dass er sich nun aufs Aushandeln verlegen muss, denn ein Mitgehen, Ergeben, so einfach mitten heraus aus dem Leben …
»Geh, Boanlkramer, sei net a so! Ich bin doch so g’sund wie der Fisch drin im Wasser. Sag selber, schau’n so die grablaufenden Leut aus, die du holst ansonsten?«
Grinst der Schwarze? Der Brandner kann es nicht recht erkennen, denn dieses Gesicht ist wie hinter einem schwarzen Schleier verborgen. Nur dann und wann brennt ein stechender Blick heraus, oder ein amüsierter, wie jetzt grad, als der Besucher kichert: »Naa naa, da hast Recht, die mehrern san siech und lägrig.«
»Und zaundürr und klappert, dass ma d’ Verwandtschaft zu dir gleich erkennt«, versucht der Brandner zu scherzen.
Der Bote schüttelt bedeutsam den Kopf: »Manch andere aber, schau, die sind wie du noch voll Leben, und dennoch ist es ihnen unwidersprüchlich ehern aufgesetzet.«
Ich darf ihm nicht zeigen, wie es mir graust, denkt der Brandner. Er mag es, scheint’s, wenn man sich nicht vor ihm fürchtet und lustig redet mit ihm, auf dass er noch einen G’spaß draufsetzen kann, und so ruft er und versucht ein Lachen dabei:
»Ja, wenn ’s rauschig san und heimzu wackeln, bei der finsteren Nacht!« Und wirklich kräht der Schwarze vergnügt: »Akkrat a so ist es! Wenn s’ da singen und hupfen, dann tun sie blindlings den falschen Schritt! Und ich – ich muss ihrer warten!«