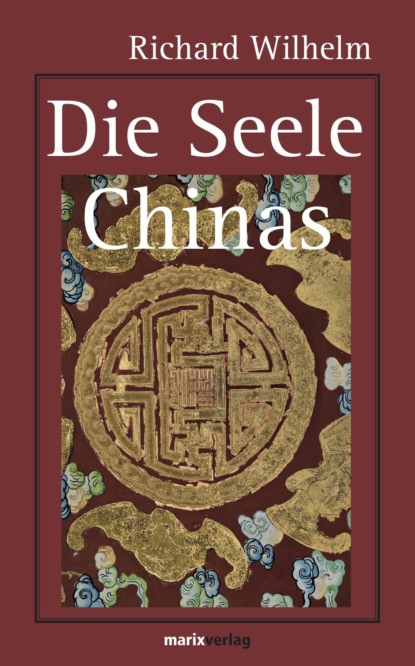- -
- 100%
- +
Von anderer Seite kam eine andere Gegenwirkung. Der junge Monarch hatte sich von der Last der auf ihn drückenden Tante befreien wollen. Er hatte Yüan Schi K’ai dazu ausersehen, im Schutz tiefsten Geheimnisses, die Kaiserin-Witwe und ihren Anhang beiseite zu bringen. Er hatte nicht in Rechnung gezogen, dass Yüan Schï K’ai zu dem Vertrauten der Kaiserin-Witwe, Yung Lu, im Verhältnis der Wahlverwandtschaft stand. So verriet denn Yüan Schï K’ai den ganzen Anschlag. Die alte Kaiserin wurde rasend. Die Reformer mussten schleunigst die Hauptstadt verlassen, und wer nicht floh, war des Todes. – Die Reformära war außenpolitisch nicht glücklich gewesen. Stück für Stück, von Kiautschou bis Kuangtschouwan, von Port Arthur bis Kowloong war eine ganze Anzahl der wichtigsten Hafenplätze von China losgerissen worden und noch war kein Ende abzusehen. So war es denn kein Wunder, dass die Kaiserin-Witwe die volle Sympathie der einheimischen Bevölkerung für sich hatte, als sie mit starker Hand das Rad wieder rückwärts wandte. Das war die Stimmung gewesen, aus der der Boxeraufstand hervorwuchs.
Wie schon erwähnt, begann mit dem Zusammenbruch dieses letzten Versuches der Reaktion eine neue Periode der Reformen, oder genauer gesagt, eine neue Etappe der schon gekennzeichneten zweiten Periode. Denn es waren keine neuen Gedanken grundlegender Art, die aufgekommen wären. Das einzige Prinzip war, dass ein langsames Tempo der Reformen eingeschlagen werden sollte. Es wurden Termine festgesetzt, innerhalb derer die einzelnen Reformen vorgenommen werden sollten, so dass dann nach einer Reihe von Jahren aus dem antiken chinesischen Staat eine moderne konstitutionelle Monarchie geworden wäre.
In Wirklichkeit hat ja die Bewegung einen wesentlich anderen Ausgang genommen. Um den Verlauf der Dinge zu verstehen, müssen wir uns über das politische Kräfteverhältnis in China klar werden. Seit langer Zeit schon gruppierte sich die chinesische Politik um drei Zentren. Einmal ist von Bedeutung der Norden. Dort liegt Peking am Rand der großen, fruchtbaren, hauptsächlich weizentragenden Ebene, die das Flussgebiet des Gelben Flusses ist. Hier ist der Sitz der ältesten chinesischen Kultur. Ein nüchterner, strenger, starker Geist herrscht hier. Der Konfuzianismus in seiner ernsten Einfachheit gibt dem Ganzen das Gepräge. Dieses Zentrum gewann naturgemäß an Einfluss, seit die Mandschus China beherrschten, da sie ja auch aus dem Norden stammten und in gewissen Zügen eine Verwandtschaft mit diesem Charakter zeigten. Als mächtigster Mann im Norden stand in dieser Zeit Yüan Schï K’ai da. Er hatte in entscheidender Stunde die Kaiserin-Witwe gerettet. Während der Boxerzeit war er allerdings in Schantung neutral geblieben. Aber diese Haltung hatte sich durch die Verhältnisse später gerechtfertigt. So war es denn nur natürlich, dass er in der neuen Ära an Einfluss gewann, wenn auch die Kaiserin-Witwe ihm vielleicht doch nicht ganz traute, worauf manches in den späteren Jahren hinweist. Seine Politik war nach einfachen Gesichtspunkten gestaltet. Für ihn kam in erster Linie die Konzentration einer entsprechenden Macht in Frage. So waren seine Reformen denn hauptsächlich darauf gerichtet, ein gut geschultes, diszipliniertes Heer zur Verfügung zu haben. Um die Mittel hierfür zu schaffen war er bestrebt, Handelsunternehmungen und industrielle Anlagen, Bergbau, Hüttenwesen usw. zu fördern. Man kann wohl sagen, dass er in Nordchina in dieser Hinsicht entschieden Bedeutendes geleistet hat.
Was das Gebiet der Kultur und Erziehung anlangt, so geschah unter ihm, was vorgesehen war in dem allgemeinen Reformplan, ohne dass er ein besonderes Interesse für diese Dinge an den Tag gelegt hätte. Wodurch Yüan Schï K’ai mächtig war, das waren die Beziehungen, die er überallhin anzuknüpfen wusste. Er hatte durch seine zahlreichen Nachkommen Familienbeziehungen zu fast allen bedeutenden und mächtigen Familien. Auch sonst ging das System seiner Freundschaften sehr weit. Und zwar war es immer das persönliche Interesse, durch das er die Leute an sich zu fesseln verstand. Durch diese gut auserwählte Anhängerschaft war es ihm denn auch stets möglich, seine Ansichten von anderen aussprechen zu lassen und scheinbar widerwillig sich zu dem nötigen zu lassen, was er von Anfang an bezweckte.
Ein anderes Zentrum des politischen Einflusses lag am Yangtse. Hier saß in Wutsch’ang Tschang Tschïi Tung, der von Kanton aus dorthin versetzt war. In Nanking saß Liu K’un Yi, der sich in entscheidenden Momenten seiner Politik anschloss. Tschang Tschï Tung stammte aus der Nähe von Tientsin, aber in seiner Politik verfolgte er wesentlich andere Linien als der Realpolitiker Yuan Schï K’ai. Sein Hauptinteresse war das konfuzianisch Literarische. Er war keine ganz einheitliche Natur, die bis in die letzten Gründe der Realität hinabreichte. »Tigerkopf und Schlangenschwanz« war eine Bezeichnung, die unter den Gelehrten über ihn im Schwange war. Auch er hat industrielle Unternehmungen großen Stils ins Leben gerufen. Er hat auch eine Mustertruppe ausgebildet. Aber sein Hauptinteresse galt den Fragen der Bildung. Er war überzeugt, dass eine Modernisierung der chinesischen Erziehung notwendig sei. Er ist es schließlich gewesen, der, als er in seinem Alter nach Peking berufen worden war, die Einrichtung der Deutsch-Chinesischen Hochschule mit dem von deutscher Seite abgeordneten Professor O. Franke zustande brachte. Aber diese Reformen waren nur die eine Seite seiner Ziele. Worauf es ihm vor allem anderen ankam, war, dass unter dieser modernen Schale der alte konfuzianische Geist gewahrt werden sollte. So hat er in Wutsch’ang eine große klassische Akademie gegründet, die seine Lieblingseinrichtung war, und von der noch jetzt malerische Ruinen inmitten eines Teichs in Wutsch’ang die Revolution überdauert haben. Freilich, der alte Glanz ist dahin. Die Truppen, die darin nach der Revolution gehaust haben, haben die Spuren ihrer Rücksichtslosigkeit in den einst so schönen und malerischen Gebäuden hinterlassen.
Tschang Tschï Tung war ein Mann des Kompromisses. Er war freilich von weit stärkerem Kaliber als sein langjähriger Sekretär Ku Hung Ming, den er trotz dessen fanatischer Fremdenfeindlichkeit lange duldete, ohne ihm jedoch Einfluss auf die Geschäfte zu gestatten. Aber weil er nicht ganz tief und original war, ist er schließlich doch gescheitert. Immerhin sind der Klang seines Namens und die Überreste seines Werkes in Wutsch’ang, wo jetzt ein Militärgouverneur herrscht, noch auffallend lebendig.
Welch seltsames Gemisch von Geschmack in chinesischen Dingen und absoluter Richtungslosigkeit in europäischen Dingen unmittelbar zusammenstehen konnte, davon kann man gerade in Wutsch’ang noch manches Beispiel sehen. Wutsch’ang ist einer der Orte mit großer historischer Vergangenheit. Der Roman von den drei Reichen hat einen seiner Schauplätze in jener Gegend. Dort in der Nähe ist die rote Wand, eine Felswand, die jäh in den Fluss abstürzt und die der Sage nach rot gebrannt wurde von dem Feuer, in dem eine große Flotte eines der streitenden Reiche zugrunde ging, die in der chinesischen Poesie durch die Jahrhunderte hin ihre Schatten wirft. In Wutsch’ang stand auf einer Höhe über dem majestätisch sich ausbreitenden Strom der Turm der gelben Kraniche, ein Gebäude, das die schönste Aussicht stromauf und stromab bot und das selbst als Wahrzeichen der Stadt in seiner architektonischen Schönheit zu den berühmten Orten Chinas gehörte. Wie so manches berühmte Gebäude brannte es vor einigen Jahrzehnten ab. An seiner Stelle wurde nun ein modern europäisches Backsteingebäude im Stil einer Garnisionskirche gebaut, das zum Empfang von fremden Gästen dienen sollte und dessen groteske Hässlichkeit die ganze Gegend verdirbt. Dabei war der Erbauer dieser Scheußlichkeit ein Mann, der ein feines Kunstverständnis besaß in allem, was chinesische Dinge anlangte. Das ist das Entsetzliche an dieser Kulturkombination, dass die europäische Zivilisation immer in ihren hässlichsten und gemeinsten Erscheinungen, billig und schlecht, sich ausbreitet und die einheimische Kultur im Keim vergiftet. Von hier aus kann man die Feindschaft gerade der feinsinnigen und gebildeten Gelehrten, wie der Mitglieder jener Ts’ing Liu Tang, die sich dem Eindringen europäischer Kultur vergeblich entgegengestellt hatten, verstehen.
Dieses mittelchinesische Zentrum hat übrigens weiter unten am Yangtse, in Nanking, noch eine Stadt, die ebenfalls der Sitz eines Generalgouverneurs war. Nanking, die südliche Hauptstadt, die einst der Sitz der Regierung des großen Ts’in Huang Ti war, umgibt mit seinen Mauern ein ungeheures Areal, in dem Hügel und Flächen sich abwechseln. Aber es ist seit den schrecklichen Zerstörungen, die im Gefolge der Taipingrebellion über die Stadt hereinbrachen, ein verödeter Platz. Eigentlich war ihm schon das Urteil gesprochen, seit Yunglo, der dritte Herrscher der Mingdynastie, aus strategischen Gründen die Hauptstadt nach Norden, Peking, verlegt hatte. Aber zu dem Bezirk von Nanking gehört Schanghai, die Weltstadt, in der Nähe der Yangtsemündung, und diese Stadt gibt der ganzen Gegend ihr Gepräge. Es ist selbstverständlich, dass hier, wo die ungeheuren Aktienunternehmungen wie die Commercial Press, eine Druckerei, die zu den umfangreichsten der ganzen Welt gehört, und alle die vielen teils chinesischen, teils europäischen Handels-, Schifffahrts- und Industrieunternehmungen sich befinden, die ganze Reformfrage ein wesentlich akuteres Aussehen von Anfang an hatte als in den mehr im Innern gelegenen Zentren. Schanghai ist sozusagen das Laboratorium, in dem auf wirtschaftlichem und industriellem Gebiet die Synthesen ausprobiert werden zwischen östlichen und westlichen Kulturformen. Wenn Peking auch stets der intellektuelle Mittelpunkt ist, so ist Schanghai in praktischer Hinsicht dem übrigen China immer um einen Schritt voraus.
Das dritte Zentrum der Reformbewegung ist Kanton. Die Südprovinzen liegen von den alten Mittelpunkten chinesischer Kultur abseits. Sie sind erst verhältnismäßig spät in den Umkreis des chinesischen Geistes einbezogen worden. Auch rassenmäßig findet sich ein gewisser Unterschied. Obwohl die meisten der Familiennamen auf chinesischen Ursprung hinweisen und auch der Dialekt eine sogar ursprünglichere, weniger abgeschliffene Form des chinesischen Sprachstammes darstellt, so sind die Menschen doch viel südlicher, heißblütiger, radikaler, abergläubischer als im Norden. Es ist daher kein Zufall, dass der chinesische Kulturzusammenhang sich hier am lockersten erweist und gerade von hier aus der Hauptstrom der Auswanderer nach dem Süden und Osten sich ergießt, der die Inselwelt Südasiens mehr und mehr unter wirtschaftliche Kontrolle bringt, ganz einerlei, wer die politischen Herrscher sind. In Niederländisch-Indien, ebenso wie in den englischen Straits-Settlements, dehnt sich der Einfluss der chinesischen Ansiedler auf wirtschaftlichem Gebiet immer mehr aus, und seit nun in Schanghai eine große Unterrichtsanstalt für Auslandschinesen gegründet ist, werden diese Kreise auch immer mehr kulturell zusammengefasst.
Aber diese Südprovinzen sind zugleich der Sitz radikaler Bewegungen. Hier hatte der Taipingaufstand seinen Anfang und von hier aus waren die radikalen Reformer K’ang Yu We und Liang K’i Tsch’ao nach Norden gekommen. Hier bildete sich nun auch ein Auslandsstudententum aus, das nicht für den Bestand der chinesichen Kultur, sondern für die Dynastie selbst gefährlich werden sollte.
Die von der Kaiserin-Witwe und ihren Ratgebern eingeleiteten Bildungsreformen litten nämlich an Systemlosigkeit. Während die Reform in Japan, ausgehend von einer Handvoll festentschlossener, zielbewusster und vollkommen geheim arbeitender Männer, nach einem beinahe mathematisch ausgezirkelten Plane, Schritt für Schritt zur Ausführung kam, waren die Verhältnisse in China viel chaotischer. Es gab in China unter den großen Führern der Nation niemand, der die nötigen Detailkenntnisse für die einheitliche Durchführung einer so ungeheuren Aufgabe gehabt hätte. Man darf ja nicht vergessen, dass die Aufgabe in China weit schwieriger war als in Japan, dessen übersichtliche Verhältnisse höchstens einer bis zwei der einzelnen chinesischen Provinzen gleichkamen. Außerdem handelte es sich in China nicht wie in Japan einfach um einen Wechsel des Gewandes, sondern um eine Neugestaltung aus der Tiefe heraus. Man hätte denken sollen, dass China, wenn es selbst die Männer noch nicht besaß, die die positiven Kenntnisse für eine solche Reform hatten, zu der Auskunft Japans hätte greifen können und ausländische Berater in umfangreichem Ausmaß hätte anstellen können, die dann die Verantwortung für die richtige Durchführung der Reformen gehabt hätten.
Auch dies ist nur bis zu einem gewissen Grad geschehen. Da und dort wurden wohl Ratgeber für die Reformen beigezogen, aber man gab ihnen nie volle Gewalt, so dass sie doch ziemlich gehemmt waren. Verschiedene Gründe lassen sich dafür angeben. Einmal war die Fühlung zwischen China und den fremden Ländern noch nicht so weit hergestellt, dass die Möglichkeit vorhanden gewesen wäre, die geeigneten Leute unmittelbar auszuwählen. Zudem gab es in diesen Ländern ja wohl Fachkenner, aber keine solchen, die zugleich mit den chinesischen Verhältnissen und Bedürfnissen so vertraut waren, dass sie vor groben Missgriffen absolut sicher gewesen wären. Man musste also die heranzuziehenden Ratgeber den in China anwesenden Fremden entnehmen. Hierfür kamen in erster Linie die Zollbeamten und die Missionare in Betracht.
Der chinesische Seezoll ist eine Einrichtung von Sir Robert Hart, die jahrzehntelang als Verwaltungskörper geradezu musterhaft funktioniert hat. Auch die Postverwaltung und später die Salzverwaltung haben sich in dieser Hinsicht recht gut bewährt. Man kann auch nicht sagen, dass diese Körperschaften infolge ihrer fremden Beamten die Politik der fremden Nationen mehr als die Chinas betrieben hätten. Dafür war schon durch die bunte Zusammensetzung des Stabes gesorgt, der eine starke Einheit außerhalb der nationalen Schranken bilden musste, wenn er überhaupt bestehen wollte. Diese Solidarität hat sich auch recht gut bewährt. Erst im Weltkrieg ist sie in die Brüche gegangen, und die deutschen Angehörigen dieser Behörden wurden brutal entfernt. Das ist natürlich aufs Tiefste zu beklagen, wenn auch hier gewiss ist, dass die Nemesis ihren Lauf nehmen wird: Was mit den Deutschen zuerst geschah, wird mit den anderen fremden Staatsangehörigen über kurz oder lang auch geschehen. Man kann wohl sagen, dass der chinesische Seezoll in seiner bisherigen Form im Weltkrieg prinzipiell den Todesstoß bekommen hat.
Wenn nun aber der Seezoll als wirtschaftliche Behörde in China sehr gut gewirkt hat, so kann man doch, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, nicht sagen, dass er als Keimzelle für die übrigen Reformeinrichtungen in Betracht gekommen wäre. Als wirtschaftliche, verhältnismäßig wohlbegrenzte Einrichtung vertrug er wohl zur Not die starke Selbstständigkeit der fremden Beamten, die der chinesischen Regierung gegenüber sehr souverän mit den von ihnen eingezogenen Geldern verfuhren. Auf anderen Gebieten hätte ein solcher Staat im Staate den Tod der chinesischen Unabhängigkeit bedeutet. Sir Robert Hart hat auch die Gelegenheit, die ihm bei der Begründung der Hochschule T’ung Wen Kuan in Peking gegeben war, nicht so benützt, dass daraus wirklich eine musterhafte Anstalt geworden wäre. Erst nach langen, schwierigen Arbeiten ist unter chinesischer Leitung allmählich die jetzige Peking-Universität an ihre Stelle getreten. Auch die Missionare konnten sich bei allem guten Willen häufig von den christlichen Beschränkungen nicht ganz los machen. Die von ihnen geleiteten Universitäten hatten alle die Tendenz, den Christen irgendwelche Prärogativen zu geben. Wo ein Einzelner weitsichtiger gewesen wäre, wurde er von den Übrigen aufs gehässigste angegriffen. So war der alte, ehrwürdige D. Martin, der ein gutes Wort für den Ahnendienst einzulegen wagte – der nebenbei bemerkt in Japan keine Missionsschwierigkeit gemacht hat –, lange Jahre hindurch verfemt und geschmäht.
Man musste irgendwie seinen Weg im Ungewissen vorantasten. Es entstanden Schnellpressen, um das nötige Lehrermaterial auszubilden. Ein Raritätenkabinett und Panoptikum unter Leitung eines englischen Missionars in Tsinanfu genoss allgemeine Hochachtung, und man nahm sogar die Predigten in Kauf, die man über sich ergehen lassen musste, ehe man zugelassen wurde zum Anblick der Wunder des Westens.
Daneben wurden Studenten ins Ausland geschickt, um dort die neue Wissenschaft an der Quelle zu trinken. Aber auch hierin herrschte kein System. Erst als Amerika den Überschuss der Boxerindemnität an China zurückgab, damit jährlich eine Anzahl chinesischer Studenten in amerikanische Universitäten geschickt werden, begann eine wirklich wissenschaftliche Ausbildung der chinesischen Jugend. Das aber war erst später. Zunächst wandte sich der große Strom der Lernbegierigen nach Japan. Man kann nicht sagen, dass Japan der ihm hieraus entstehenden Aufgabe gewachsen gewesen wäre. Allerdings muss man zugunsten Japans anführen, dass der Andrang die ordentliche Aufnahmefähigkeit der japanischen höheren Schulen bei Weitem überstieg. So mischte sich private Tätigkeit oft recht zweifelhafter Art in den Betrieb. Gleichzeitig waren die Sendboten der chinesischen Revolution unter den jungen Leuten tätig. Es gab mancherlei Konflikte, und schließlich kamen die meisten wieder zurück, nicht sehr wesentlich gefördert an Kenntnissen, aber reif für die Revolution.
Viertes Kapitel
Die Revolution
Während die Dinge in China immer chaotischer wurden, starb mit der Kaiserin-Witwe Tsi Hsi die einzige starke Persönlichkeit, die imstande gewesen war, die Verhältnisse nach einheitlichen Gesichtspunkten zu regeln und den Ehrgeiz einzelner Satrapen so weit zu dämpfen, dass keine Gefahr für die Gesamtheit erwuchs. Sie war es auch gewesen, die die Reformen gegen die sehr widerstrebenden Mandschukreise und ihren Anhang in der Hauptstadt mit großer Energie vertreten hatte. Bei dem ungeheuren passiven Widerstand dieser Leute, die naturgemäß ihre ganze Drohnenexistenz aufs Spiel gesetzt sahen, wenn die Reformen nicht wirksam sabotiert werden konnten, war ohne eine solche Persönlichkeit von ganz überragender Kraft nicht daran zu denken, dass etwas wirklich Gründliches sich durchsetzen werde.
Der Tod der Kaiserin-Witwe trat nach einer längeren Krankheit ein. Unmittelbar vorher starb ihr schwacher Neffe auf dem Thron. Man hat viel davon gesprochen, dass sie ihn, als sie ihren Tod herannahen fühlte, habe ermorden lassen. Beweise dafür sind nicht vorhanden. Der Kaiser war schon lange vorher gesundheitlich sehr herunter, und selbst wenn er ermordet worden ist, kann es von seinen Feinden und den Eunuchen geschehen sein, ohne dass sie einen Auftrag dazu hatten. Schon zu Lebzeiten haben sie ihn reichlich schlecht behandelt und oft lange vor dem Tor knien lassen, wenn er seine Tante besuchen wollte. So wäre es durchaus verständlich, dass sie nicht wünschten, nach dem Tod ihrer Herrin in seine Hände zu geraten und dass sie darum der Abwendung dieses Ereignisses künstlich nachhalfen. Jedenfalls aber schien die alte Herrscherin bei Erhalt der Nachricht eher erleichtert zu sein. Sie ging nun unverzüglich daran, ihren zweijährigen Großneffen, den Sohn des Prinzen Tschun, der als Sühneprinz in Deutschland bekannt ist, zum Kaiser ausrufen zu lassen, obwohl in dem Prinzen P’u Lun und dem Prinzen Kung zwei nähere Aspiranten vorhanden waren. Aber energisch bis zuletzt setzte sie ihren Willen gegen allen Widerstand durch, dann starb sie.
Man kann nicht sagen, dass dem Prinzen Tschun, der für seinen unmündigen Sohn zunächst die Regentschaft führen musste, eine leichte Aufgabe zugefallen war. Was der Energie der verstorbenen Fürstin schon schwer geworden war, wurde für ihn doppelt erschwert, da er nicht in der durch Jahrzehnte lange Gewohnheit befestigten Stellung war, die sie eingenommen hatte, vielmehr mitten im Streit der Intrigen drin stand, die namentlich im Prinzen P’u Lun einen Mittelpunkt hatten, der sich als eine Art von Citoyen Orléans aufspielte4.
Wenn das aber auch in Betracht gezogen werden muss, so kann man doch wohl sagen, dass ihm auch die Kräfte fehlten, die zu einer so heroischen Aufgabe gehörten. Der mächtigste Mann in China war damals Yüan Schï K’ai. Zwischen ihm und dem Throne aber stand der Schatten des verstorbenen Kaisers. Es heißt, dass dieser ein Schriftstück hinterlassen habe, das, fast unleserlich geschrieben, mit folgenden Worten begonnen habe:
»Ich war der zweite Sohn des Prinzen Tschun5, als die Kaiserin-Witwe mich für den Thron erwählte. Sie hat mich stets gehasst, aber an meinem Elend während der letzten zehn Jahre ist Yüan Schï K’ai schuld. Wenn die Zeit kommt, wünsche ich, dass er unnachsichtlich enthauptet wird.«
Dieses Schriftstück wurde zwar später von der Gemahlin des Kaisers beiseite gebracht, jedoch nicht, ohne dass es vorher von unabhängigen Zeugen gesehen worden war.6 Dem Prinzregenten blieb also nur die Wahl, entweder diesen letzten Wunsch seines toten Bruders auszuführen und Yüan Schï K’ai unschädlich zu machen oder über den Toten hinwegzugehen und Yüan Schï K’ai sein volles Vertrauen offen anzubieten. Er tat das Einzige, was unmöglich war: Er reizte den Löwen aufs Äußerste, ohne ihn wehrlos zu machen. Durch ein Edikt übertrug er Yüan Schï K’ai die Beerdigung des verstorbenen Kaisers. Natürlich fand sich niemand, der ihn des Mangels an Sorgfalt dabei anklagte. Infolge davon jagte der Prinzregent Yüan Schï K’ai schimpflich aus Amt und Würden, wie man etwa einen Hausknecht wegschickt. Yüan Schï K’ai verbiss den Groll. Er zog sich in seine Heimat in Honan zurück, hielt sich still und ließ Fotografien anfertigen, wie er im Strohmantel in ländlicher Umgebung den Freuden des Angelns sich hingab, fern von der großen Welt und ihrem Treiben. Die Fotografien verschenkte er an seine Freunde. Im Stillen aber hielt er seine Fäden in der Hand. Bei Hofe hatte er einen guten Freund im Senior des Kaiserhauses, dem Prinzen K’ing, mit dem er lange Hand in Hand gearbeitet hatte, und auch sonst hatte er an allen entscheidenden Posten seine Leute sitzen. So wartete er, bis seine Zeit gekommen war. Und diese Zeit kam.
Die Mandschu-Aristokratie benützte die neuen chaotischen Verhältnisse, um ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Die Reformen drängten sich. Es wurde eine Menge Geld ausgegeben und doch nichts Wirkliches erreicht. Diese Zustände führten zu einer weitgehenden Missstimmung im ganzen Reich. Die Beamten, die einer klaren und einheitlichen Leitung von oben her entbehrten, kamen unter all den verschiedenen sich drängenden Reformedikten, für deren Durchführung sie an Ort und Stelle Gelder aufbringen sollten, in die größte Verlegenheit. Die Bande der Autorität lösten sich immer mehr. Es ist kein Wunder, dass unter diesen Umständen, da die Regierungsmaschine versagte, die Vertreter des Volkes die Neugestaltung der Verhältnisse selbst in die Hand nehmen wollten. Man wollte selbst die Mittel aufbringen, die zum Bau von Eisenbahnen und Bergwerken notwendig waren, um auf diese Weise von fremden Kapitalien unabhängig zu werden und den drückenden Verpflichtungen zu entgehen, die mit einer Finanzkontrolle des Auslandes verbunden waren.
In Peking war ein Reichsausschuss zusammengerufen worden, der als vorbereitendes Parlament dienen sollte. Aber dieser Reichsausschuss, der unter dem Präsidium des Prinzen P’u Lun stand, hatte sich sehr bald recht oppositionell gebärdet: Beschleunigte Einführung der Verfassung, verantwortliches Ministerkabinett, Kontrolle der Staatsfinanzen durch die Volksvertretung und anderes waren Forderungen, die der Regierung manche schwere Stunde bereiteten und nur durch die Vertagung des Reichsausschusses zunächst zum Schweigen gebracht werden konnten.
Wenn durch Vertagung des Reichsausschusses eine rückläufige Bewegung einzusetzen schien, so war dasselbe der Fall mit der Finanzierung der industriellen Unternehmungen durch innere nationale Anleihen. Man traute diesen Unternehmungen nicht und so kam das nötige Geld nicht zusammen. Die Regierung ihrerseits wollte so wichtige Dinge wie die großen zentralen Bahnlinien auch nicht gern in private Hände übergehen lassen. So suchte man nach einem energischen Mann, der den verfahrenen Wagen wieder ins Geleis bringen sollte. Ein solcher Mann fand sich in dem »Eisenbahnkönig« Schong Hsüan Huai, einem früheren Mitglied des Kreises um Li Hung Tschang. Als dieser seinen Einzug in Peking gehalten hatte, schienen mit einem Male die alten Zeiten wiedergekommen zu sein. Es kam zu großen Anleihen mit den Vertretern der fremden Banken. Die zentrale Bahn von Hankou nach Kanton, die das ganze Reich von Norden nach Süden durchschneiden sollte, und die Bahn von Hankou nach Setschuan, die als Querlinie von jenem Zentrum aus in die westlichen Gebiete vordringen sollte, waren im Begriff, von diesen Anleihen gebaut zu werden.