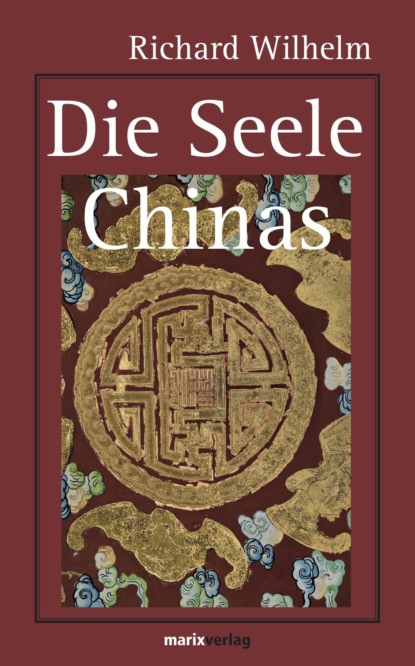- -
- 100%
- +
Die Regierung in Peking war in den Jahren 1919 und 1920 in den Händen der Partei Tuan K’i Juis, der sogenannten Anfupartei, die den Japanern sehr nahe stand. Der Präsident suchte zwischen der Anfu- und der Tschïlipartei zu lavieren, um durch das Gleichgewicht der Kräfte seine Autorität herzustellen. Aber es gelang ihm nicht. Schließlich kam es zu offenen Kämpfen zwischen der Anfu- und der Tschïligruppe, deren Feldherr Wu P’e Fu war. Wu P’e Fu siegte, obwohl Tuan K’i Jui von japanischer Seite bedeutenden Zuzug erhalten hatte. Tuan K’i J ui zog sich in die Fremdenniederlassung von Tientsin ins Privatleben zurück, um seine Zeit abzuwarten. Es ist eines der größten Hindernisse der Gesundung der chinesischen Verhältnisse, dass diese Fremdenniederlassungen, die der chinesischen Jurisdiktion entnommen sind, bestehen. Auf diese Weise wird eine Entscheidung der politischen Verhältnisse nahezu unmöglich gemacht. Wenn ein Beamter oder Parlamentarier sich seine Summe Geldes zusammengebracht hat und sich nicht mehr sicher fühlt, so flieht er mit seinem Geld nach Tientsin oder Schanghai und genießt sein Leben dort in Frieden, ohne dass die Möglichkeit vorhanden wäre, dass er von China aus zur Rechenschaft gezogen werden könnte. Ebenso zieht sich die in den Kämpfen jeweils unterliegende Partei zu den Fremdenniederlassungen ins Asyl zurück, nur um zu geeigneter Zeit aufs Neue wieder aufzutauchen.
Nach dem Siege Wu P’e Fus trat ein starker Rückgang der bisher so mächtigen Anfupartei ein. Der Hauptgrund war ihre Unbeliebtheit namentlich bei der Jugend, der ihre Japanfreundlichkeit ein Dorn im Auge war. Noch aber stand als nicht zu verachtender Gegner der Einigung mit Blut und Eisen in der Mandschurei Tschang Tso Lin. Im Frühjahr 1922 rückte er in Tschïli ein. In der Nähe von Peking kam es zur Schlacht. Tschang Tso Lin wurde besiegt. Große Teile seines Heeres gerieten in Gefangenschaft und wurden später auf Staatskosten in die Mandschurei zurücktransportiert. Aber Wu P’e Fu unterschätzte den Gegner. Er begnügte sich damit, dass er Tschang Tso Lin in die Mandschurei zurückdrängte. Englische Missionare haben sich damals eingemischt und eine Konferenz der feindlichen Führer auf einem englischen Kriegsschiff in der Nähe von Schanhaikuan bewirkt, durch die das Spiel abgebrochen wurde.
Wu P’e Fu, und durch ihn Ts’ao K’un, hatte gesiegt, und seine Herrschaft umfasste damit den Norden von der mandschurischen Grenze bis zum Yangtse ziemlich unbestritten. Weitere Kämpfe in Fukiän und Setschuan sollten das Gebiet nach Süden und Westen ausdehnen, während die schwachen Versuche Sun Yat Sens, eine »Strafexpedition« nach Norden zu unternehmen, kläglich scheiterten, da er mit seinem General Tsch’en K’iung Min in einen sehr unliebsamen Kampf geriet, der den Süden für lange Zeit hemmte.
Hsü Schï Tsch’ang legte die Präsidentschaft nieder, da er keine Möglichkeit für eine Durchführung seiner Gedanken mehr sah. Auf den verlassenen Präsidentenstuhl setzte man dann auf die weiter oben beschriebene Art den schon einmal vertriebenen Li Yüan Hung, den man solange auf dem Posten ließ, bis dieser Platz reif zu sein schien für Ts’ao K’un selbst, worauf denn Li Yüan Hung abermals vertrieben wurde.
Nur das eine war nicht zu verhindern, dass die Südprovinzen sich formell von der Zentralregierung lösten. Die tatsächlichen Verhältnisse wurden dadurch freilich nur wenig berührt, da auch von den übrigen Provinzen keine Einnahmen oder Steuern an die Zentralregierung abgeführt wurden. Vielmehr ist die Zentralregierung ziemlich ausschließlich auf die Einnahmen, die das Seezollamt ihr auszuzahlen für gut befindet, angewiesen. Diese Einnahmen stehen aber weitgehend unter der Kontrolle der alliierten Gesandten, von deren gutem Willen somit letzten Endes abhängt, ob die chinesische Regierung die ihr zustehenden Gelder ausbezahlt bekommt oder nicht. Immerhin lag es im Interesse dieser Gesandten, eine Zentralregierung in China zu haben, schon damit sie bei ihr eventuelle Beschwerden anbringen konnten.
Man kann nicht sagen, dass das Schauspiel, das von den fremden Gesandtschaften in China aufgeführt wird, besonders erbaulich ist. Es besteht in einem dauernden Druck auf die chinesische Regierung, um alle möglichen Wünsche durchzusetzen, und einem ebenso starken passiven Widerstand von chinesischer Seite, die nur nachgibt, wenn es absolut nicht anders geht. Die chinesische Regierung hat bei dieser Haltung die Sympathie des ganzen chinesischen Volkes auf ihrer Seite. Denn die verschiedenen chinesischen Parteien mögen untereinander noch so sehr entzweit sein und einander noch so heftig bekämpfen: In dem Moment, da eine ausländische Macht sich einmischen wollte, findet man sie sofort einig. Als z. B. England einmal den Schutz der von Nanking nach Tientsin führenden Bahnstrecke übernehmen wollte, um dem chinesischen Handel gegen unvorhergesehene Angriffe von militaristischer Seite beizustehen, traf es auf glatte Ablehnung der chinesischen Handelskammern, obwohl sie die erbittertsten Feinde der Militaristen sind. Dieselbe Haltung des Volkes hat sich auch bei dem Boykott und dem passiven Widerstand im Sommer 1925 gezeigt.
Auf diese Weise haben die europäischen Mächte sehr viel von ihrem Prestige verloren. England, das früher maßgebend in China war, sieht sich immer mehr in den Hintergrund geschoben. Eine Zeitlang trat Amerika sehr stark in den Vordergrund. Amerika hatte nie Landerwerbungen in China erstrebt und hatte häufig eine großzügige und entgegenkommende Haltung namentlich in Geldangelegenheiten gezeigt. Es hatte, ebenso wie China, sich geweigert, den Vertrag von Versailles zu unterschreiben, durch den China als Lohn für seine Teilnahme am Krieg gegen Deutschland zum Verlust der Provinz Schantung verurteilt wurde, die an Japan ausgeliefert werden sollte. Amerika hatte dann die Washington-Konferenz einberufen, um den Frieden der Welt zu befestigen. Diese Konferenz beendete de facto das englisch-japanische Bündnis, indem Amerika und Frankreich in den Verband eintraten, woraus sich dann bald die Kombination England-Amerika gegen Frankreich-Japan ergab. In Washington wurde auch zwischen China und Japan verhandelt, und mit einiger Hilfe von England und Amerika gelang es den Chinesen, das besetzte Tsingtau, die Schantungbahn und die Souveränität in Schantung von Japan wiederzubekommen. Heute befinden sich zwar noch eine Menge Japaner in Schantung, aber ihr gewaltsamer Einfluss ist gebrochen. Langsam, aber sicher bekommen die Chinesen die Zügel wieder in die Hand.
Dennoch blieb der amerikanische Einfluss nicht ungeschwächt. Es waren eben lange nicht alle Hoffnungen erfüllt worden, die Amerika erweckt hatte Die Aufhebung der Konsulargerichtsbarkeit, die in Aussicht genommen war, ist ihrer Verwirklichung noch keinen Schritt näher gekommen. Die Revision der Zollverträge wurde noch immer verschoben. Auch in den mongolischen Fragen und der Frage der südmandschurischen Bahn hat Amerika vollkommen versagt. Überall sah man sich der japanischen Vergewaltigung hilflos preisgegeben.
Dazu kam, dass nach Anschluss der fernöstlichen Republik an Sowjetrussland von Russland aus erneut eine zwar manchmal etwas laute, aber doch geschickte und entgegenkommende Politik getrieben wurde. Karachan kam nach Peking mit der Fiktion des von allen Seiten schwerbedrückten China, das in Russland seinen einzigen guten Freund habe, und nach einigem Poltern, das von chinesischer Seite sehr ruhig aufgenommen wurde, kam ein sehr günstiges russisch-chinesisches Abkommen zustande. China wird durch Russland in absehbarer Zeit nicht bolschewisiert werden, aber es hat durch Russland Rückgrat und Selbstständigkeit gewonnen.
Die Politik Japans machte in den letzten Jahren eine entschiedene Wendung durch. Den Krieg benützte Japan aufs ungenierteste um China zu knebeln und militärisch zu unterwerfen. Selbstverständlich gab es auch damals in Japan vernünftige Leute, die diese Politik missbilligten. Aber sie kamen nicht zu Wort. Die Gelegenheit, dass Japan freie Hand in Ostasien hatte, schien den damaligen Machthabern doch zu günstig. Allein die Lage Japans blieb nicht so vorteilhaft. Zu seinem Unglück siegte im Weltkrieg die Partei, auf deren Seite es gekämpft hatte, viel zu unbedingt für die japanischen Wünsche. Mit einem siegreichen, aber stark geschwächten Deutschland hätte man günstiger abschließen können. Denn das ließ sich trotz aller Bundesgenossenschaft nicht leugnen, dass man das Vertrauen der Alliierten verloren hatte. Es kam dazu, dass sich die Folgen des Krieges schwerer fühlbar machten, als man gedacht hatte. Das sibirische Abenteuer, das als Zug gegen den Bolschewismus von den Alliierten geplant, aber schließlich nur noch von Japan fortgesetzt worden war, musste liquidiert werden. Schließlich kam das Erdbeben dazu, das auf die japanische Mentalität weit tiefer und deprimierender wirkte, als das für europäische Begriffe fassbar ist. Es war in den Augen der Japaner nicht weniger als in denen der Chinesen ein Gottesurteil. So schlug denn in Japan die Stimmung um, besonders da die Verwicklungen mit Amerika und Australien immer ernster wurden. An Stelle der kriegerischen Unterwerfung Chinas fasste man eine friedliche Verständigung ins Auge.
Trotz gelegentlicher Festessen mit diesen Tendenzen ist das japanische Kultur-Liebeswerben in China zunächst auf ziemliche Kühle gestoßen. Es war ein zu ungewohntes Bild: Dieser neue Bruder, der die Friedensschalmei blies. Immerhin ergeben sich neue Perspektiven aus den letzten Ereignissen. Japan hat ja auch versucht, sich aus dem Konflikt von 1925, der durch rohe Behandlung chinesischer Arbeiter allererst entstanden war, rechtzeitig wieder herauszuziehen und England isoliert in der unangenehmen Position, boykottiert zu werden, sitzen zu lassen.
Deutschland nimmt in allen diesen Entwicklungen eine Sonderstellung ein. Es ist vollkommen desinteressiert. Das einzige Interesse besteht in der Förderung und Ausgestaltung wirtschaftlicher und kultureller Beziehungen. Es hat sich entschlossen auf den Boden der Gleichberechtigung gestellt und die Konsulargerichtsbarkeit aufgegeben. Man kann ruhig sagen, dass die gemachten Erfahrungen im Ganzen genommen durchaus nicht unbefriedigend sind. Man erkennt in China die deutsche Wissenschaft und die deutsche Tüchtigkeit an und ist gerne bereit, von beiden bei der Ausgestaltung der Zukunft Gebrauch zu machen. So hat denn die deutsche Politik dank der ruhigzurückhaltenden und überlegenen Persönlichkeit des Gesandten Dr. Boyé in der letzten Zeit entschiedene Fortschritte zu verzeichnen. Selbstverständlich kann man nicht erwarten, dass auf chinesischer Seite ein über die genannten Punkte hinausgehendes Interesse für Deutschland vorhanden wäre. Ein solches Interesse könnte erst in Betracht kommen, wenn die wiederangesponnenen Fäden zwischen Deutschland und China sehr viel fester und zahlreicher geworden sind. Die deutsche Position ist insofern günstig, als sie ein Vorangehen auf einem Weg bedeutet, auf dem die übrigen Mächte früher oder später folgen müssen; denn daran ist kein Zweifel, dass trotz allem entgegengesetzten Anschein China sich als selbstständige und gleichberechtigte Macht durchsetzen wird.
Ehe wir die neueste Phase der politischen Verhältnisse behandeln, müssen wir noch einen Blick werfen auf das, was im Norden von China und in der Mongolei vor sich ging.
Als die bolschewistische Revolution in Russland ausbrach, kam es in Ostsibirien zu Kämpfen zwischen den roten und weißen Russen. Zur Unterstützung der weißen Partei griffen die Alliierten ein, anfangs Amerikaner und Japaner gemeinsam, schließlich blieben die Japaner allein übrig. Sie waren durch die Bluttat von Nikolajewsk, wo sämtliche Japaner von den Bolschewiken getötet worden waren, besonders angereizt worden. Dass sie aber schließlich sich doch zurückziehen mussten, nachdem die roten Russen immer unwiderstehlicher vordrangen und die fernöstliche Republik mit der Hauptstadt Tschita begründeten, die sich später mit Sowjetrussland vereinigte, lag zum großen Teil daran, dass der Bolschewismus auf die japanischen Truppen überzugehen drohte und man in Japan nicht sicher war, was für Konsequenzen sich daraus noch ergeben könnten. Immerhin taten die Japaner alles, was sie konnten, um die weißen Russen wie Koltschak oder Horwart zu stützen, die dort noch kämpften.
Dasselbe geschah mit der Mongolei. Sie hatte sich von China unabhängig gemacht. Die Mongolenhäuptlinge standen der Mandschudynastie nahe und wären auch bereit gewesen, sich an einer Bewegung zu beteiligen, die zu einer Wiedereinsetzung des Mandschus geführt hätte. Aber in jenen Gegenden stand von Weißrussen der Kosakenhäuptling Semionoff mit seinem »Berater«, dem Baron Ungern-Sternberg. Diese versuchten die Mongolen für ihre Zwecke auszunutzen und manövrierten deshalb mit Vertretern der Mandschudynastie, durch die sie die Autorität über die Mongolen zu erlangen hofften – alles unter dem Segen der Japaner. Wie wenig es ihnen dabei aber um die chinesische Sache zu tun war, geht daraus hervor, dass ein Mongolenfürst, der persönlich Fühlung mit den Mandschukreisen nehmen wollte, auf grausame Weise umgebracht wurde. Man schoss ihn samt seinem ganzen Anwesen und allem, was darin war, einfach mit Artillerie in Grund und Boden, so dass nur ein Trümmerhaufen übrig blieb. Nachher entschuldigte man sich den Mandschus gegenüber mit einem Missverständnis, man habe ihn für einen Verräter und Revolutionär gehalten.
Damals sind die chinesischen Truppen der Anfupartei, die in der Mongolei die chinesischen Interessen vertreten wollten, niedergemacht worden. Ungern-Sternberg, der vielleicht weniger grausam war als pathologisch veranlagt, war bedeutender als Semionoff, dessen Gehilfe er anfangs gewesen. Vielleicht gerade infolge seiner pathologischen Veranlagung besaß er etwas Dämonisch-Machtvolles, das auf seine Umgebung faszinierend wirkte. Er glaubte sich zum Herrscher Asiens berufen wie Dschingis Khan, mit dem er das Horoskop gemein hatte. Er glaubte streng an das Schicksal und mit einer gewissen großartigen Schwermut ging er diesem Schicksal auch dann noch nach, als es zum Untergang sich wandte. In seiner Umgebung waren einige Teufel von bestialischer Grausamkeit, die er aus Aberglauben oder Gleichgültigkeit gewähren ließ, die ihn aber schließlich ins Unglück stürzten. Semionoff hatte eine feinere Witterung für die eigene Sicherheit, und als die Sache anfing, gefährlich zu werden, schickte er zuerst seine Frau mit Kisten voll Gold über die Grenze. Von diesem Gold wurde zwar einiges vom chinesischen Seezoll beschlagnahmt, der größere Teil aber kam ungestört durch. Er wollte sich dann in Amerika niederlassen, wurde aber dort in keiner Weise gewünscht. Komisch wirkte die Begründung. Semionoff hat Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen auf die bestialischste Weise morden lassen. Er war einer der gefährlichsten Räuber gewesen, die sich in jenen Gegenden herumgetrieben. Das alles fiel nicht weiter ins Gewicht. Selbstverständlich! Lief doch auch der General Howart unter alliiertem Schutz jahrelang in Peking umher und imponierte bei diplomatischen Empfängen durch seinen langen Bart. Aber Semionoff konnte keinen Trauschein beibringen, aus dem hervorging, dass er mit der Frau, mit der er zusammenlebte, einer schönen und klugen Abenteurerin, amtlich verheiratet war. So konnte man ihm, wahrscheinlich mit Recht, den Vorwurf der Bigamie machen. Damit war er natürlich in den Vereinigten Staaten unmöglich.
Schließlich gelang es den Sowjets, trotz all dieser Charakterköpfe in der Mongolei festen Fuß zu fassen, und nun geschah etwas, das als grandioser Witz der Weltgeschichte bezeichnet werden muss. Die Mongolen, deren Kulturstufe die nomadische ist, die noch unterhalb des Ackerbaus stehen, konstituierten sich als Sowjetrepublik. Und der lebende Buddha wurde Ministerpräsident! Selbstverständlich standen russische Ratgeber den einzelnen Ministerien zur Seite. Seit Russland mit China sich geeinigt hat, soll auch die Selbstständigkeit der Mongolei wieder aufhören, ebenso wie die der nordmandschurischen Eisenbahn, denn Russland liegt nur daran, dass beide Gebiete nicht von einer feindlichen Macht als Angriffsbasis benützt werden.
Während durch diese Ereignisse die Mongolei immer mehr ins Licht des allgemeinen Interesses der Welt gerückt wurde und regelmäßige Autoverbindungen durch die Wüste Gobi12 eingerichtet wurden, näherten die Verhältnisse in China sich einem neuen Konflikt. Nachdem Ts’ao K’un Präsident geworden war, sammelten sich seine Gegner, die ja an sich einander ebenso feindlich gegenüberstanden, zu gemeinsamem Angriff. Tschang Tso Lin hatte Zeit gehabt, die reichen Hilfsmittel der Mandschurei, die er als fast unumschränkter Herrscher zur Verfügung hatte, zur Reorganisation seines geschlagenen Heeres zu verwenden. Mit Japan stand er in freundnachbarlicher Verbindung, und auch mit Russland gelang in letzter Zeit eine Annäherung. Er hatte mit Sun Yat Sen und Tuan K’i Jui Fühlung genommen und auch der Truppenführer Lu von Hangtschou bei Schanghai war mit im Bunde. Auf der anderen Seite verfügte aber Wu P’e Fu ebenfalls über recht beträchtliche Hilfsmittel: Der Norden Chinas war in seiner Hand. Die Truppenführer am Yangtse hielten zu ihm. Sein bekanntester Feldherr aber war der christliche General Feng Yü Hsiang. Feng Yü Hsiang machte viel von sich reden durch seine Christlichkeit und seine stoische Einfachheit und machte damit namentlich auf seine amerikanischen Freunde großen Eindruck. Er hielt straffe Manneszucht und zeigte etwas Biederes in seinem Wesen.
Der Krieg brach in Schanghai aus, das der General Lu für sich beanspruchte, während es eigentlich zu dem Bezirk des Freundes von Wu P’e Fu, Ts’i Hsiä Yüan, gehörte. Ohne große Schwierigkeit wurde Lu besiegt, da Tschang Tso Lin versäumt hatte, rechtzeitig einzugreifen. So konnte denn Wu P’e Fu diesmal bis nach der Grenze der Mandschurei, Schanhaikuan, vorrücken, und seine Aussichten Tschang Tso Lin gegenüber waren nicht ungünstig, zumal da ja von Sun Yat Sen kaum etwas zu fürchten war.
In diesem Moment erklärte sich der christliche General Feng Yü Hsiang, der sich im Besitz von Peking befand, für neutral und ging darauf offen zu den Feinden seines Oberfeldherrn Wu P’e Fu über. Wu P’e Fu wurde nun mit leichter Mühe geschlagen und entkam nur mit knapper Not. Der christliche General vertrieb darauf den jungen Kaiser aus seinem Palast. Der Kaiser begab sich in den Schutz der japanischen Gesandtschaft. Ferner wurden auf die Ergreifung Wu P’e Fus Prämien ausgesetzt. Der Präsident Ts’ao K’un wurde verhaftet. Sein Bruder, der leitende Geist der Familie, starb plötzlich. Der Hauptmann der Leibwache Ts’ao K’uns, der zu diesem in einem anrüchigen Verhältnis stand, wurde erst seines Geldes beraubt und dann erschossen. Kurz, der Christ schaltete, als wenn er schon Kaiser von China wäre. Da kam Tuan K’i Jui, von Tschang Tso Lin mit seinen Truppen begleitet, nach Peking und übernahm ruhig und selbstverständlich die Zügel der Regierung. Der christliche General aber hielt es für geratener, sich in die Westberge zurückzuziehen und das Buch der Wandlungen zu studieren.
Nun steht Tuan K’i Jui wieder an der Spitze. An sich ein durchaus fähiger Kopf, wird sein Erfolg davon abhängen, was für Gehilfen er für das Werk der Neuorganisation Chinas gewinnt. Ein neues Kapitel der chinesischen Geschichte hat begonnen, und mit Spannung kann man seine Entwicklung erwarten.
Sechstes Kapitel
Das Neue China
Wenn man das neue China, das im Verlauf der letzten Jahrzehnte sich gebildet hat, wirklich verstehen will, so genügt es nicht, die nach außen hervortretenden politischen Verhältnisse und die zum Teil recht verwickelten Kämpfe der Militärführer zu verfolgen. In China spielt sich zurzeit eine doppelte Geschichte ab: Die Geschichte des von Europa importierten, in gegenseitigen Kämpfen sich erschöpfenden Militarismus und die Geschichte der im Stillen heranwachsenden und immer mehr Selbstbewusstsein bekommenden chinesischen Kultur. Die Führer dieser geistigen Bewegung Jung-Chinas haben sie wohl gelegentlich mit der europäischen Renaissancezeit verglichen. Jedenfalls ist sie auch eine Neugeburt auf geistigem Gebiet.
Man hatte sich in Europa eine Zeitlang daran gewöhnt, in China einen Riesenkomplex zu sehen, der in Jahrtausende langer Erstarrung unbeweglich daliege, von allem Fortschritt der Welt durch eine »chinesische Mauer« getrennt. Dieses kurzsichtige Urteil rührt von der Unkenntnis der innerchinesischen Verhältnisse her und von der Oberflächlichkeit der Betrachtung, auf die eine fremde Massenerscheinung immer einen gleichförmigen Eindruck macht, weil man die unterscheidenden Merkmale sowohl der einzelnen Menschen als auch ganzer Geschichtsepochen später entdeckt als die gemeinsamen Züge.
Dennoch ist die chinesische Kultur von jeher weit entfernt von monotoner Gleichartigkeit gewesen. Auf die klassische Zeit der Tschoukultur folgten immer wieder neue Epochen mit neuen selbstständigen Kulturwerten, und noch die letzten Jahrhunderte haben eine durchaus eigenartige Kulturausprägung im Aufkommen einer streng wissenschaftlichen, kritischen Philologie gehabt. Man wusste nur nichts davon in Europa, weil man sich nicht die Mühe nahm, von den alten festgetretenen Urteilsbahnen abzugehen und das neuere chinesische Geistesleben selbstständig zu durchforschen.
Zu den Vertretern der älteren wissenschaftlichen Generation gehört Tschang T’ai Yän, der nicht nur die klassische Literatur vollkommen beherrscht, sondern auch auf dem Gebiete des Mahayana-Buddhismus ein bedeutender Gelehrter ist, der aber, da er keine europäische Sprache spricht und wenig Verkehr mit Ausländern pflegt, im Westen so gut wie unbekannt ist. Er vertritt die mittelchinesische wissenschaftliche Tradition. Er gilt in China heute als der unbestrittene Führer auf dem Gebiet der literarischen Wissenschaft. Seine strenge, demokratische Gesinnung hat ihn auch der aufkommenden Jugend verehrungswürdig gemacht. Dennoch hat er auf das praktische Leben weniger Einfluss als auf das wissenschaftliche, wodurch er in eine gewisse aristokratische Vereinsamung gekommen ist.
In Südchina sind von Gelehrten, die im letzten Jahrhundert auftraten und bis in die Gegenwart hinein tätig sind, zu nennen die beiden als Reformer schon erwähnten Männer K’ang Yu We und Liang K’i Tsch’ao. Der ältere von ihnen, K’ang Yu We, ist heute ein freundlicher Greis, der da und dort in China auftritt und wieder verschwindet. Man redet lächelnd von ihm als von dem »neuen Heiligen«, womit man auf sein Verhältnis zu Konfuzius anspielt. Aber kein Mensch ahnt, welcher Vulkan hinter dem freundlich lächelnden weißhaarigen Gesicht getost hat. Wenn man im Konfuziustempel in Peking umhergeht, so findet man einen Wald von Gedenktafeln, auf denen die Namen aller derer in Stein gegraben sind, die die höchsten Prüfungen mit höchster Auszeichnung bestanden haben und dadurch aufgenommen wurden in den heiligen Bezirk der Weisen, die durch alle Jahrtausende hindurch die Lehre des Meisters Konfuzius zu verbreiten für würdig befunden sind. Einer der Namen auf der letzten Tafel ist ausgemeißelt und zur Vergessenheit verurteilt. Es ist der Name des Reformers K’ang Yu We. Er selbst war dem Zorn der alten Kaiserin entgangen, aber sein Name wenigstens sollte sterben. Er hat es sicher vom Standpunkt der alten Dame aus vollkommen verdient, nicht nur durch seine Reformtätigkeit, sondern vielmehr noch durch das, was er geschrieben hat. Er war ein arger Ketzer, dessen Lehren von denen von Marx und Lenin nicht eben sehr abweichen, wenn er sie auch als Geheimnis vor der Mitwelt, die dafür nicht reif sei, bewahrt hat.
Seine erste Revolution war eine literarische. Man hatte in den letzten Jahrhunderten sich bemüht, die alten heiligen Schriften kritisch zu sichten. Die Überlieferung besagte, dass Konfuzius diese Schriften, die dem höchsten Altertum entstammen, geordnet und herausgegeben habe als heiliges Erbe für die Zukunft. Bei den genannten Untersuchungen war man immer weiter gekommen in der Kritik. Man fand spätere Zusätze und Fälschungen, die man zunächst damit erklärte, dass durch die Bücherverbrennung des Ts’in Schï Huang Ti die ganze konfuzianische Literatur im Wesentlichen zugrunde gegangen und später erst wieder kümmerlich zusammengestellt worden sei, wobei es denn nicht fehlen konnte, dass die kaiserlichen Belohnungen, die auf das Auffinden alter Schriften gesetzt waren, auch solche Schriften ans Licht brachten, die eigens zu diesem Zweck hergestellt und künstlich alt gemacht worden waren. Diese Fälschungen galt es zu entdecken und auszusondern. K’ang Yu We wagte die Aufsehen erregende Behauptung, dass die ganzen Texte, die unter dem Namen »alte Texte« gingen, weil sie in der Hanzeit (etwa um die Wende unserer Zeitrechnung) auftauchten, bewusste Fälschungen seien, dass durch die Bücherverbrennung des Ts’in Schï Huang Ti die konfuzianischen Schriften gar nicht vernichtet worden seien und dass der Zweck der Fälschungen gewesen sei, dem Usurpator Wang Mang auf den Thron zu verhelfen. Noch hatte sich die Aufregung in der chinesischen Gelehrtenwelt über diese Lösung des gordischen Knotens nicht gelegt, da erschien ein neues Buch, das noch umstürzlerischer wirkte: »Die Reform des Konfuzius«. Darin wird versucht zu zeigen, dass die alten Schriften von Konfuzius nicht etwa überliefert und redigiert seien, sondern dass er sie alle selbstständig verfasst habe, um seinen für die damalige Zeit revolutionären Lehren einen historischen Hintergrund zu verleihen. Ob jene Heroen der alten Zeit gelebt haben oder nicht, das könne man nicht wissen. Jedenfalls seien die Überlieferungen, die durch Konfuzius auf uns gekommen sind, freie Erfindungen des Meisters. Er habe sich seine Heroen Yao und Schun ebenso geschaffen, wie Laotse den Huangti, Moti den großen Yü, Hsü Hsing den Schen Nung und wie alle Philosophen der damaligen Zeit ihre Vorbilder in die Vergangenheit projizierten. Aus dem antiquarischen Gelehrten, als den viele Konfuzius anzusehen gewohnt waren, wurde nun ein kühner Neuerer, der mit genialer Schöpferkraft eine Kultur für die Jahrtausende schuf. Die Gestalt gewann eine wunderbare mystische Tiefe. Rätselhaft blickte er aus dem Geheimnis hervor, das er mit kluger Hand um sich gewoben, und nicht mehr nur als ein Weiser der Vorzeit verdiente er Verehrung, sondern als göttlicher Heiland verdiente er Anbetung, wie Jesus sie von den Seinen erhielt. K’ang Yu We war von da ab bestrebt, eine konfuzianische Kirche zu gründen nach der Art der christlichen. Damit hat er freilich kein Glück gehabt. Die konfuzianische Kirche in Peking, von der später noch die Rede sein wird, bietet heute einen ziemlich traurigen Anblick.