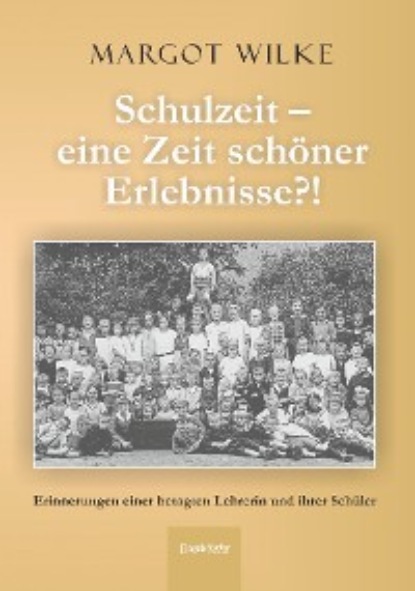- -
- 100%
- +
- bei uns war ein Rohrbruch und ich kam nicht aus der Haustür heraus.
- meine Mutter hat mich eingeschlossen.
- ich habe meine Lehrbücher nicht gefunden (er brauchte keine, denn es waren Klassensätze vorhanden).
- bei meinem Fahrrad ist der Rahmen durchgebrochen.“
„Deine Mutter hat doch auch eins!“
„Da war der Rahmen auch gebrochen!“
- ein Auto hat mich angefahren und ich musste erst medizinisch versorgt werden.
- unserer Nachbarin ist der kleine Junge aus dem Kinderwagen gefallen. Ich habe ihr erst geholfen.
- bei der Kaufhalle hat ein Lieferwagen die Kohlköpfe verloren. Da kam ich nicht vorbei und musste einen Umweg gehen.
- ich habe keine Unterrichtsbücher mit dabei, ich wusste nicht, dass ich noch am Unterricht teilnehme werde.“ (Die Schülerin hatte einen Arztbesuch und kam zur 6. Stunde)
Ich habe hier nur einige Beispiele genannt.
Mit Beginn des Schulweges mussten die Langschläfer nachdenken und somit war ihre Müdigkeit vergessen. Originell und glaubhaft wollte ich die Entschuldigung haben.
Und das Ergebnis? Wenn einer zu spät kam, wurde die Klasse munter und erwartungsvoll. Durch diese skurrilen Ausreden kam frischer Wind in die mufflige Morgenstimmung und der Unterricht konnte heiter beginnen.
Ich aber konnte nur hoffen, dass das Erfinden der verrückten Ausreden nicht zu Verspätungen animierte.
Es bringt auch Vorteile, wenn sich der Lehrer bei bestimmten Situationen den Schülern einmal anpasst.
Der Schulalltag beginnt mit dem Schulweg. Dieser war für Schüler und Lehrer sehr lang.
Bis 1976 war unsere Schule auf drei Ortsteile aufgeteilt. Der mittlere Ortsteil, zentral gelegen, war für die erste bis vierte Klasse vorbehalten. Die fünfte und sechste Klasse besuchte den 2,5 Kilometer entfernten Ortsteil und die siebente bis zehnte Klasse den 2,5 km entfernten anderen Ortsteil. So legten die Schüler ab fünfter Klasse täglich einen Schulweg von fünf Kilometer zurück, also täglich zehn Kilometer. Dies bei Wind und Wetter, bei Hitze und Kälte, bei Sturm und Regen – jahrein und jahraus. Wen wundert es, wenn zu Schulbeginn in der begehrten Zuckertüte auch eine Regenbekleidung zu finden war. Abgehärtet durch Wind und Wetter waren unsere Kinder immer gesund. Stellten andere Schulen ihren Lehrbetrieb wegen Grippeerkrankungen ein, wir nicht. Allerdings wiederum zum Ärger unserer Kinder, die dadurch nicht in den Genuss zusätzlicher Ferientage kamen. Aber auch die Lehrer, die Fachunterricht erteilten, gingen diesen Weg, allerdings in den Pausen. In zwanzig Minuten mussten sie diesen Weg nicht gehen, sondern hetzen.
Dieser Schulweg war kein gewöhnlicher Schulweg. Er führte zum größten Teil durch eine reizvolle Landschaft. Nicht nur der jahreszeitliche Wechsel war zu erleben und die Pflanzen- und Tierwelt kennen zu lernen. Nein, der kleine Bach, der sich durch die Wiesen schlängelte, bot viele Möglichkeiten für wagehalsige Unternehmen und ließ den Schulstress schnell vergessen.
Meine Gedanken wandern noch einmal diesen Weg. Erinnerungen werden wach.
Nach kurzer Wegstrecke führte der Weg über die Werrabrücke. Das Ufer an den äußeren Brückenpfeilern war damals von einem dichten Erlengebüsch überwuchert. Manch ein Passant wird sich über die zartblauen Nebel gewundert haben, die aus dem Erlengestrüpp aufstiegen. Ein Naturphänomen?
Doch nach kurzer Zeit krochen einige Bengel mit fahlem Gesicht und Bauchschmerzen hervor. Andere kamen nicht so weit. Ihr Mageninhalt war schneller und etliche Büsche wurden wohl gedüngt. Ihre ersten Zigaretten hatten ungeahnte Wirkungen zur Folge.
Von der Brücke biegt ein Weg ab und eine unendlich schöne Landschaft breitet sich aus – die endlosen Wiesen des Werratals und am Horizont der Thüringer Wald.
Jeder Tag ein anderer eindrucksvoller Anblick. Aber blühende Wiesen und die dort lebenden Tiere kümmerten wohl kaum. Eine Baustelle reizte viel mehr. Das versprach Abenteuer pur. Große Geräte und tiefe Löcher lockten mehr als Blumen und Vögel.
Der Mutsprung
Am Wasserwerk wurde gebaggert. Einsam und verlassen stand der Bagger am Wegrand. Niemand in Sicht, Verbotsschilder interessierten nicht, die Absperrung war kein Hindernis.
Die jungen Techniker besichtigten ihn eingehend, kletterten auf das schwere Gerät, begutachteten und fachsimpelten. Jeder wusste mehr und prahlte mit seinem Wissen. Die Neugier war befriedigt. Doch dann entdeckten sie die tief ausgebaggerten Löcher, voll mit gelblich-trüben, lehmigen Wasser. Jetzt erwachte der sportliche Instinkt. Diese Löcher überspringen. Das war es! Die Technik des Anlaufs war aus dem Sportunterricht bekannt. Die Weite wurde abgeschätzt und für möglich befunden. Die gelb-braune Brühe war kein Hindernis. Der Sportlehrer hätte bei diesen Weitsprungversuchen seine wahre Freude gehabt. Einer nach dem anderen schaffte es und die Sprünge wurden immer wagehalsiger. Nur einer stand abseits - der Kleinste der Gruppe. Mit dem Ranzen auf dem Rücken stand er und staunte, wie alle ihre Sprünge bewältigten. Dann bemerkten ihn die anderen. Sie forderten ihn zum Sprung auf. Aber er traute sich nicht und Hänseln war die Folge. Jetzt war er der Mittelpunkt. „Los!“
„Spring doch!“
„Traust dich wohl nicht?“
„Du schaffst es!“
„Memme!“
„Feigling!“ Pausenlos drangen diese Aussagen an sein Ohr. Feigling? Nein, das wollte er nicht sein.
Immer noch den Ranzen auf dem Rücken, nahm er Anlauf. Zögerte! Noch einmal Anlauf! Und wieder ein Zögern, diesmal den Spott im Rücken. Noch einmal Anlauf! Ein Sprung! Er war im Loch verschwunden. Er war komplett verschwunden. Er war weg! Nichts mehr zu sehen! Erstarrt standen die anderen vor Schreck. Dann handelten sie. Mit Mühen, Anstrengungen, Stangen und Brettern gelang es ihnen, den Unglücksraben aus dem Loch zu ziehen. Gemeinsam brachten sie den Lehm-Schlamm-Freund nach Hause. Bevor dieser die Wohnung betrat, wurde er auf dem Hof mit dem Schlauch abgespritzt.
Bereits auf diesem Schulweg konnten also die Schüler ihre technischen und sportlichen Interessen wahrnehmen, wenn möglich auch unter Beweis stellen.
Doch der Weg bot noch weitaus mehr Abenteuer.
Kein Anglerlatein
Eine kurze Wegstrecke floss ein Graben nebenher. Er plätscherte ruhig unter Gestrüpp und wurde kaum beachtet. Dieser Graben floss weit in die Werrawiesen bis er schließlich im Erlensee, heute versumpft, mündete. Er war der Anziehungspunkt für junge Angler. So auch für zwei Bengel, die auf dem Heimweg waren. Sie verließen den Schulweg und pirschten an diesem Graben entlang, bis weit in die Wiesen. Es war ein heißer, trockener Sommertag. Mit einer Schnur, die damals jeder Junge in der Hosentasche hatte, und einem Stock versuchten sie nahe am Erlensee Fische zu angeln. Fachgerecht wurde dieses Provisorium ausgelegt und nun warteten beide. Warteten und warteten! Kein Fisch biss an! Für Profiangler ist warten kein Problem, aber für diese beiden wurde es langweilig. Also auf, zur weiteren Exkursion rund um den Erlensee. Eine tiefgrüne, üppige, undurchdringliche Pflanzenwelt umrahmte das kleine Gewässer und lockte zum langsamen Weitergehen. Die Neugier war so groß, dass sie den immer weicher werdenden, schwankenden Wiesenboden nicht beachteten. Plötzlich stand der Freund bis zu den Hüften im Sumpf, sank langsam tiefer, bis unter die Arme. Beide allein auf weiter Flur. Mühselig zog und zog der andere den langsam Versinkenden. Angst verlieh ihm Riesenkräfte und Schweißtropfen liefen, denn die Sonne brannte unbarmherzig. Mit ungeheurer Kraftanstrengung gelang es ihm, den nicht gerade Leichtgewichtigen aus dem Sumpf herauszuziehen. Ermattet und kraftlos lagen sie auf dem festen Wiesengrund. Angel und Fische waren vergessen. Die Mittagssonne trocknete beide. Aber sie trocknete so kräftig, dass die Schlammschicht zu einer festen Kruste wurde. So mussten sie durchs Dorf. Der eine verdreckt und der andere bis unter die Arme schlammverkrustet. Zu Hause wurde der Schlammige in der Zinkwanne eingeweicht, in der Wanne mühselig ausgezogen. Erst nach dem Abspritzen mit dem Schlauch war die natürliche Hautfarbe wieder zu erkennen. Mit dem Wasser aus der Wanne konnte der Garten gewässert und gedüngt werden.
Kein langweiliger Schulweg, denn Forscher und Naturinteressierte kamen ebenfalls auf ihre Kosten.
Nach Verlassen des Ortes und Überqueren der Straße lag der letzte Teil des Weges vor den Schülern. Rechts lockte eine große Obstplantage den Vitaminbedarf zu befriedigen. Zur Erntezeit waren die Bäume am Wegrand in Kinderarmhöhe wie leergefegt. Hier wurde sich bedient, hier gab es Obst gratis. Die Besitzer ertrugen es mit Nachsicht und Humor.
Links breiteten sich Wiesen aus, durch die sich ein kleiner Bach, die Pfitz, schlängelte. Ein Wiesenbach mit großen und kleinen Steinen, der einmal flach, tief, schmal oder breit war. Hier gab es viele Möglichkeiten von wagehalsigen Mutproben oder Spiele im Bach, die sich von der 1. bis zur 6. Klasse steigerten. Durchwaten, überspringen oder von Stein zu Stein hüpfen, kleine Wehre bauen, sich auf der Wiese austoben. Besonders beliebt waren die im Unterricht heimlich aus Papier gefalteten Schiffchen, die dann in dem kleinen Bach mit einem Stöckchen Richtung Heimat gelenkt wurden. Bei diesem Manöver musste man allerdings von Stein zu Stein hüpfen. Nasse Hosen im Sommer oder steifgefrorene im Winter waren alltäglich. Aber das Meistern derartiger Situationen ergaben keine Probleme. In der Schule angekommen, wurden die nassen Schuhe ausgezogen und an den Ofen gestellt, die Strümpfe über die Blechwand gehängt, mitgebrachte Socken angezogen und der Unterricht konnte beginnen.
Da die fünfte und sechste Klasse von Fachlehrern unterrichtet wurde, mussten sie also ebenfalls diesen Weg gehen und so geschah es, dass durch den Wechsel der Lehrer die beiden Klassen manchmal in der Pause allein waren. Undenkbar? Nein! Eine Schülerin jetzt Großmutter, erinnert sich: „Wir haben gar keinen Lehrer zur Aufsicht gebraucht. Die Jungen spielten Fußball und wir Mädchen hatten Sprungseile, Bälle oder spielten Gummizwist. Beim Schippern oder Hüpfkästchen waren alle dabei. Diese Spiele gehören heute der Vergangenheit an und nur noch wir Großeltern wissen, was diese für Spaß bereiteten. Wenn dann der Lehrer kam und es geklingelt wurde, gingen wir ruhig in unsere Klassen.“ Das wäre heute undenkbar.
Eine kleine Episode, an die ich mich heute noch schmunzelnd erinnere, erlebte ich am ersten Schultag nach den großen Ferien mit einem Kleinen der 1. Klasse. Ich erkundigte mich, ob ihm der erste Schultag gefallen habe. Das Ergebnis habe ich immer noch vor Augen. Ein kleiner Kerl mit einem großen Schulranzen auf dem Rücken, blonden Löckchen und einer Brille. Mit groß aufgerissenen Augen streckte er mir die Zunge heraus. Ich musste hell auflachen. Als er in der 10. Klasse war, erzählte ich ihm diese Begebenheit und die empörte Antwort: „Ich habe ihnen doch nie die Zunge herausgestreckt.“
Diese beschauliche Zeit und somit auch der Schulweg gehörten der Vergangenheit an, als 1976 eine neue Schule gebaut wurde, in der dann die Klassen 1 bis 10 unterrichtet werden konnten.
Neue Schule – neuer Schulweg
Durch das Entstehen eines Neubaugebietes war eine neue Schule notwendig geworden und diese wurde nach einjähriger Bauzeit am 1.9.1976 übergeben. Noch am letzten Ferientag erfolgte ein Großeinsatz von Eltern, Lehrern und Kollegen des Schulamtes, um die Reste der Bauarbeiten zu beseitigen, die Fußböden zu reinigen und die Fenster zu putzen. Provisorisch pflasterte eine Baufirma einen kleinen Teil des Schulhofes.
Der erste Schultag konnte beginnen und dieser mit einem Appell. Die Schülerzahl von 200 auf rund 1000 ergaben neue Situationen und neue Probleme.
Gedanken einer Schülerin der 6. Klasse zum Eröffnungsappell: „Der Bürgermeister sprach über den Wert der Schule. Als ich hörte, wie viel dieses Gebäude gekostet hatte, war ich mächtig erstaunt.
Diese Schule kostete drei Millionen Mark. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte und wollte es nicht glauben. Was wird wohl in dieser modernen Schule anders sein als in unserer alten?“
Das sollte sie bald erfahren.
Eine Schule – kribbelbunt. Flure und Klassen waren verschiedenfarbig tapeziert. Unbeschreibliche Tapeten im gesamten Schulgebäude. Futuristische Phantasiemuster in futuristischen Farben und dazu entsprechende Gardinen Der Innenarchitekt musste wohl von einem anderen Stern gekommen sein. Aber das war noch nicht alles. Es war eine Glasfasertapete. Wenn die Schüler mit ihr in Berührung kamen oder sich an die Wand lehnten, begann das große Jucken. Es dürfte wohl jedem klar sein, dass es in den ersten Schulwochen auch dadurch eine kribblige und unruhige Atmosphäre war.
Aber das war damals noch das kleinste Problem. Ein weit größeres waren die letzten Meter des Schulweges.
Die Schule war auf Ackerland gebaut, aber der Schulhof war noch nicht begehbar, also noch Ackerland. Dieses war von schweren Baufahrzeugen tief durchwühlt und total schlammig.
Die neue Schule war eine Insel im Schlamm. Durch diesen mussten sich nun alle durchkämpfen. Dementsprechend sahen Gänge und Klassen nach wenigen Minuten aus. Für die Schüler kein Problem, für die Reinigungskräfte Schwerstarbeit. Da die Schule sowieso verschlammt war, kam es auf mehr oder weniger nicht mehr an. Also, rein in den Schlamm.
Wer bringt den meisten Dreck in die Schule? Wer kommt am schnellsten durch? Wer kann am besten waten?
Stundenlange Beratungen der Lehrer brachten keine Erfolge.
Dann kam die erste Idee: Große Steine sollten den Weg markieren. So geschah es auch. Ein neuer Spaß und Schüler sind erfinderisch. Die Steine wurden als Sprunginseln benutzt. Von Stein zu Stein springen oder von Stein zu Stein springen und schubsen. Wer hält die Balance? Beliebt war auch daneben springen. Das war doch mal ein interessanter Schulweg: Vergnügen und Gaudi, jedoch für das Schulpersonal ein Problem.
Wieder und immer wieder Beratungen, aber es änderte sich nichts.
Dann kam die zweite Idee: Bretter auf die Steine, also einen Steg anlegen. Das brachte neues Vergnügen. Es änderte sich aber nichts. Wer den Steg nicht benutzen wollte, zog über das Schuhwerk Einkaufstüten und band sie mit Bindfaden unterhalb der Knie fest. Der Schulweg blieb ein Schlammweg. Die meisten versuchten mit dieser Situation fertig zu werden. Nur einer nicht, Peter. Peter war der Sohn einflussreicher Eltern. Deshalb verlangten einige Lehrer, dass er so wie seine Eltern sein müsste, also Vorbild. Und das wollte Peter nun wieder nicht. Er wollte Schüler sein, wie die anderen. Deshalb ging er demonstrativ neben dem Steg. Nein, er ging nicht, er stapfte mühselig durch den zähen Schlamm. Es war nicht leicht, bei jedem Schritt die Füße aus dem Schlamm zu ziehen. Verschwitzt erreichte er die Schule. Ermahnungen und Strafandrohungen erfolgten. Das brachte ihm zwar zu Hause Ärger ein, aber bei seinen Schulkameraden war er für sein Elternhaus rehabilitiert und erreichte, dass er nun ein Schüler wie jeder anderer war und seine Dummheiten nicht ungestraft blieben.
Und dann kam die grandiose Idee, ein tolles Ergebnis der Beratungen. Wenn es bei Klassentreffen zu diesem Thema kommt, wird darüber gelacht und erzählt. Anscheinend gehört es mit zu den schönsten Erinnerungen, als die Anweisung kam: „Die Schüler bringen ihre Hausschuhe mit.“
Über das Wie folgten Stunden über Stunden von Vorschlägen, bis ein Ergebnis umgesetzt werden konnte. In den Gängen wurden schmale Spinde montiert und klassenweise mit den dazugehörigen Schlüssel auf die Klassen aufgeteilt. Der Wechsel der Fußbekleidung erfolgte 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn. Diese halbe Stunde war für den Hausmeister nicht nur eine harte Geduldsprobe, sondern auch Schwerstarbeit. In den Gängen wimmelte es von Hunderten von Schülern und Schuhen. Streitigkeiten mussten geschlichtet werden. Hier und dort fehlte ein Hausschuh, an anderer Stelle war wieder einer zu viel. In den Schultaschen wurden nach Schlüssel gekramt. Bei vergessenen oder fehlenden musste der Hausmeister öffnen.
Es war eine halbe Stunde Chaos. Punkt 7.30 Uhr war der Spuk vorbei. Zurück blieben verschmutzte Gänge und vereinzelte Schuhe oder Hausschuhe.
Fußballfieber
Und gerade ein Hausschuh flog durch eines der großen Fenster. Der Täter war schnell ermittelt. Und es kam zu einem Schulleiter-Schüler-Gespräch:
„Was hast du dir dabei gedacht?“
„Der Hausschuh lag da und ich wollte ihn zur Seite stoßen. Da packte mich das Fußballfieber. Ich fühlte mich auf dem Platz und sah das Tor. Ich konnte nicht anders, schoss mit Wucht – da krachte er auch schon durchs Fenster.“ Der Schulleiter, der eine Fußballmannschaft trainierte und von diesem Virus selbst infiziert war, nickte bedächtig und verständnisvoll. „Hm, was nun?“
„Eine neue Scheibe!“
„Du hast recht, aber nimm dich das nächste Mal zusammen, die Schule ist kein Fußballplatz.“ Ohne Probleme wurde eine neue Scheibe eingesetzt.
Diese Hausschuhaktion war nach Fertigstellung des Schulhofes beendet.
Heute ähnelt dieser mit seinem üppigen Grün und Bänken einem kleinen Park.
Das Wichtigste ist die Schule als Lehranstalt. Die Lehrer lehren und die Schüler lernen.
Nun gibt es humorvolle, schülerverstehende, cholerische oder gleichgültige Lehrer, aber auch bei den Schülern alle möglichen Temperamente und Einstellungen.
Zu meiner Zeit gab es keine Hauptschul- oder Förderklassen. Kein einfaches Unterfangen, denn in den Klassen waren alle Schüler, ob leistungsstarke, leistungsschwache oder hyperaktive vereint und die musste ein Lehrer unter einen Hut bringen.
Damit auch die leistungsschwachen Schüler das Klassenziel erreichen, wurden Lerngemeinschaften gebildet. Leistungsstarke Schüler halfen diesen, den Unterrichtsstoff zu verstehen. Nennen wir einmal einen Peter. Er begreift den Unterrichtsstoff nicht. Er ist nicht dumm, denn dumme Schüler gibt es nicht, nur leistungsschwache. Und das kann verschiedene Ursachen haben. Er ist schwerfällig im Denken, hat Angst und verkrampft sich. Oder er hat Angst, sich zu blamieren, keine Sympathie für die Schule (heute sagt man dazu „keinen Bock haben“) oder häusliche Probleme. Zu seinem Mitschüler hat er Vertrauen, ist offener, vielleicht beneidet er ihn auch.
Dieser erklärte es nun aus seiner Sicht mit seinen einfachen Worten. Peter begreift. Im Unterricht trotzdem schweigsam, aber das Thema ist erkannt und er kann dem weiteren Unterricht folgen. Bei schriftlichen Arbeiten hat er vielleicht mehr Erfolg.
So wurde manchem geholfen, das Klassenziel zu erreichen.
Diese Vielfalt von Schülerpersönlichkeiten erfordern vom Lehrer Einfühlungsvermögen, Verständnis, Fingerspitzengefühl und Liebe zu seinem Beruf, speziell für seine Schüler.
Ein enges Lehrer-Schüler-Verhältnis kann wesentlich zur Lernfreude beitragen und leistungsschwache Schüler zu besseren Ergebnissen motivieren. Findet er engen Kontakt auch zu diesen, wird ihm sein Beruf viel Freude bereiten.
Entscheidend für das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist die erste Stunde des Zusammentreffens. Die Schüler können sofort eine Lehrerpersönlichkeit einschätzen und das Verhältnis zu dieser bestimmen. Der erste Eindruck ist entscheidend.
Übung macht den Meister
So auch bei einem mir bekannten Kollegen. Ihm wurde mitgeteilt, er bekäme eine 7. Klasse, die schon manchen Kollegen zur Verzweiflung gebracht hätte. Er grübelte und grübelte, bis ihm der rettende Gedanke kam. Vierzehn Tage vor Schulbeginn ging er jeden Tag in den ihm zugewiesenen Klassenraum und warf von der Tür aus die Tasche auf den Lehrertisch, eine Entfernung von ungefähr zwei bis drei Meter. Die ersten Tage blieben ohne Erfolg. Doch nach und nach gelang es ihm, die Tasche so zu werfen, dass sie auf dem Tisch liegen blieb.
Der erste Schultag kam. Er stand vor der Tür und hörte die tobenden Schüler. Das Klingelzeichen ertönte. Kurzes Luftholen. Er riss zackig die Tür auf, brüllte „Ruhe!“ und warf die Tasche von der Tür aus lässig auf den Tisch. Die Schüler standen überrumpelt auf ihren Plätzen, verblüfft staunend. Er hatte durch sein lockeres, aber bestimmtes Auftreten gewonnen. Sein Training hatte sich gelohnt. Nicht auszudenken, wenn die Tasche auf dem Fußboden gelandet wäre.
Durch diese, für ihn riskante Aktion, erlangte er Achtung und Respekt.
Meine Gedanken verlassen die große, moderne Schule mit fast tausend Kindern aus allen Teilen Thüringens, den ungewohnten Situationen und Problemen und wandern noch einmal zurück in die kleine dörfliche Schule.
Die Schülerzahl war überschaubar und schwerwiegende Probleme gab es nicht. Aus heutiger Sicht war es eine gemütliche, ausgeglichene Atmosphäre. Es gab keine psychisch kranken Lehrer und Burn out war ein unbekannter Begriff. Der Unterricht verlief ohne Störungen. Kleine Verfehlungen, schlechte Noten oder vergessene Hausaufgaben brauchte man nicht einzutragen, denn traf man einen Elternteil, wurde diesem mitgeteilt, dass das Kind Probleme hatte. Dieses vertraute Verhältnis war durch das dörfliche Zusammenleben entstanden und die Eltern selbst waren Schüler unserer Schule.
Die Kinder waren, wie Kinder eben sind, mal ausgelassen und wild, aber konzentriert im Unterricht. Hyperaktive Kinder gab es nicht. Nach Schulschluss gingen sie ihren Interessen nach, spielten und stromerten durch Wald und Flur. Es gab keine Ablenkung durch Fernseher, Computer oder Handys. Ihre Freizeit bestand aus Spiel und Sport im Freien. Freilich gab es auch Raufereien. Aber diese trugen die Schüler unter sich aus.
Auf die blutigen Knie wurde ein Pflaster geklebt, sich vertragen und alles war erledigt. Der Begriff „aggressiv“ war ebenfalls unbekannt.
Streiche gab es kaum. Der Respekt vor Eltern und Lehrern war wohl zu groß.
Als sich einmal ein Schüler für eine Stunde im Schrank versteckte, war die Aufregung seitens des Kollegen, der gerade unterrichtete, groß und die Bestrafung konnte nicht streng genug ausfallen. Aber nur bei diesem Lehrer. Die Schüler hatten ihren Spaß und die anderen Kollegen schmunzelten darüber.
Im Winter war nur Lernatmosphäre, aber im Frühjahr mit den ersten Sonnenstrahlen wurden die Gemüter lebendig. Und das war verständlich. Das Dorf liegt am Fuße eine Berges. Und der lockte, da gab es kein Halten.
Wurden Schüler dieser Jahrgänge nach Streichen befragt, kommt nur eine Antwort: „Die haben wir gar nicht gemacht, aber wir sind manchmal abgehauen und haben uns auf dem Frankenstein versteckt.“
Wenn an der Tafel stand: „Der Himmel ist blau, das Wetter ist schön, Herr Lehrer, wir wollen spazieren geh’n!“, waren die Kollegen auf eine leere Klasse vorbereitet. Das schrieben wohl auch schon die Eltern und Großeltern an die Tafel. Was lag da nahe, dass der Lehrer seine Stunde auf den Berg verlegte und wohl auch jedem Stundenthema gerecht werden konnte, wenn es Biologie, Geographie, Deutsch oder Geschichte betraf.
Aber was trieb unsere Kinder dorthin. Streiche? Abenteuerlust? Oder auch Bewegungsdrang nach der langen Winterzeit?
Die Erinnerungen von heute Siebzigjährigen begannen immer gleich. „Einmal sind wir abgehauen und hoch auf den Frankenstein. Oben hatte jemand einen Garten. In diesem standen Kirschbäume und an denen hingen die schmackhaftesten Kirschen vom Ort. Die haben wir geklaut.“
„Einmal ... abgehauen und haben oben auf dem Frankeinstein Räuber und Gendarm gespielt.“
Ein beliebtes Spiel von Eltern und Großeltern übernommen.
„Einmal ... abgehauen. Das merkte der Lehrer sehr schnell. Da er jung und sportlich war, ist er hinter uns her. Wir haben ihn, da wir ja den Frankenstein kannten, immer in die Irre geführt. Er ist uns trotzdem auf den Fersen geblieben. Wir lockten ihn bis hoch, versteckten uns in dem Turm und er folgte uns immer noch. Wir kletterten von außen am Turm hinunter, schlossen ihn ein und liefen weg. Wir wissen aber bis heute noch nicht, wie er wieder herausgekommen ist. Wahrscheinlich ist er aus einem Fenster geklettert.“
„Einmal ... abgehauen, da hatten wir gestreikt. Wir sollten eine Arbeit schreiben, hatten aber am Tage zuvor schon eine große Klassenarbeit geschrieben. Da sind wir alle aufgestanden und gemeinsam aus der Klasse marschiert und dann auf den Frankenstein geflitzt.“