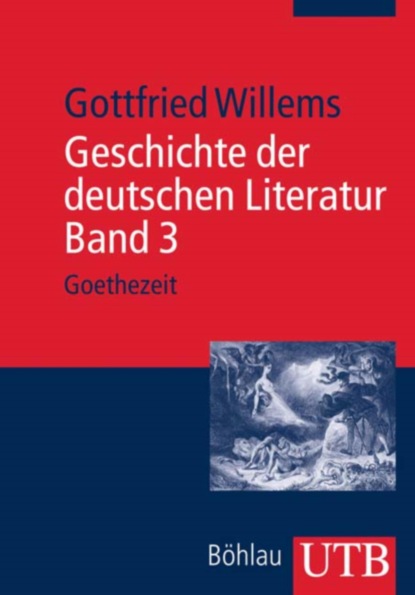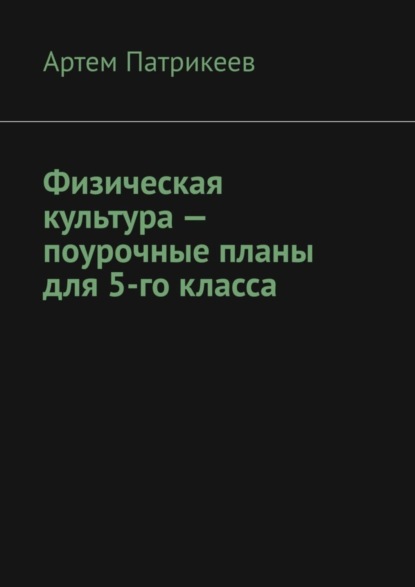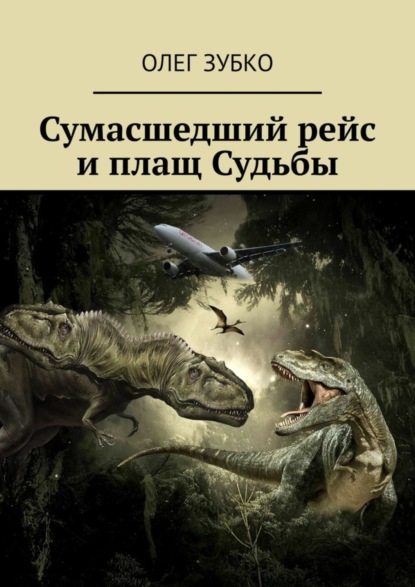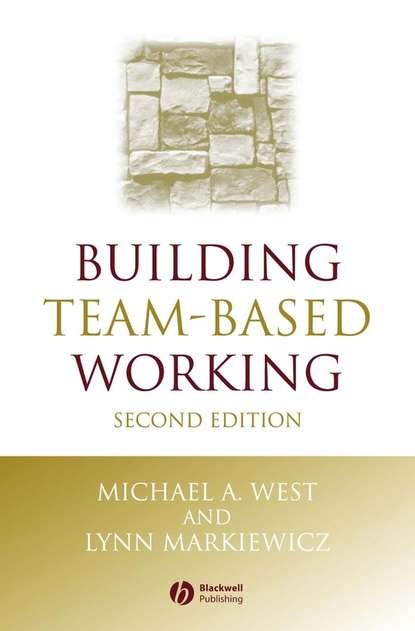- -
- 100%
- +
Die Ausarbeitung des Klassik-Mythos zur Klassik-Doktrin
Wie bereits angedeutet, entstand die Neugermanistik in zwei Schritten. Der erste Schritt war das Konzipieren von Geschichten der deutschen Nationalliteratur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Schaffung einer Geschichtsschreibung, die die Geschichte der deutschen Literatur als Geschichte einer Nationalliteratur zur Darstellung brachte.14 Bei Gervinus ist gut zu sehen, wie dieses neue Konzept umgesetzt wurde. Die ganze deutsche Literatur soll auf die Weimarer Klassik, auf das Werk Goethes und Schillers hinauslaufen. Die Literatur des Mittelalters, Luther, Opitz, Lessing – das alles sollen nur Stufen auf dem Weg hinauf zum Gipfel der Klassik gewesen sein, und seit dem Tod Goethes, ja schon mit dem altersbedingten Erlahmen seiner schöpferischen Kraft soll es mit der deutschen Literatur wieder bergab gegangen sein.15
[<< 28]
Lessing, der Sturm und Drang, die Klassik und die Romantik werden dabei als Stationen eines Prozesses verstanden, in dem der Einfluß des Auslands, insbesondere der der französischen Kultur, nach und nach immer weiter zurückgedrängt worden wäre, so daß der deutsche „Volksgeist“ immer entschiedener und bewußter zu sich selbst hätte finden können – bis dahin, daß er in Goethe und seinen Mitstreitern schließlich ganz bei sich selbst angekommen wäre und Werke hätte entstehen lassen, die als sein vollkommener Ausdruck gelten könnten. Dementsprechend erscheinen diese Werke hier als ideale Medien einer Kultur der deutschen Identität, als Werke, deren Lektüre die Deutschen ihrer nationalen Identität innewerden ließe und aus ihnen eine selbstbewußte, ihrer selbst gewisse, in sich gefestigte Nation machen würde.
Goethe selbst hat sich, wie angedeutet, in diesem Modell nicht wiedererkennen mögen und statt dessen eine Weltliteratur propagiert. Damit zog er in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts trotz seiner Verklärung zum Klassiker immer wieder Kritik auf sich, bei Romantikern wie den Brüdern Schlegel und Ludwig Tieck oder dann auch bei einigen Jungdeutschen der Vormärz-Zeit wie Wolfgang Menzel. Goethe war insofern in der ersten Hälfte des Jahrhunderts ein durchaus umstrittener Autor. Aber in der zweiten Jahrhunderthälfte hat sich diese Kritik dank der Arbeit der Neugermanisten dann wieder gelegt; die Vereinnahmung Goethes für das Konzept einer deutschen Nationalliteratur war abgeschlossen.16
Die Neugermanistik an Universität und Schule
Eine Voraussetzung für diese durchschlagende Wirkung war, daß sich die Neugermanistik damals an den Universitäten als ein eigenes Fach, als besondere akademische Disziplin hatte etablieren können, daß nun überall Lehrstühle für neuere deutsche Literatur eingerichtet worden waren – der zweite große Schritt in der Entwicklung der Neugermanistik. Zugleich wurde die neuere deutsche Literatur zu einem Gegenstand des Schulunterrichts; denn das war sie zuvor nur in engen
[<< 29]
Grenzen gewesen. Damals entstand z. B. Reclams Universalbibliothek, entstand das Institut des Reclamhefts, wie es die wachsende Nachfrage nach wohlfeilen Ausgaben literarischer Texte in Universität und Schule erkennen läßt; das Reclamheft Nr. 1 brachte 1867 bezeichnenderweise eine Ausgabe von Goethes „Faust“, der „Bibel der Deutschen“.
Die Neugermanistik zwischen klassischem Erbe und Moderne
Die Neugermanistik blieb dem Konzept der Nationalliteratur und der Ausrichtung auf die Blütezeit von Klassik und Romantik bis weit ins 20. Jahrhundert hinein treu, bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, im Osten Deutschlands nicht weniger als im Westen. Und dies, obwohl seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, seit dem Naturalismus von Arno Holz und Gerhart Hauptmann und dem Symbolismus von Stefan George, Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke eine moderne Literatur entstanden war, die die Literatur von Klassik und Romantik nicht mehr fraglos als klassisches Vorbild begriff, die alle epigonale Orientierung an der Vergangenheit hinter sich lassen und etwas ganz anderes, etwas durchaus Neues versuchen wollte; die sich vielfach auch weniger als Teil einer Nationalkultur verstand denn vielmehr als Teil einer internationalen Moderne. Für die Germanistik wurde der Siegeszug der literarischen Moderne zunächst vor allem zu einem Anlaß, auf die bleibende Bedeutung des klassisch-romantischen Erbes hinzuweisen und es als einen unverlierbaren Schatz, als einen ewigen Hort des Wahren-Guten-Schönen der fortschreitenden Modernisierung entgegenzuhalten, als unverlierbaren Halt im Wirbel der „totalen Mobilmachung“ der Moderne.
Solange die Germanistik ihre Aufgabe so sah, hatte sie natürlich keinen Grund, mit dem Begriff der „Goethezeit“, den Epochengrenzen 1770 und 1830 und dem Bild vom Entwicklungsgang der deutschen Literatur unzufrieden zu sein, das die nationale Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts gezeichnet hatte. Daß daran manches zu kritisieren sein könnte, ging ihr erst auf, als sie die Literatur des 20. Jahrhunderts, die moderne Literatur im engeren Sinne, ernst zu nehmen begann, und das heißt: als sie damit begann, diese als eine Literatur zu nehmen, die eigenen Gesetzen gehorchte und sich nicht mehr am Maß der Klassik messen ließ. Was sie seither an kritischen Überlegungen angestellt hat, kam freilich nicht nur dem Verständnis der Moderne des 20. Jahrhunderts zugute, sondern auch dem von Klassik und Romantik, ja dem aller Epochen, der
[<< 30]
älteren nicht weniger als der jüngeren. In eben dem Maße, in dem man sich von den Insinuationen der nationalen Literaturgeschichtsschreibung löste, wurde ein freierer Blick auf die gesamte deutsche Literatur möglich.
Wie sieht nun das überkommene Epochenschema im einzelnen aus, und was ist an ihm aus heutiger Sicht zu kritisieren?
2.2 Das Epochenschema der germanistischen Tradition
Von der Aufklärung zum Sturm und Drang
In seinen Grundzügen ist das Epochenschema, das die nationalistische Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhundert entwickelt hat, wohl auch heute noch jedem geläufig, der sich für die deutsche Literatur und ihre Geschichte interessiert. Die Jahre um 1770 werden da als eine Zeit der Rebellion, des kulturrevolutionären Aufstands gegen die Aufklärung und den französischen Geschmack gehandelt, als Phase des Übergangs von der Aufklärung zum Sturm und Drang, vom französischen Geschmack der Aufklärer zu dem von Johann Gottfried Herder propagierten Konzept einer spezifisch „deutschen Art und Kunst“. Als Vorläufer und Wegbereiter dieses Übergangs gilt der Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing mit seiner angeblichen Kritik am französischen Theater und seiner Umorientierung des deutschen Theaters auf das Vorbild William Shakespeares, der hier als ein Autor nordisch-germanischer Abkunft kurzerhand der „deutschen Art und Kunst“ zugeschlagen wird. In Lessing will man den großen Propheten, den Moses einer deutschen Nationalliteratur aus der Zeit vor dem Sturm und Drang erblicken.
Vom Sturm und Drang zur Klassik
Der Sturm und Drang soll 1775 mit Goethes Schritt von Frankfurt nach Weimar, mit seiner Entscheidung für den Weimarer Hof, in die Weimarer Frühklassik übergegangen sein. Der erste rebellische Impuls ist vorüber, die Ansätze zu „deutscher Art und Kunst“ werden nun dadurch weiterentwickelt, daß sich die neue deutsche Literatur erneut an der Formkultur der Antike schult. Goethes italienische Reise von 1786/88 und der Ausbruch der Französischen Revolution 1788/89 sollen dann zur Weimarer Hochklassik übergeleitet haben, mit dem Höhepunkt des „klassischen Jahrzehnts“ der Jahre 1794 bis 1805, der Zeit der Zusammenarbeit Goethes mit Friedrich Schiller.
[<< 31]
Dieses „klassische Jahrzehnt“ soll vor allem durch zwei Momente gekennzeichnet sein: durch ein vertieftes Verständnis der Kunst der Antike, wie es Goethe aus Italien mitgebracht habe, und durch die Kritik an der Französischen Revolution. Den chaotischen Formen der Modernisierung im revolutionären Frankreich sollen Goethe und Schiller das Programm einer ästhetischen Erziehung entgegengestellt haben, das statt auf Revolution auf Reform, auf eine „organische Entwicklung“ der Gesellschaft gesetzt und sich seine Ordnungsvorstellungen und seine Formbegriffe bei der Kunst der Antike besorgt habe.
Romantik und Klassik
In diesem „klassischen Jahrzehnt“ sieht man freilich zugleich auch die Romantik entstehen, mit der Jenaer Frühromantik, mit den Brüdern August Wilhelm und Friedrich Schlegel, mit Novalis und Ludwig Tieck. Nach der Verpflanzung der Romantik von Jena nach Heidelberg und Berlin soll sie um 1805 in die Hochromantik übergegangen sein, wo Autoren wie Achim von Arnim und Clemens von Brentano, Joseph von Eichendorff und E. T. A. Hoffmann den Ton angaben und nun auch einige große politische Publizisten wie Joseph Görres und Ernst Moritz Arndt als Vorkämpfer des neuen deutschen Nationalismus das Gesicht der romantischen Bewegung mit prägten. Um 1815, als sich die Romantik dank des Wirkens von Autoren wie Ludwig Uhland schließlich auch nach Süddeutschland und immer weiter durch Deutschland auszubreiten begann, soll die Hochromantik schließlich von der Spätromantik abgelöst worden sein.
Als wichtigstes Movens der literarischen Entwicklung seit 1805 gilt der Gegensatz zwischen dem klassischen Kunstprogramm Goethes und den Bestrebungen der Romantiker. Goethe und sein Anhang, so wird hier ausgeführt, orientieren sich an der heidnisch-sinnenfrohen Antike, die Romantiker hingegen an dem christlich-frommen, vergeistigten Mittelalter. Goethe kultiviert von seinem Glauben an die Natur aus eine Kunst der „Begrenzung“ und der festen Formen, die Romantiker betreiben im Namen der künstlerischen Freiheit eine Kunst der „Entgrenzung“ ins Phantastisch-Übernatürliche, Übersinnlich-Wunderbare.
Übergang zu Vormärz und Realismus
Bei Goethes Tod 1832 soll sich allerdings auch dieser Konflikt schon überlebt haben; nun soll die Generation Heinrich Heines, sollen die „Jungdeutschen“ die Szene beherrschen, wie sie eine von heftigen politischen Impulsen und konkreten politischen Anliegen geprägte Literatur gepflegt hätten – die Epoche des „Vormärz“, die nach der
[<< 32]
enttäuschenden Revolution von 1848 schließlich der literarischen Bewegung des „bürgerlichen“ oder „poetischen Realismus“ hätte weichen müssen.
Wirkung
So etwa sieht das Bild, das die Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts im Namen des nationalen Gedankens vom Entwicklungsgang der deutschen Literatur gezeichnet hat, in seinen Grundzügen aus. Trotz aller Kritik, die seither an ihm geübt worden ist, und obwohl inzwischen mehr als deutlich geworden ist, was alles schief und problematisch an ihm ist, wirkt es bis heute. Seine Spuren lassen sich bis in die Germanistik der letzten Jahrzehnte hinein verfolgen. Wo liegen nun die Schwächen und Schiefheiten dieses Epochenschemas? Was ist an ihm problematisch, und was insbesondere an seinem Kernstück, der Klassik-Doktrin? Um dem im einzelnen nachgehen zu können, sei zunächst ein Versuch unternommen, das Epochenschema vor den Hintergrund der allgemeinen geschichtlich-gesellschaftlichen Entwicklungen zu projizieren.
2.3 Geschichtlich-gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen der literarischen Entwicklung
Das „Ancien régime“
Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts herrschen in Deutschland noch immer jene Verhältnisse, die man in Frankreich, von der Französischen Revolution aus zurückblickend, das „Ancien régime“ genannt hat.17 Die Gesellschaft ist nach wie vor eine Ständegesellschaft, eine hierarchisch gegliederte, in Form einer Ständepyramide aufgebaute Gesellschaft. In ihr sind keineswegs alle Menschen vor dem Gesetz gleich; vielmehr sind die verschiedenen Stände – Fürsten, hoher und niederer Adel, hohe und niedere Geistlichkeit, Bürger, Handwerker, Bauern – mit je anderen „Privilegien“ ausgestattet, denen gemäß ihnen ein rechtlich abgestufter Anteil am politischen und gesellschaftlichen
[<< 33]
Leben zukommt. Die führende Rolle hat nach wie vor der Adel inne, auch wenn das Bürgertum als wichtigster Träger und Nutznießer der Modernisierung immer energischer nach vorne drängt. Die politische Macht liegt in der Hand monarchisch regierender Fürsten, konzentriert sich an ihren Höfen; sie unterliegt im allgemeinen keiner Kontrolle, etwa einer Kontrolle durch Parlamente, allenfalls der durch eine Ständeversammlung, die „Landstände“. Denn es gibt noch keine allgemeinen, freien und gleichen Wahlen wie heute; die Monarchen herrschen weithin uneingeschränkt, „absolut“. Deshalb spricht man hier auch von „Absolutismus“.
Die Literatur zwischen Fürstenhof und Buchmarkt
Die Fürstenhöfe sind nach wie vor die wichtigsten Förderer von Kunst und Literatur, wenn sich inzwischen auch ein Kunst-, Buch- und Zeitschriftenmarkt herangebildet hat, der den Künstlern und Literaten eine Alternative zum Leben bei Hofe oder in einer anderen Institution der Ständegesellschaft eröffnet.18 Aber von diesem Markt können die meisten von ihnen noch nicht leben. Selbst Goethe, der im Lauf seines Lebens mit seinen Büchern schon viel Geld verdient hat, geht deshalb 1775 an den Weimarer Hof und bleibt ihm sein Leben lang als fürstlicher Rat und Minister verbunden. Das Amt bei Hofe sichert ihm die Existenz, und außerdem kann er von ihm aus manches für „Kunst und Wissenschaft“ tun, nicht nur für die eigene, auch für die anderer Autoren. Kunst und Literatur sind hier also noch nicht autark; sie sind noch von Institutionen wie den Fürstenhöfen abhängig.
Doch diese Verhältnisse beginnen sich gerade in der Zeit um 1800 zu ändern. Wenn sich Goethe und Schiller noch immer einem Fürstenhof wie dem Weimarer „Musenhof“ zuordnen lassen, so kann man sich Autoren wie Jean Paul und Kleist hier kaum mehr vorstellen. Wohl hat auch ein Romantiker wie Friedrich Schlegel zunächst noch eine derartige Anbindung gesucht und sich bald in Weimar, bald bei Napoleon und bald bei dessen wichtigstem Gegner, dem Wiener Hof, um eine Anstellung bemüht – ein Zeichen der vielberufenen
[<< 34]
ideologischen Flexibilität des modernen Intellektuellen. Und selbst einen Hölderlin hat man eine zeitlang noch als Bibliothekar an dem kleinen Fürstenhof zu Homburg untergebracht.
Doch schon eine Generation später beherrschen Männer wie Heine die Szene, Autoren, die man sich eben durchaus nicht mehr an einem Hof vorstellen kann. Freilich, selbst Heine hat sich zeitweilig mit dem Gedanken getragen, bei Hofe zu reüssieren, und sich in München bei dem bayrischen König Ludwig I. um ein Amt beworben. Sein Versuch blieb aber ohne Erfolg, und man darf wohl davon ausgehen, daß er selbst dann zu einem Fehlschlag geworden wäre, wenn er gelungen wäre. Die Generation Heines, die Generation der „Jungdeutschen“ ist die erste Generation von Autoren, die sich bewußt und konsequent von den Fürstenhöfen löst. Sie braucht die Distanz zum Hof für ihre Arbeit und sucht ihr Auskommen eher im Journalismus, bei einer mehr oder weniger kritischen Presse; sie setzt mithin statt auf den Fürstenhof auf den Buch- und Zeitschriftenmarkt. Freilich finden sich selbst in dieser Generation noch Gegenbeispiele, doch wird deren Weg zum Hof nun zum öffentlichen Ärgernis und von den anderen Literaten als Verrat angeprangert. Die entscheidenden Schritte hin zur institutionellen Autonomie der Kunst sind getan.
Das „Heilige Römische Reich deutscher Nation“
Das politische Leben bewegt sich in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts noch immer in den Bahnen, die ihm durch die Verfassung des „Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation“ vorgezeichnet sind. An der Spitze des Reichs steht der Kaiser in Wien, ein Österreicher aus der Dynastie der Habsburger. Er ist das Oberhaupt eines komplexen Gebildes, das sich aus zahllosen größeren und kleineren Fürstenstaaten wie dem Staat des Herzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach zusammensetzt. Insgesamt umfaßt das Reich an die 300 Fürstentümer und souveräne Herrschaften; diese suchen sich politisch in einem Spannungsfeld zu verorten, das durch den Kaiser zu Wien, den König von Preußen, den einflußreichsten deutschen Fürsten neben dem Kaiser, und den König von Frankreich bezeichnet wird, dem mächtigsten Nachbarn des Deutschen Reichs, einem aufdringlich interessierten Nachbarn.
Aufgeklärter Absolutismus
Viele dieser deutschen Fürsten verfolgen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine aufgeklärte Reformpolitik, suchen sich mit mancherlei Reformen zu Herren jener Modernisierungsdynamik zu
[<< 35]
machen, die von der Aufklärung ausgeht. Das gilt wie für die Höfe Friedrichs II. (1712–1786) in Berlin und Josephs II. (1741–1790) in Wien, so auch für den „Musenhof“ zu Weimar, und es gilt für ihn in besonderem Maße. Der junge Herzog Carl August (1757–1828) war von einem führenden Kopf der deutschen Aufklärung, von Christoph Martin Wieland (1733–1813), erzogen und mit aufklärerischen Ideen vollgestopft worden, so daß er bei Antritt seiner Regierung 1775 nichts Eiligeres zu tun hatte, als Goethe und Herder, die Exponenten der allerneuesten Entwicklungen im Reich der „Kunst und Wissenschaft“, nach Weimar zu ziehen, um mit ihrer Hilfe eine moderne Politik zu gestalten. Das hatte übrigens zur Folge, daß der alte Adel in gewissem Maße durch Leute bürgerlicher Abkunft wie Goethe aus dem Zentrum der Macht verdrängt wurde, was in Weimar wie anderswo immer wieder böses Blut gab – der im 18. Jahrhundert allgegenwärtige Konflikt zwischen „noblesse d’épée“ und „noblesse de robe“, zwischen erblichem Blut- oder Schwertadel und neuem Amtsadel. Aber die Fäden laufen letztlich auch hier in der Hand des Fürsten, des „Souveräns“ zusammen; auch ein aufgeklärter Absolutismus ist noch immer ein Absolutismus.19
Französische Revolution
Eben gegen solche Verhältnisse sind die Männer der Französischen Revolution 20 seit 1788/89 angetreten, um dem Prinzip der „Volkssouveränität“ Geltung zu verschaffen. Nicht der Fürst, sondern das Volk sollte nun als Souverän fungieren; alle Macht sollte vom Volke ausgehen. Dieser Grundsatz sollte mit Hilfe von Verfassungen durchgesetzt werden, die die Macht an Wahlämter knüpften; sie sollte sich in Volkswahlen legitimieren müssen. Damit zog die Französische Revolution auf ihre Weise die Konsequenzen aus dem Denken der Aufklärung und den Erfordernissen der Modernisierung, aus dem aufklärerischen Prinzip der Emanzipation von der Autorität der Tradition, wie er aller Modernisierung zugrunde liegt, und dem aufklärerischen
[<< 36]
Gedanken der allgemeinen Menschennatur, der natürlichen Gleichheit aller Menschen.
„Terreur“ und Revolutionskriege
Mit solchen Neuerungen verwickelte sich der Französische Staat – vor allem nachdem er sich 1792/93 seines Königs Ludwigs XVI. entledigt und in eine Republik verwandelt hatte – in Konflikte mit den alten Monarchien um Frankreich herum. Hinzu kam, daß die revolutionären Kräfte mehr und mehr aus dem Ruder liefen und bürgerkriegsähnliche Zustände heraufführten, die schließlich in die „Terreur“, das Schreckensregime der Jakobiner einmündeten, mit Massenhinrichtungen in Paris und in der französischen Provinz. Die alten Mächte schlossen sich in Koalitionen gegen Frankreich zusammen, um die Revolution einzudämmen, wo nicht vollends aus der Welt zu schaffen. So wurden die Jahre von 1792 bis 1815 zu einer Zeit immer wieder neu aufflammender Kriege, mit einer Militärmaschinerie, wie sie die Menschheit bis dahin noch nicht gesehen hatte. Denn auch das Militär hat sich damals modernisiert. So wurde nun durch einen Revolutionär namens Barras in Frankreich die allgemeine Wehrpflicht eingeführt; deshalb geht man noch heute „zum Barras“, wenn man Soldat wird. Riesige Heere zogen kreuz und quer durch Europa, von Holland bis Italien und von Spanien bis Rußland, und das hieß naturgemäß zunächst einmal: sie zogen kreuz und quer durch Deutschland.
Das erste große Treffen in diesen Kriegen war die Schlacht bei Valmy (1792), in der sich das revolutionäre Frankreich ein erstes Mal gegen die Koalition der alten Mächte behaupten konnte. Goethe hat diese Schlacht aus nächster Nähe miterlebt; sein Herzog Carl August, der im Nebenamt auch ein preußischer General war, hatte ihn auf den Feldzug mitgeschleppt. Goethe will dabei den Anbruch eines neuen Zeitalters gespürt haben, wie wir aus einer seiner autobiographischen Schriften, der „Campagne in Frankreich“ (1822) wissen, einer ausführlichen Schilderung jener ersten kriegerischen Verwicklung der Revolutionszeit.
Deutsche Jakobiner
Nichts hat seinerzeit die Gemüter so sehr beschäftigt wie die Französische Revolution.21 Das gilt natürlich auch für die Schriftsteller, und
[<< 37]
es gilt ausnahmslos für einen jeden von ihnen. Über der permanenten Auseinandersetzung mit den Vorgängen in Frankreich vollzieht sich – vereinfacht gesprochen – eine Spaltung des intellektuellen Deutschland in drei Parteien. Eine erste Gruppe umfaßt alle die, die von Verfechtern der Aufklärung zu Anhängern der Revolution werden und die deutschen Verhältnisse nach dem französischen Vorbild umgestalten wollen, die deutschen Jakobiner.22 Jakobiner nannte man zunächst die Mitglieder eines bestimmten politischen Clubs im revolutionären Paris, einer Art politischer Partei, zu der sich die Radikalen unter den Revolutionären zusammenschlossen; ihr Wortführer war der berühmt-berüchtigte Maximilien de Robespierre (1758–1794). Später bedachte man auch alle anderen Anhänger einer radikalen Revolution mit dem Namen „Jakobiner“.
Politische Romantik
Seht euch das revolutionäre Frankreich nur genau an!, hält eine zweite Gruppe von Intellektuellen dagegen; da kann man studieren, was bei all der Aufklärerei letztlich herauskommt, wohin es führt, wenn man wie die Aufklärer mit der Autorität der Tradition bricht, altehrwürdige Institutionen, Dogmen und Normen verwirft, sogar die Religion und die Kirche in Frage stellt und nur noch auf die Natur und das Naturrecht setzt – das Ergebnis sind Chaos, Terror und Krieg. Deshalb weg mit der Aufklärung, zurück zu den alten Ordnungsstrukturen, zu Monarchie, Adelsherrschaft, Ständegesellschaft, Religion und Kirche! Dieses Denken entfaltet sich vor allem im Raum der Romantik, genauer: im Raum einer politisierten Romantik, also noch nicht so sehr in der Jenaer Frühromantik, erst in der Hoch- und Spätromantik, soweit sie über poetische Konzepte hinaus zu politischer Programmatik übergeht.23 Die romantische Verherrlichung des Mittelalters, der mittelalterlichen Frömmigkeit und der alten Ritterherrlichkeit ist mithin keineswegs eine Ausgeburt allein des poetischen Sinnes; sie hat einen politischen Unterton, den man nicht überhören darf.
Das antirevolutionäre und gegenaufklärerische Denken dieser zweiten Gruppe von Intellektuellen geht bald schon eine eigentümliche Verbindung mit dem neuen Nationalismus ein, der doch eigentlich zum
[<< 38]
ideologischen Repertoire der Jakobiner gehört. Es entsteht die Vorstellung, das Gedankengut der Aufklärung sei den Deutschen eigentlich immer wesensfremd geblieben, die deutsche Aufklärung sei im Grunde das Ergebnis einer Überfremdung der deutschen Verhältnisse durch den französischen Geist gewesen – und so viel ist daran immerhin richtig, daß die Impulse der Aufklärung, nachdem sie zunächst vor allem von England und Schottland ausgegangen waren, zuletzt mehr aus Frankreich nach Deutschland gelangt waren. Die Aufklärung, so heißt es nun, sei das Werk einer oberflächlichen Vernünftelei gewesen, eines oberflächlichen Rationalismus, der den Deutschen nie wirklich etwas hätte bedeuten können, denn der Deutsche sei seinem Wesen nach auf Tiefe hin angelegt, er neige zu metaphysischem und religiösem Tiefsinn; der Deutsche sei nicht aufgeklärt, sondern tiefsinnig. Hier der deutsche Tiefsinn – da der oberflächliche Rationalismus, die „instrumentelle Vernunft“ des aufgeklärten Frankreich.
Aufklärung „trotz alledem“
Zwischen diesen beiden Gruppen, den radikalen Anhängern und den radikalen Gegnern von Aufklärung und Revolution, hält sich eine dritte Gruppe, für die Aufklärung und Französische Revolution keineswegs ein- und dasselbe sind, auch wenn sich die Revolutionäre natürlich immerzu auf die Aufklärung berufen haben, insbesondere auf den großen Aufklärer Rousseau. Hier bekennt man sich zu einer Aufklärung „trotz alledem“, will man an den Prinzipien der Aufklärung auch und gerade angesichts dessen festhalten, was während der Revolution an Schrecklichem geschehen ist.