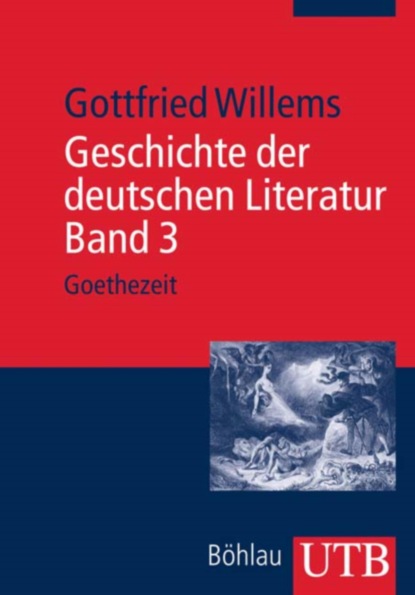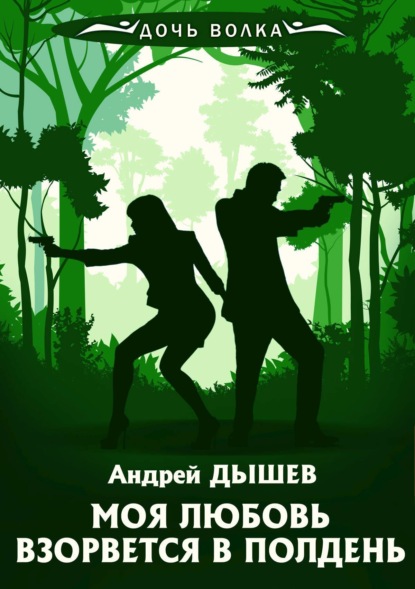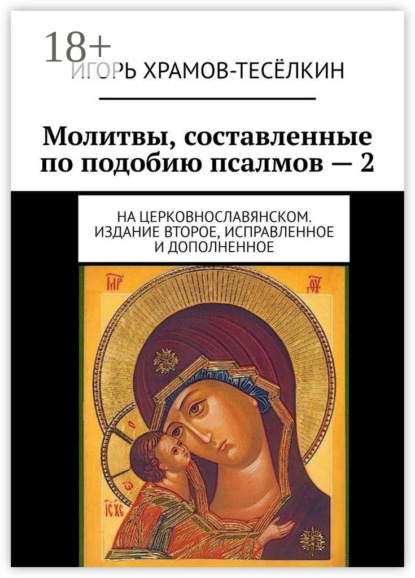- -
- 100%
- +
Zu dieser Gruppe gehören die meisten der namhaften deutschen Autoren, allen voran die Weimarer Größen: Wieland, Goethe, Herder, Schiller. Sie wollen in der Französischen Revolution nicht so sehr die logische Folge und Vollendung der Aufklärung sehen denn vielmehr einen überstürzten Versuch zur Umsetzung ihrer Ziele, einen Versuch, der wegen der Ungeduld und Radikalität der Revolutionäre drauf und dran sei, alles zu verderben, was die Aufklärung auf den Weg gebracht hatte. Die Französische Revolution gilt hier nicht als Vollendung, sondern als Desavouierung der Aufklärung, als eine Blamage, die man um so heftiger empfindet, je mehr man sich mit den Zielen der Aufklärung identifiziert.
Hier heißt Aufklärung mithin Reform und nicht Revolution; hier glaubt man, daß der aufgeklärte Kopf, gerade weil er sich am Vorbild
[<< 39]
der Natur orientiere, nicht auf den radikalen Bruch mit dem Alten setzen könne, sondern das Neue, Bessere immer nur im Zuge einer „organischen Entwicklung“ anstreben werde; daß er nicht in spektakulären geschichtlichen Aktionen die Erlösung der Menschheit von allem Übel suche, sondern in der geduldigen Arbeit an vielen kleinen Entwicklungsschritten auf pragmatische Lösungen ausgehe. Der Aufklärer, so denkt man hier, sucht immer den Mittelweg und meidet Extremismus und Radikalismus; er wirft das Alte nicht einfach über Bord, sondern weiß es differenziert zu würdigen, verwirft nur, was er als unfruchtbar erkennt, und sucht die produktiven Momente der Tradition weiterhin zu nutzen. Und in der Tat: mit dieser Sicht der Dinge ist diese dritte Gruppe von Intellektuellen näher bei der Aufklärung des 18. Jahrhunderts als die Radikalen unter den Revolutionären in Frankreich.
So bereitet es den Angehörigen dieser dritten Gruppe auch größtes Unbehagen, mit ansehen zu müssen, welche tiefen Gräben die Jakobiner und die Gegenaufklärer mit ihrem Nationalismus zwischen den Völkern aufreißen. Der aufklärerische Glaube an die natürliche Gleichheit aller Menschen verbietet es ihnen ebensowohl, eine Überzeugung wie die der Jakobiner zu teilen, daß die französische Nation mit ihrem revolutionären Modernismus allen anderen Nationen überlegen sei, wie sich auf den Gedanken der deutschen Romantiker einzulassen, daß die Franzosen von Natur aus zu einer oberflächlichen Vernünftelei geneigt seien, die Deutschen hingegen zu einem Tiefsinn, der tiefer reiche als alle französische Vernunft.
In diesem Sinne haben sich Männer wie Goethe in den Jahren nach 1789 darum bemüht, mit ihren aufklärerischen Überzeugungen Kurs zu halten, haben sie alles versucht, um die Fahne der Aufklärung weiterhin hochzuhalten. Für sie galt es, all das, was sie an der Französischen Revolution als Blamage des aufklärerischen Denkens empfanden, zu verwinden, ohne in das Fahrwasser der romantischen Gegenaufklärung zu geraten.24
[<< 40]
Napoleon
Das revolutionäre Frankreich hat sich bekanntlich bald wieder aus dem Chaos der Terreur herausgearbeitet und zu neuen Ordnungsstrukturen gefunden, vor allem dank des Revolutionsgenerals Napoleon Bonaparte, der 1799 Erster Konsul der Republik wurde und diese Republik 1804 in ein Kaiserreich verwandelte, um sich selbst zu dessen Kaiser zu krönen. Das politische System Napoleons war eine außerordentlich effiziente Mischung zwischen Errungenschaften der Revolution und dem alten Prinzip der Monarchie. So ist es Napoleon zeitweise gelungen, den größten Teil Europas zu unterwerfen; einzig bei England und Rußland blieb ihm der Erfolg verwehrt. Was Deutschland anbelangt, hat Napoleon nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt (1806) die beiden wichtigsten Mächte, Österreich und Preußen, niederwerfen und das „Heilige Römische Reich deutscher Nation“ zerschlagen können. Der Wiener Kaiser legte die deutsche Kaiserkrone nieder und nannte sich nur noch Kaiser von Österreich, weite Teile Deutschlands wurden in einem sogenannten Rheinbund an Frankreich angeschlossen, erhielten eine französische Besatzung und mußten Kontributionen und die Aushebung von Soldaten für die Kriege Napoleons über sich ergehen lassen.
Nationalromantik
Das sind nun eben die Jahre, in denen ein Großteil der Deutschen und ihrer Literatur zugleich romantisch und nationalistisch wurden, in denen sich romantische und nationalistische Vorstellungen zur „Nationalromantik“ verbanden und in den Mittelpunkt der kulturellen Bestrebungen traten. Da die politisch Interessierten unter der französischen Fremdherrschaft zur Untätigkeit verdammt waren, konzentrierten sie sich darauf, den Haß gegen die Franzosen zu schüren, und in einem Atemzug damit einen Haß auf die Revolution und die Kultur der Aufklärung, aus der sie hervorgegangen war; und sie scheuten keine theoretischen Mühen, um dem allem einen tiefen weltgeschichtlichen Sinn zu unterlegen. Zugleich widmete man sich der Besinnung auf die wahre „Deutschheit“, auf die deutsche Eigenart und die große deutsche Vergangenheit. Ein nationales Wir-Gefühl machte sich breit, wie man es bis dahin in Deutschland noch nicht gekannt hatte. Die Zerschlagung des deutschen Reichs führte dazu, daß man sich auf des alten Reiches Herrlichkeit besann, auf das Mittelalter mit seinen römisch-deutschen Kaisern und seiner Ritterherrlichkeit, seiner tiefen Frömmigkeit, seinen Kreuzzügen und
[<< 41]
vielem anderem mehr, in dem man die reine „Deutschheit“ am Werk sehen wollte. Die romantische Bewegung richtete ihren Blick nun immer fester auf die Vergangenheit, wurde immer nationaler, frömmer und konservativer.
„Befreiungskriege“ und Restauration
Dieser Geist der Nationalromantik entlud sich dann in den sogenannten „Befreiungskriegen“ von 1813/15. Napoleon wurde nach dem gescheiterten Versuch zur Eroberung Rußlands und dem Verlust der „Völkerschlacht“ bei Leipzig aus Deutschland herausgeworfen, bis nach Paris verfolgt und abgesetzt. Auf dem Wiener Kongreß (1814/15) wurde dann die europäische Staatenwelt neu geordnet. In Deutschland machte sich das „System Metternich“ breit, benannt nach dem leitenden Minister Österreichs Clemens von Metternich (1773–1858) und basierend auf der „Restauration von Thron und Altar“, der Erneuerung der alten Monarchien und Kirchen.25
Aber diese gegen die Revolution gerichtete Restauration der alten Mächte hatte denn doch einige Schönheitsfehler. Das Deutsche Reich wurde nicht wirklich wiederhergestellt, es gab keinen deutschen Kaiser mehr, nur noch einen Bund deutscher Fürsten, den „Deutschen Bund“. Die Herren der größeren deutschen Fürstenstaaten wie Bayern und Württemberg rückten die kleineren Fürstentümer und das Kirchengut nicht wieder heraus, die sie ihren Ländereien als Satrapen Napoleons hatten einverleiben können. Und die Ideen der Französischen Revolution – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Volkssouveränität, Verfassungsstaat mit gewähltem Parlament, Gleichheit vor dem Gesetz – ließen sich in den Köpfen der Menschen nicht einfach wieder ausknipsen; es blieb eine Grundunruhe in der Gesellschaft, ganz besonders aber unter den Intellektuellen und Literaten.
Viele Fürstenstaaten gaben sich nun immerhin eine Verfassung und wurden zu konstitutionellen Monarchien, als erster in Deutschland das Herzogtum Sachsen-Weimar, übrigens auf Betreiben des Herzogs Carl August selbst und gegen den Willen seines Rats Goethe. Erst später
[<< 42]
hat Goethe dafür ein Verständnis entwickelt und die Entscheidung gut geheißen, nachzulesen etwa in den „Noten und Abhandlungen zum West-östlichen Divan“ (1819). Und das „System Metternich“ überdauerte am Ende weniger durch die heilige Allianz von „Thron und Altar“ als vielmehr durch die Zensur und das Spitzelwesen, mit dem es die aufmüpfigen Intellektuellen in Schach hielt, durch die sogenannte „Demagogenverfolgung“.
Restauration und Romantik
Die Romantik hat spätestens 1815 eben jene Unschuld verloren, an deren Wiederherstellung ihr so viel gelegen war. Denn ihre Begeisterung für die Ritterwelt und die schlichte Frömmigkeit des Mittelalters konnte nun kaum mehr anders verstanden werden denn als das schöngeistige Unterfutter der „Restauration von Thron und Altar“, als ideologische Stütze des „Systems Metternich“; in den Jahren vor 1815 hatte sie immerhin noch als Protest, als Widerstand gegen das Regime Napoleons durchgehen können. In einem Punkt allerdings blieb die Romantik auch weiterhin auf Konfrontationskurs mit den Machthabern. Als „Nationalromantik“ stand sie für die Idee der deutschen Einheit ein, kämpfte sie für einen deutschen Nationalstaat, und das konnte weder Metternich angenehm sein, der in Wien dem Vielvölkerstaat Österreich mit allerlei Territorien in Tschechien, Ungarn, Oberitalien und auf dem Balkan vorstand, noch den deutschen Fürsten, denn es stellte ihre Souveränität in Frage.
Biedermeier und Vormärz
In dieser Situation wurden die Autoren des „Vormärz“,26 die „Jungdeutschen“ 27 groß, die sich einerseits der Welt der romantischen Poesie verbunden fühlten und andererseits durch die Ideen der Französischen Revolution und die antifranzösische Agitation der „Befreiungskriege“ politisiert waren. Heinrich Heine (1797–1856) hat seit 1822 Gedichte veröffentlicht, mit großem Erfolg; seine Anfänge als Autor fallen wie die der meisten Jungdeutschen also noch in die Goethezeit. Neben den Jungdeutschen machte sich in der Literatur dann auch das sogenannte Biedermeier breit, halb der Klassik und halb der Romantik
[<< 43]
verbunden, dabei aber mehr oder weniger unpolitisch, jedenfalls auf den ersten Blick.28
Die erste große Erschütterung des „Systems Metternich“ ging wiederum von Frankreich aus, mit der Juli-Revolution von 1830, die hier die „Restauration von Thron und Altar“ beendete. Der „Bürgerkönig“ Louis Philippe kam an die Macht, Frankreich wurde zum Paradies einer Bourgeoisie, die sich ganz dem wissenschaftlichen Fortschritt und dem Kapitalismus verschrieben hatte, und zugleich zu einem relativ liberalen Land mit einer lebhaften Presse. Als solches wurde es zum Exil vieler politischer Emigranten, die vor dem „System Metternich“ aus Deutschland flohen. So wich etwa Heine 1831 nach Paris aus, um dort bis zum Ende seines Lebens zu bleiben. Der deutsche Vormärz blickte nach Paris, das nun erneut zu einer Brutstätte moderner Ideen wurde.
Und damit zurück zu dem Schema literarischer Epochen, wie es von der nationalen Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts ausgearbeitet worden ist, zu der Vorstellung vom Stufengang der deutschen Literatur von der Aufklärung über den Sturm und Drang und die Weimarer Frühklassik hin zum Gipfelpunkt des „klassischen Jahrzehnts“, und von da über Hoch- und Spätromantik wieder hinab zu den Epigonen von Klassik und Romantik, zu den „Biedermeiern“ und „Tendenzdichtern“ des Vormärz, und zurück zu der Frage, wo die Probleme dieses Epochenschemas liegen.
2.4 Revision des Epochenschemas
Lessing der Vorkämpfer einer „deutschen Nationalliteratur“?
Ein erstes problematisches Moment im überkommenen Bild der Epochenfolge, das hier nur gestreift werden kann, ist die Vorstellung von Lessing als dem großen Propheten und Vorkämpfer einer deutschen Nationalliteratur in Zeiten der Aufklärung. Wohl hat sich Lessing in seiner „Hamburgischen Dramaturgie“ (1767–1769) und einigen anderen
[<< 44]
Schriften gegen das „französische Theater“ ausgesprochen und ihm das Theater Shakespeares als Gegenmodell entgegengehalten, aber was meinte er konkret mit diesem zu überwindenden französischen Theater? Es war das Theater von Corneille, Racine und ihren Nachfolgern, das Theater des Klassizismus aus den Zeiten Ludwigs XIV. (1638–1715), also aus jener Epoche, die man im Blick auf die deutsche Literatur als Barock bezeichnet. Was Lessing dagegen vorzubringen hat, ist im Kern die Kritik eines Aufklärers an der Literatur des Barock. Und bei solcher Kritik stützt er sich ausdrücklich auf gleichgerichtete Bestrebungen französischer Zeitgenossen, insbesondere auf die Theaterschriften von Denis Diderot (1713–1784), dem er in Sachen Poetik ausdrücklich einen ähnlichen Rang zuerkennt wie Aristoteles.29 Im übrigen kann das Eintreten für den englischen Autor Shakespeare wohl kaum als Plädoyer für eine spezifisch deutsche „Art und Kunst“ gewertet werden. Lessing – das ist Aufklärung gegen Barock und nicht so sehr deutsche gegen französische „Art und Kunst“.
2.4.1 Sturm und Drang und Aufklärung
Spätaufklärung
Ein zweiter Kritikpunkt betrifft die Vorstellung vom Sturm und Drang 30 als einer besonderen Epoche, als der Epoche, in der die Aufklärung ein- für allemal „überwunden“ und durch etwas typisch Deutsches abgelöst worden sei. Als die große Zeit des Sturm und Drang werden vor allem die Jahre 1770 bis 1775 genannt. Nun sind aber viele Hauptwerke der Aufklärung erst später entstanden, Lessings berühmtestes Schauspiel „Nathan der Weise“ zum Beispiel erst 1781. Auch die meisten Arbeiten des Aufklärers Wieland, der zu seiner Zeit einer der meistgelesenen zeitgenössischen Autoren in Deutschland war, sind erst nach 1770 geschrieben worden. Die siebziger, achtziger Jahre sind eigentlich die Jahre der großen Wirkung von Wieland und Lessing, und mit dieser verglichen war und blieb die Resonanz
[<< 45]
dessen, was die Stürmer und Dränger – der Straßburger Kreis um Herder, der „Göttinger Hain“ – schufen, deutlich begrenzt, mit den beiden Ausnahmen von Goethes „Götz“ und „Werther“. Um dem Rechnung zu tragen, ist inzwischen für die siebziger und achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts der Begriff der Spätaufklärung 31 eingeführt worden. Von ihm aus erscheint der Sturm und Drang als eine literarische Bewegung, der es keineswegs gelungen ist, einer ganzen Epoche ihren Stempel aufzudrücken; den Grundcharakter der Epoche hat weiterhin die Aufklärung bestimmt.
Empfindsamkeit
Im übrigen ist zu fragen, inwieweit der Sturm und Drang überhaupt im Gegensatz zur Aufklärung des 18. Jahrhunderts steht, ob in ihm nicht bloß eine Sonderentwicklung, eine Unterströmung der Aufklärung zu sehen ist. Der Schlachtruf des Sturm und Drang, wie er etwa in der Rede Goethes zum Shakespeare-Tag niedergelegt ist, der Ruf nach Natur (HA 12, 226), war ja die Losung der gesamten Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Aufgeklärt zu sein, hieß hier vor allem, „vivere secundum naturam“, hieß „take Nature’s path, and mad Opinion’s leave“ (Alexander Pope);32 es hieß, auf die Natur zu setzen, insbesondere auf das, was am Menschen Natur ist und wodurch er Teil der Natur ist, auf seine Triebnatur, seine Instinkte, seine Sinne, sein Herz und seine Einbildungskraft. Der Mensch sollte nicht mehr in einen vernünftigen und einen triebhaften, einen rationalen und einen sinnlich-emotionalen Teil aufgeteilt werden, wie das der frühmoderne Humanismus im Zeichen des christlichen Menschenbilds und des Neustoizismus getan hatte, sondern es sollte deren ständigem Ineinandergreifen nachgegangen, sollte auf das Vernünftige an Sinnlichkeit und Gefühl und auf die Offenheit der Vernunft für das Natürliche gesetzt werden. Man nennt diese grundlegenden Tendenzen der Aufklärung des 18. Jahrhunderts auch Sensualismus und Sentimentalismus.
Als der Literaturgeschichtsschreibung die Bedeutung von Sensualismus und Sentimentalismus für die Literatur der Aufklärung endlich
[<< 46]
aufgegangen war, hat sie dem zunächst dadurch Rechnung zu tragen versucht, daß sie diese in eine rationalistische und eine sensualistisch-sentimentalistische Richtung aufteilte und für letztere den Begriff der Empfindsamkeit einführte.33 Aber auch das war noch immer schief, denn die gesamte Literatur der Aufklärung ist durch sensualistische und sentimentalistische Impulse geprägt, ja gewinnt allein von ihnen her ihre epochale Eigenart. Immerhin konnte der Sturm und Drang so der Aufklärung zugeordnet werden, ließ er sich nun doch als eine Bewegung begreifen, die aus der Empfindsamkeit, aus dem aufklärerischen Sensualismus und Sentimentalismus hervorgegangen war. Es zeigte sich, daß er sein spezifisches Profil eben dadurch gewann, daß er diesen Sensualismus und Sentimentalismus auf die Spitze trieb, daß er ihnen durch die bevorzugte Darstellung großer Gefühle, großer Leidenschaften, durch die Formulierung eines Absolutheitsanspruchs des Gefühls und besonders enthusiastische Formen des Redens eine radikale Wendung gab. Damit wurde der Weg von den früheren Formen der Aufklärung zum Sturm und Drang aber aus einem quasi revolutionären Umsturz zu einem fließenden Übergang.
Irrationalismus vs. Rationalismus?
Die alte Vorstellung von der „Überwindung“ der Aufklärung durch den Sturm und Drang beruhte ja auf der Opposition Rationalismus – Irrationalismus. Der Sturm und Drang sollte eine erste Stufe auf dem Weg zur Epiphanie des deutschen Wesens darstellen, insofern er den angeblichen Rationalismus der Aufklärung als etwas Undeutsches überwunden und mit der Exponierung großer, leidenschaftlicher Gefühle den deutschen Sinn für das Irrationale, für die Tiefe, den Tiefsinn freigesetzt hätte. Aber die gesamte Aufklärung des 18. Jahrhunderts lebte von der Kritik des Rationalismus, wie er ihr durch die christliche Theologie scholastischer Prägung und den frühneuzeitlichen Humanismus, insbesondere durch dessen Neustoizismus, überliefert war; sie hat sich unausgesetzt an einer „Kritik der Vernunft“ (Kant) abgearbeitet und um die Darstellung des Menschen als empfindsames
[<< 47]
Individuum bemüht. Hat man sich dies erst einmal klargemacht – die Aufklärung des 18. Jahrhunderts hat keineswegs einem wie auch immer zu definierenden Rationalismus gehuldigt, ihr Schlachtruf war „Natur!“, ihr ging es um den Menschen als ganzen, insbesondere um seine sinnlich-empfindsame Seite – dann wird es vollends unmöglich, den Sturm und Drang als eine Gegenbewegung zur Aufklärung zu begreifen.
Präromantik
Ein weiteres Moment kommt hinzu. Die ältere Literaturgeschichtsschreibung wollte eine besonders gewichtige Neuerung des Sturm und Drangs darin erblicken, daß die Literatur von der neuen Begeisterung für die Natur her erstmals ein Interesse an ursprünglich-natürlichen Formen von Kultur entwickelt habe, insbesondere am Altertum der nordeuropäischen Völker, ein Interesse, das hier nun an die Stelle der humanistischen Orientierung am Altertum des Südens, an der griechisch-römischen Antike getreten sei. Überhaupt sei der Literatur hier in der Gestalt Herders erstmals der Sinn für Geschichte, für das Volksleben der nordischen Nationen und für ihre besonderen Überlieferungen aufgegangen, habe sie hier erstmals die poetischen Qualitäten des Volkslieds, der Volksballade und der Volkssage für sich entdeckt.
Aber das Interesse am Altertum des Nordens ist älter als der deutsche Sturm und Drang; es hat die Aufklärung im Grunde durch ihre gesamte Geschichte begleitet. Markante Beispiele dafür finden sich vor allem in England, sehr früh schon bei den englischen Aufklärern John Dryden (1631–1700) und Alexander Pope (1688–1744), und dann vor allem in den sechziger Jahren bei Männern wie Thomas Percy (1729–1811), der „Reliques of Ancient English Poetry“ (1765) sammelte, und James Macpherson (1736–1796), der in „The Works of Ossian“ (1765) altschottische Sagen bearbeitete. Man spricht in diesem Zusammenhang von „Präromantik“,34 weil sich hier schon die Interessen bemerklich machen, die später vor allem von der Romantik gepflegt worden sind. Wer über den Tellerrand der deutschen Literaturgeschichte hinausblickt, der weiß, daß sich das präromantische Interesse an Geschichte, nordischem Altertum und
[<< 48]
nordischem Volksleben nicht im deutschen Sturm und Drang, sondern in der englisch-schottischen Aufklärung Bahn gebrochen hat.
Montesquieu und Rousseau
Und nicht nur in der englischen Aufklärung, auch in der französischen fand der deutsche Sturm und Drang entscheidende Anknüpfungspunkte. So hat Herder das Programm, mit dem er zu einem der großen Mentoren des Sturm und Drang werden sollte, zu einem frühen Zeitpunkt, im „Journal meiner Reise im Jahr 1769“, einmal in die Formel gefaßt: „mit dem Geist eines Montesquieu sehen, mit der feurigen Feder Rousseaus schreiben“.35 Er wußte noch sehr genau, daß er mit seinem neuen Sinn für die Geschichte, die Vielfalt der Kulturen und der Formen des Volkslebens einen Weg beschritt, der von Montesquieu gebahnt worden war, und daß entscheidende Impulse für die „neue Beredsamkeit der Leidenschaften“ (Goethe) von Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) ausgegangen waren, daß der Sturm und Drang hierin also den neuesten Entwicklungen der französischen Literatur verpflichtet war. Übrigens wurde auch Diderot, der schon für Lessing so große Bedeutung hatte, nach Goethes Zeugnis im Straßburger Kreis um Herder eifrig studiert (HA 9, 487).
Goethes „Werther“ ein Roman der Empfindsamkeit
Der Sturm und Drang war eine literarische Bewegung, die keineswegs einer ganzen Epoche ihren Stempel hat aufdrücken können, wie von der nationalistischen Literaturgeschichtsschreibung behauptet, deren Spuren sich vielmehr bald in anderen Entwicklungen verloren, während die aufklärerisch-empfindsamen Impulse, auf denen sie beruhte, weiterwirkten, ja ihre Potentiale erst in der Zeit von Klassik und Romantik voll entfalteten. Goethe ließ auf seinen Sturm-und-Drang-„Götz“ von 1773 gleich im nächsten Jahr 1774 den „Werther“ folgen, und das ist eben ein empfindsamer Roman, der wie alle Werke der Empfindsamkeit ein empfindsames Individuum auf der Suche nach dem Natürlichen zeigt und ebensowohl vom Glück des Gefühlslebens wie von den Problemen des Gefühlsüberschwangs, den Gefahren der „Schwärmerei“ handelt. Das vermag man unschwer zu erkennen, wenn man den „Werther“ mit seinen Vorbildern und Anregern aus dem Raum der englischen und der französischen Empfindsamkeit
[<< 49]
vergleicht, mit den Romanen von Samuel Richardson (1689–1761) und Rousseau,36 oder auch mit dem Bürgerlichen Trauerspiel als einer besonders markanten Gattung der empfindsamen Literatur.37 Dem Sturm und Drang mag am „Werther“ allenfalls noch die Art und Weise zuzurechnen sein, wie der Anspruch des Gefühls in ihm auf die Spitze getrieben wird und in eine zerstörerische Leidenschaft umschlägt; Werther endet ja im Selbstmord.
Die Themen Selbstmord und Kindsmord
Doch selbst die literarische Behandlung des Themas Selbstmord im „Werther“ gehört ganz der Aufklärung an. Sie verweist auf eine Diskussion zurück, die sich durch das gesamte 18. Jahrhundert verfolgen läßt. Die Aufklärer wollten im Selbstmord nicht mehr nur eine Todsünde erblicken, wie es der christlichen Tradition entsprach, sondern auch den Ausdruck einer seelischen Notlage, deren „natürliche Ursachen“ sich ergründen ließen, bei dem es also auf ein Verständnis ankäme, das mit Mitteln der Psychologie und Soziologie der Lage und den Motiven des Selbstmörders nachginge.38 Ähnliches gilt übrigens von einem zweiten Lieblingsthema des Sturm und Drang, das noch in Goethes „Faust“, in der sogenannten „Gretchentragödie“ eine wesentliche Rolle spielt, dem Thema des Kindsmords, der Tötung eines unehelich geborenen Kinds durch seine Mutter. Auch hier will sich der Aufklärer nicht mit einem metaphysischen Verdammungsurteil begnügen, wie es der Tradition des Christentums entspricht, will er versuchen, die Lage und die Motive der Kindsmörderin von ihren „natürlichen Ursachen“ her psychologisch und soziologisch aufzuhellen.39
[<< 50]
Vom Sturm und Drang zur „Weimarer Frühklassik“
Was nun die sogenannte Weimarer Frühklassik 40 der Jahre 1775 bis 1786 bzw. 1794 anbelangt, so läßt sie sich ohne wesentliche Einbußen unter die Begriffe der Aufklärung und der Empfindsamkeit abbuchen. Daß einige aus der kleinen Gruppe von Literaten, die die Bewegung des Sturm und Drang bildeten, nun die gesamte Palette aufgeklärt-empfindsamer Themen und Formen für sich entdeckten, wie sie von der Literatur um sie herum kultiviert worden war, kann wohl kaum dazu herhalten, eine neue Epoche auszurufen. Die Kulturpolitik des Weimarer Hofs um die Herzoginmutter Anna Amalia und den Herzog Carl August, die Schaffung eines „Musenhofs“ durch die Berufung großer Geister wie Wieland, Goethe und Herder war ja ein typisches Projekt aufgeklärter Fürstenpolitik. Goethe und Herder arbeiteten, nachdem sie in Weimar angekommen waren, sofort eng mit Wieland zusammen, unbeschadet der Kontroversen und Irritationen, die zuvor ihr Verhältnis zu Wieland bestimmten; es stellte sich heraus, daß es zwischen ihnen keinen grundsätzlichen Dissens gab. Und wenn man ein Hauptwerk der „Weimarer Frühklassik“ wie Goethes „Iphigenie auf Tauris“ (1787), eine Arbeit, die Wieland intensiv begleitet und begeistert begrüßt hat, oder Herders „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ (1784–1791) und „Briefe zur Beförderung der Humanität“ (1793–1797) zur Hand nimmt, wird man unschwer feststellen, daß in Weimar damals nichts anderes als die Sache der Aufklärung und der Empfindsamkeit verhandelt wird.41