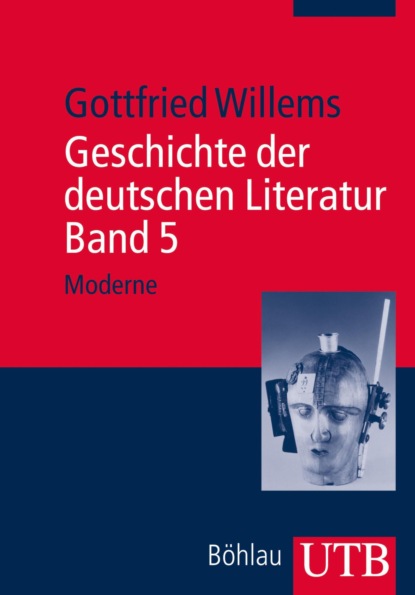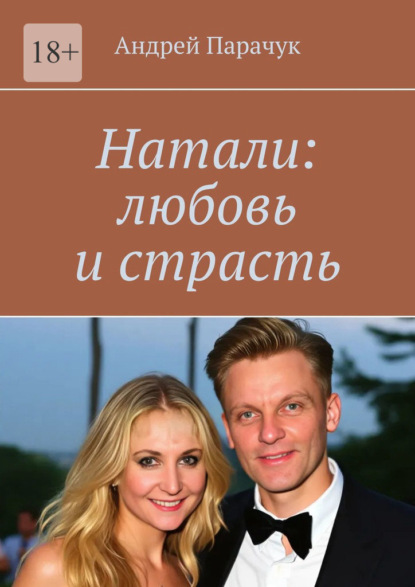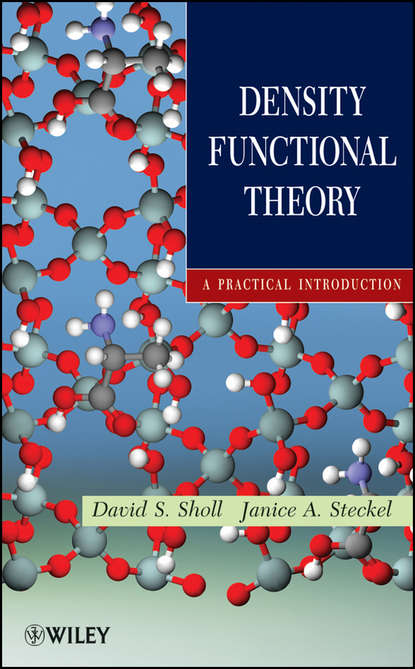- -
- 100%
- +
Eigentlich hat alles, was meine Generation diskutierte, innerlich sich auseinander dachte, man kann sagen: erlitt, man kann auch sagen: breit trat – alles das hatte sich bereits bei Nietzsche ausgesprochen und erschöpft, definitive Formulierung gefunden, alles weitere war Exegese. Seine gefährliche stürmische blitzende Art, seine ruhelose Diktion, sein Sichversagen jeden Idylls und jeden allgemeinen Grundes, seine Aufstellung der Triebpsychologie, des Konstitutionellen als Motiv, der Physiologie als Dialektik – Erkenntnis als Affekt, die ganze Psychoanalyse, der ganze Existentialismus, alles dies ist seine Tat. Er ist, wie sich immer deutlicher zeigt, der weitreichende Gigant der nachgoetheschen Epoche. (GBP 464)
So Gottfried Benn in dem autobiographischen Essay „Doppelleben“ von 1950; er will also selbst den Existentialismus, der um 1950 das Neueste auf dem Markt der „Ismen“ ist, bereits bei Nietzsche finden.
Nietzsches Kritik am HistorismusWas die erste Generation von Modernen bei Nietzsche sucht und findet, ist vor allem eines: eine philosophisch vertiefte Rechtfertigung des Bruchs mit der Überlieferung, die theoretische Sicherung ihres Versuchs, aus den soziokulturellen Mechanismen der Traditionsbildung auszubrechen. Nietzsche war wenn nicht der erste, so jedenfalls der schärfste Kritiker jenes Historismus, der im 19. Jahrhundert das kulturelle Leben beherrschte. Denn das 19. Jahrhundert setzte nicht nur auf den Fortschritt, sondern auch auf die Geschichte; wie es den Naturwissenschaften und der Technik mehr Raum gab als jedes Jahrhundert zuvor, so auch den historischen Wissenschaften und der Erinnerungskultur. In allen Bereichen der Kultur richtete es ständig den Blick zurück in die Geschichte, beschäftigte es die Menschen unausgesetzt mit den großen Zeiten, den Helden und Heldentaten der Vergangenheit, so wie in der Literatur mit der Dichtung und den Dichtern von Klassik und Romantik. Damit verband sich die Hoffnung, den Menschen in all der Bewegung, die durch den Fortschritt in die Welt gekommen war, einen Halt, eine Orientierung zu geben und die Dynamik der Modernisierung in geordnete Bahnen zu lenken – eine Rechnung, die nach Nietzsches Überzeugung nicht nur nicht aufgegangen war, sondern die verheerendsten Folgen gezeitigt hatte.
Die schlimmste Folge des Historismus ist für ihn „die historische Jugenderziehung des modernen Menschen“; so zu lesen in der „unzeitgemäßen Betrachtung“ „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“ aus dem Jahr 1874. In ihr erblickt er eine Form der Erziehung, die den jungen Menschen dermaßen mit historischem Wissen eindeckt, daß in ihm jede spontane Lebensregung erstickt wird, die zu nichts anderem gut ist, als aus ihm einen „historisch-ästhetischen Bildungsphilister“, einen angepaßten Spießer zu machen. So plädiert er am Ende seiner „Kampfschrift“ für einen Aufstand der Jugend, der Schluß macht mit der historischen Bildung und eine Kultur auf den Weg bringt, die sich nicht mehr auf die „mittelbare Kenntnis vergangener Zeiten und Völker“, sondern auf die „unmittelbare Anschauung des Lebens“ gründet, die sich überhaupt von der „Krankheit der Worte“ befreit, die nicht mehr auf Theorien und „Begriffe“ setzt, sondern auf den „Instinkt der Jugend“, und damit auf den „Instinkt der Natur“.
Die zentrale These von Nietzsches „Kampfschrift“ ist der Gedanke, daß „die Übersättigung einer Zeit in Historie“, wie sie aus dem „Glauben an das Alter der Menschheit“, dem „Glauben, Spätling und Epigone zu sein“, erwachse, „dem Leben feindlich und gefährlich“ sei, weil sie die „Instinkte“ schwäche (NSW 1, 279). Die „Austreibung der Instinkte durch Historie“ (NSW 1, 280) hat für ihn gleich auf doppelte Weise schlimme Folgen: sie verhindert die Ausbildung „starker Persönlichkeiten“, und sie lähmt die produktiven Kräfte, die originelle, lebenskräftige kulturelle Leistungen entstehen lassen. So ruft er seinen Lesern zu:
(…) vergesst den Aberglauben, Epigonen zu sein. Ihr habt genug zu ersinnen und zu erfinden, indem ihr auf (das) zukünftige Leben sinnt; aber fragt nicht bei der Geschichte an, dass sie euch das Wie? das Womit? zeige. (NSW 1, 295)
In eben diesem Sinne erhebt er „Protest gegen die historische Jugenderziehung des modernen Menschen“, fordert er, „daß der Mensch vor allem zu leben lerne, und nur im Dienst des erlernten Lebens die Historie gebrauche“ (NSW 1, 325).
Davon sind für ihn seine deutschen Landsleute besonders weit entfernt, haben sie sich doch seit langem schon in den „Widerspruch zwischen Leben und Wissen“ ergeben und vergessen,
dass die Cultur nur aus dem Leben hervorwachsen und hervorblühen kann; während sie bei den Deutschen wie eine papierne Blume aufgesteckt oder wie eine Ueberzuckerung übergegossen wird und deshalb immer lügnerisch und unfruchtbar bleiben muss. Die deutsche Jugenderziehung geht aber gerade von diesem falschen und unfruchtbaren Begriffe der Cultur aus: ihr Ziel, recht rein und hoch gedacht, ist gar nicht der freie Gebildete, sondern der Gelehrte, der wissenschaftliche Mensch(,) und zwar der möglichst früh nutzbare wissenschaftliche Mensch, der sich abseits von dem Leben stellt, um es recht deutlich zu erkennen; ihr Resultat, recht empirisch-gemein angeschaut, ist der historisch-aesthetische Bildungsphilister, der altkluge und neuweise Schwätzer über Staat, Kirche und Kunst, das Sensorium für tausenderlei Anempfindungen, der unersättliche Magen, der doch nicht weiss, was ein rechtschaffner Hunger und Durst ist. Dass eine Erziehung mit jenem Ziele und diesem Resultate eine widernatürliche ist, das fühlt nur der in ihr noch nicht fertig gewordene Mensch, das fühlt allein der Instinct der Jugend, weil sie noch den Instinct der Natur hat, der erst künstlich und gewaltsam durch jene Erziehung gebrochen wird. Wer aber diese Erziehung wiederum brechen will, der muss der Jugend zum Wort verhelfen (…). (NSW 1, 326)
Die Grundzüge der „historischen Jugenderziehung“ sehen für Nietzsche wie folgt aus:
(…) der junge Mensch hat mit einem Wissen um die Bildung, nicht einmal mit einem Wissen um das Leben, noch weniger mit dem Leben und Erleben selbst zu beginnen. Und zwar wird dieses Wissen um die Bildung als historisches Wissen dem Jüngling eingeflösst oder eingerührt; das heisst, sein Kopf wird mit einer ungeheuren Anzahl von Begriffen angefüllt, die aus der höchst mittelbaren Kenntniss vergangner Zeiten und Völker, nicht aus der unmittelbaren Anschauung des Lebens abgezogen sind. Seine Begierde, selbst etwas zu erfahren und ein zusammenhängendes lebendiges System von eignen Erfahrungen in sich wachsen zu fühlen – eine solche Begierde wird betäubt und gleichsam trunken gemacht, nämlich durch die üppige Vorspiegelung, als ob es in wenig Jahren möglich sei, die höchsten und merkwürdigsten Erfahrungen alter Zeiten und gerade der grössten Zeiten in sich zu summiren. (NSW 1, 327)
Kein Wunder, „daß der Deutsche keine Kultur hat“ – „er (kann) sie aufgrund seiner Erziehung gar nicht haben“ (NSW 1, 328).
(…) wir sind ohne Bildung, noch mehr, wir sind zum Leben, zum richtigen und einfachen Sehen und Hören, zum glücklichen Ergreifen des Nächsten und Natürlichen verdorben und haben bis jetzt noch nicht einmal das Fundament einer Cultur, weil wir selbst davon nicht überzeugt sind, ein wahrhaftiges Leben in uns zu haben.
Schenkt mir erst Leben, dann will ich euch auch eine Cultur daraus schaffen! – So ruft jeder Einzelne dieser ersten Generation, und alle Einzelnen werden sich unter einander an diesem Rufe erkennen. Wer wird ihnen dieses Leben schenken?
Kein Gott und kein Mensch: nur ihre eigne Jugend; entfesselt diese und ihr werdet mit ihr das Leben befreit haben. (NSW 1, 328–329)
Jugend-, Lebens- und NietzschekultNietzsches Appell an die Jugend, mit den Traditionen und Konventionen der überkommenen Kultur zu brechen, auf nichts anderes zu setzen als auf die eigene „Jugend“ und das eigene „Leben“ und aus der „unmittelbaren Anschauung“ dieses Lebens „eine (neue) Kultur zu schaffen“, ist von der „ersten Generation“ der Modernen begierig aufgegriffen worden. Und sie hat nicht vergessen, wem sie den entscheidenden „Weckruf“ verdankte. Das zeigt etwa ein Leitartikel, den Michael Georg Conrad 1895 zum zehnjährigen Jubiläum der Zeitschrift „Die Gesellschaft“ schrieb. Conrad ist der erste bekennende Naturalist unter den deutschen Autoren und eine zentrale Figur der Münchner Moderne,28 und die „Gesellschaft“ ist das wichtigste Organ der frühen Moderne in Deutschland.29 Conrad spricht in seinem Jubiläumsartikel nicht nur auf die gleiche Weise von „Jugend“ und „Leben“ wie Nietzsche, er greift darüber hinaus auch zentrale Begriffe von dessen Philosophie auf, so zum Beispiel die Begriffe der „Morgenröte“ und der „ewigen Wiederkehr“.
Unsere Zeitschrift hat ihr zehntes Jahr vollendet. Und sie fühlt sich jung, heiß, zukunftsfroh wie am ersten Tag (…).
Mit uns ist die Jugend, mit uns ist die Kraft, mit uns Krieg und Sieg!
Das ist unser Geheimnis, das Geheimnis aller Lebendigen und Zukünftigen: Wir wollen vom Leben leben, und darum müssen wir in der Zukunft leben.
Und die Jugend ist mit uns nicht bloß als eigne, persönliche Verjüngung im nimmerrastenden Kampfe, sie ist mit uns in den Scharen jener, die, nach dem Gesetze der ewigen Wiederkehr, täglich neu dem Leben und seinen hehren Idealen geboren werden, in den Scharen jener Herrlichen und Fröhlichen, auf deren Scheitel zwar die Reflexe der großen Vergangenheit glänzen, in deren Augen aber der Morgenschimmer der noch größeren Zukunft leuchtet und Sonnenaufgänge sich ankündigen, wie in solcher Kraft und Schönheit die Menschheit sie noch nicht gesehen.
„Es giebt noch viele Morgenröten, die noch nicht geleuchtet haben“, spricht Nietzsche.
Mit ihm stehen wir auf der Linie des aufsteigenden Leben. Mit ihm haben wir uns in kein abstraktes Ideal, in kein papiernes Prinzip, in kein ertötendes Dogma, in keine heimlich mordende, vampyrartig blutaufsaugende Autorität eingesponnen und eingekapselt.30
Es ist unübersehbar: Nietzsche ist für einen Modernen vom Schlage Conrads die Autorität schlechthin in Sachen Moderne, und doch will er ihn nicht als Autorität verstanden wissen – ein Widerspruch, in dem ein Problem zum Vorschein kommt, das die Moderne durch ihre gesamte Geschichte begleitet hat und das man schon früh gesehen und als „Konflikt der modernen Kultur“ beschrieben hat.
2.3 Der „Konflikt der modernen Kultur“ und die Idee einer Postmoderne
Die innere Grenze des programmatischen ModernismusDen „Bann der Überlieferung“ abzuschütteln, um einem „Drang zur Neugestaltung“ Luft zu verschaffen, „Autoritäten“ den Kredit aufzukündigen, „Gewohnheiten“ und „Konventionen“ aufzubrechen, die Erwartung ästhetischen „Wohlbehagens“ nach Kräften zu düpieren, jedwede „Schmeichelschönheit“ als „Täuschung“ zu entlarven, „Formen zu sprengen“, um „Eigenwüchsiges“ an den Tag zu bringen, Neues, das einer unmittelbaren Berührung mit der „Erde“, der „Natur“, dem „Leben“ entspringt, das Kunstwerk als „freie Tat“ des „starken Geists“, als lebendige, dynamische Aktion – das alles sind Forderungen, die nicht nur für die erste Generation der Modernen gelten. Bis auf den heutigen Tag bilden sie das Grundgerüst der Programme, die im Namen einer modernen Kunst und Literatur formuliert werden, bezeichnen sie den eisernen Bestand des theoretischen Werkzeugkastens, mit dem an der Kultur der Moderne gearbeitet wird, mit dem etwa die Literaturkritik ihre Diskurse bestreitet. Jede Generation, jeder neu sich formierende Zirkel von Avantgardisten und jeder Debütant, der auf sich hielt, hat den programmatischen Modernismus noch einmal neu für sich entdeckt und damit dafür gesorgt, daß er präsent blieb.
Darin bezeugt sich nicht nur, welches Potential die Konzepte hatten, die von der ersten Generation der Modernen entwickelt worden waren, und wie durchschlagend ihre Wirkung war; es zeigt sich darin auch ihre innere Grenze. Offenbar war nichts von dem, was die ersten Modernen an Neuem geschaffen hatten, so neu, daß die, die nach ihnen kamen, nicht Gelegenheit gehabt hätten, ihm gegenüber erneut nach Modernität zu rufen. Was immer eine Gruppe von Avantgardisten ins Werk setzte, war, so radikal sie sich auch geben mochten, letztlich doch nicht so modern, daß es eine nächste Generation nicht gleich wieder als veraltet hätte empfinden können, daß sie in ihm nicht wieder eine Überlieferung mit der Aura des Etablierten und Autoritativen hätte erblicken können, gegen die mit einem neuerlichen Brechen von Konventionen und Sprengen von Formen vorzugehen gewesen wäre. In eben diesem Sinne wandte sich zum Beispiel die Avantgarde von 1910, der Expressionismus, gegen Naturalismus, Symbolismus und Jugendstil, und wandte sich die Avantgarde von 1920, der Dadaismus, gegen den Expressionismus. Keine Avantgarde war offenbar so avanciert, daß nach ihr nicht eine neue Avantgarde hätte aufstehen können. Nichts Modernes schien je modern genug, schien sich auf Dauer als modern behaupten zu können.
Die Steigerungslogik der ModerneNun sind in der Moderne natürlich nicht nur Kunst und Literatur, sondern alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens auf solche Weise in Bewegung; überall heißt modern zu sein nach kurzer Zeit schon wieder etwas anderes. Die neue Mobilität der Kunst entspringt ja zunächst nichts anderem als dem Versuch, sich dadurch zu einer modernen Kunst zu gestalten, daß sie sich auf die Dynamik um sie herum einläßt und sie nach Kräften in sich hineinnimmt. Doch das allein reicht wohl noch nicht aus, um die dichte Abfolge immer neuer Avantgarden zu erklären. So rasch und durchgreifend verändern sich die Lebensverhältnisse auch in der Moderne nicht, daß eine Kunst, die up to date sein will, sich in jedem Jahrzehnt noch einmal neu zu erfinden hätte.
Der Grund für das Auftreten immer neuer Avantgarden dürfte nicht so sehr in den realen Prozessen des Wandels um die Kunst herum als vielmehr in dem Konzept von Modernisierung zu suchen sein, dem sie sich als moderne Kunst verschrieben hat. Es bedeutet nichts weniger, als daß jeder Künstler, der modern heißen will, seine Vorgänger an Modernität zu überbieten hat, daß er über das, was diese bei der Auseinandersetzung mit der modernen Welt bereits an Thematisierungen und formalen Möglichkeiten erarbeitet haben, wieder hinausgehen muß. Wenn jede künstlerische Leistung, die die Zeitgenossen überzeugt und beeindruckt, das Zeug dazu hat, eine Nachfolge zu begründen, also eine Tradition zu stiften, einen neuen „Bann der Überlieferung“ aufzurichten, dann kann eine Kunst, die auf Modernität aus ist, sich nur dadurch treu bleiben, daß sie jeden Ansatz zu einem solchen „Bann“ sogleich wieder zunichte macht. So kommt es, daß das, was die Werke eines Künstlers von denen seiner Vorgänger unterscheidet, daß die „Differenzqualität“ – ein Begriff des Russischen Formalismus, einer Schule der Literaturtheorie, die eng mit der russischen Avantgarde der zwanziger Jahre verbunden ist – in der Moderne weithin zu einem letzten Kriterium in allen Belangen der Kunst wird.
Die Forderung der Modernität als LeerintentionHier zeigt sich, daß der moderne, der aus der Relation antik – modern herausgelöste, absolute Begriff von Modernität nur eine „Leerintention“ (Edmund Husserl) ist, die von sich aus keinen konkreten Inhalt mit sich führt, die immer wieder neu zu füllen ist und sich mit keiner Füllung auf Dauer verbindet, ja jeder einmal vorgenommenen Füllung alsbald wieder entledigt. Modern zu sein heißt nicht, ein für allemal für dieses und gegen jenes zu sein, sondern immer wieder für etwas anderes einzutreten.
Das haben bereits die ersten Modernen gesehen. Es ist ihnen nicht zuletzt über einem Streit bewußt geworden, der in der Münchner „Gesellschaft für modernes Leben“ entbrannte, kaum daß sie gegründet war. Er entzündete sich an einer Frage, die im katholischen München nicht ausbleiben konnte, an der Frage, ob man als Katholik modern und als Moderner katholisch sein könne, ob Modernität nicht Atheismus und Materialismus mit einbegreife. Das Ergebnis war die Einsicht, daß eine „Präcisierung der ,Moderne‘ (…) unvereinbar (…) mit dem Wesen derselben“ (MM 132–133) sei, daß also jede Festlegung des Begriffs „modern“ auf Vorstellungen wie Atheismus und Materialismus seiner Verfälschung gleichkäme. Das aber heißt nichts anderes, als daß er als eine Leerintention zu begreifen und zu handhaben sei.
In die gleiche Richtung zielt Michael Georg Conrad, wenn er erklärt, der Kampf der Modernen sei nicht als Eintreten für ein „Ideal“, ein „Prinzip“ oder ein „Dogma“ und „Einspinnen in eine Autorität“ zu verstehen, sondern als eine Bewegung „auf der Linie des aufsteigenden Lebens“. Unter dem Titel der Moderne soll es um eine Haltung gehen, die sich dem gegenüber, was das „aufsteigende Leben“, was Evolution und Fortschritt an Neuem bringen, nicht hinter irgendwelchen „Idealen“, „Prinzipien“, „Dogmen“ und „Autoritäten“ verschanzt, sondern ihm mit rückhaltloser Offenheit begegnet – offen und in Bewegung zu sein und zu bleiben wird zu einem obersten Wert.
Solche Feier der Offenheit läßt den Verdacht aufkommen, daß der Begriff der Modernität, auf den der programmatische Modernismus die Kunst verpflichtet, letztlich nichts anderes sei als der Hebel einer Modernisierungsdynamik, die sich zum Selbstzweck geworden ist, die allen Analysen und Programmen, die ihr angedient werden, immer schon voraus ist. Was immer sich die Zeitgenossen an Theorien in Sachen Moderne einfallen lassen – daß die Modernisierung weitergeht, steht vorab schon fest. Da kann es nicht ausbleiben, daß die Haltung der Offenheit in den Rang einer obersten Tugend aufsteigt; nur sie scheint davor bewahren zu können, daß man irgendwann unter die Räder der Modernisierungsmaschine gerät.
Offenheit ist freilich nicht die Lösung aller Probleme; sie schafft auch wieder neue. Die Bedeutung der Offenheit liegt ja darin, daß sie es erlaubt, sich auf Neues einzulassen, und sich einlassen heißt ergreifen und festhalten und nicht gleich wieder fahrenlassen, heißt also, sich zumindest zeitweise von der Offenheit verabschieden. Eine Leerintention wie der Begriff der Modernität kann nur dadurch zur Wirkung gelangen, daß sie mit bestimmten Inhalten wie Atheismus und Materialismus gefüllt wird und daß für die Worte, Taten und Werke, in denen diese Inhalte entfaltet werden, Geltung beansprucht wird. Gelten wollen heißt aber, der Modernisierungsdynamik nicht gleich wieder weichen wollen, ja ein solcher Geltungsanspruch konstituiert sich in der Moderne recht eigentlich in dem Widerstand, den er der Modernisierungsdynamik entgegensetzt. Von ihm aus gesehen erscheint das Modernisierungsgebot mithin als ein „Prinzip“, das ihm das Leben schwermacht, nimmt es die Züge eben der „Ideale“ und „Autoritäten“ an, mit denen eigentlich Schluß sein soll, begründet es ein neues „Dogma“: den Dogmatismus der Offenheit. Die Leerintention „modern“ und ihre jeweiligen Füllungen geraten notwendig in einen Konflikt, in dem sie einander wechselseitig als dogmatische Fixierung erfahren.
Der „Konflikt der modernen Kultur“Der Philosoph und Soziologe Georg Simmel (1858–1918)31 hat diesen Konflikt, den er den „Konflikt der modernen Kultur“ nennt, bereits 1918 einer eingehenden Analyse unterzogen. Dabei hat er ihn, wie bei einem Jünger Nietzsches und Verfechter des Vitalismus nicht anders zu erwarten – und das war Simmel in seinen letzten Jahren – auf einen Konflikt des Lebens zurückgeführt. Leben heißt schöpferisch sein; das Leben kann sich aber nur dadurch in seiner schöpferischen Lebendigkeit bewähren, daß es Formen schafft, Werke, die in eben dem Maße, in dem sie Gestalt annehmen, aufhören lebendig zu sein, die nämlich im Moment der Fertigstellung in eine feste Form auskristallisieren. Damit treten sie dem Leben, das es geschaffen hat, als etwas gegenüber, dem es gerade sein Eigenstes, seine Lebendigkeit, nicht hat mitteilen können, so daß es sie um seiner Selbsterhaltung willen wieder zerbrechen und sich zu neuen Formen aufmachen muß, wohl wissend, daß diese auch nicht lebendiger sein werden als ihre Vorgänger.
Das Problem ist also früh schon gesehen worden; ob aber die Analyse zureicht, die ihm Simmel hat angedeihen lassen, darf wohl bezweifelt werden. Wenn es wirklich auf einen Konflikt des Lebens überhaupt zurückzuführen wäre, dann wäre zu fragen, was an ihm das spezifisch Moderne sein sollte; dann hätte es sich eigentlich zu allen Zeiten zeigen müssen, und wenn das nicht oder nicht in der gleichen Weise wie in der Moderne der Fall gewesen sein sollte, dann müßte hier etwas hinzugetreten sein, das es allererst hätte virulent werden lassen, ein Moment, das nicht im Leben, das überhaupt nicht in den natürlichen Voraussetzungen der kulturellen Entwicklung, sondern in dieser selbst zu suchen wäre. Da wäre dann zunächst und vor allem an die Modernisierungsdynamik zu denken, wie sie alles einmal Geschaffene, alle Formen und Strukturen und alle Traditionen und Konventionen, die diese am Leben erhalten, unter den Generalverdacht des Überlebten stellt, aber auch an einen Lebensbegriff, wie ihn Simmel gebraucht, einen, der sich an die Modernisierungsdynamik angepaßt hat und demgemäß nur den Schaffensprozeß selbst als lebendig anerkennt und alles Geschaffene als tot abqualifiziert.
Das kann man natürlich auch anders sehen, und man kann es durchaus auch als engagierter Moderner. So hat etwa die amerikanische Autorin Gertrude Stein (1874–1946), eine zentrale Figur des Avantgardismus, erklärt: „Life is tradition and human nature“,32 Leben ist Tradition und menschliche Natur. Der Satz findet sich bezeichnenderweise in dem Werk, in dem sie die Summe ihrer künstlerischen Erfahrungen zieht, in dem späten experimentellen Text „Paris, France“ (1940). Für Stein gehört das kulturelle Erbe genauso zum Leben wie die Natur. Traditionen und Konventionen ermöglichen Leben, indem sie es auf eine feste Grundlage stellen und ihm mit dem, was sie ihm an Stoffen und Formen zuführen, zu tun geben, und sie stimulieren und befruchten es selbst dort und gerade dort, wo es sich an ihnen reibt; ohne die selbstverständliche Gegenwart des kulturellen Erbes kein schöpferisches Leben, auch nicht in der Moderne.33
Von einer solchen Sicht der Dinge sind die ersten Modernen freilich noch weit entfernt; der Historismus und der epigonale Kunstbetrieb des ausgehenden 19. Jahrhunderts lasten zu schwer auf ihnen, als daß sie dem Phänomen der Traditionsbildung etwas Positives abgewinnen könnten. So entfaltet sich die moderne Kunst und Literatur in einem konfliktgeladenen Wechselspiel zwischen dem Versuch, der Vision einer neuen Kunst mit dem Aufbringen neuer Themen und Formen Leben einzuhauchen, und einem Dogmatismus der Offenheit, der solche „Präzisierung der Moderne“ wegen der Gefahr einer neuerlichen Traditionsbildung mit „Prinzipien“, „Idealen“, „Dogmen“ und „Autoritäten“ sogleich wieder kassiert.
Die Idee einer PostmoderneDie Möglichkeit der dogmatischen Verfestigung eines bestimmten Begriffs von moderner Kunst ist allerdings erst in dem Moment zu einer realen Gefahr für das Ringen um Offenheit geworden, in dem man begann, von der Moderne als Epoche zu reden. Denn da mußte man dann in der Tat versuchen, ein „Ideal“ moderner Kunst zu konstruieren, nämlich „Prinzipien“ herauszuarbeiten und dogmatisch festzuschreiben, die sie von der Kunst früherer Epochen unterscheiden würden; da wurden allgemeine Aussagen wie die unumgänglich, die moderne Literatur tendiere zu Atheismus und Materialismus, bevorzuge Formen wie Freie Rhythmen, Fragment und Montage, usw. Und wirklich hat man bereits kurz nach der Jahrhundertwende begonnen, von den Jahren seit 1885 als einer eigenen, besonderen Epoche zu sprechen. So hat zum Beispiel der Berliner Schriftsteller und Literaturkritiker Samuel Lublinski (1868–1910) schon 1904 eine vielbeachtete „Bilanz der Moderne“ vorgelegt, um ihr 1909 gar eine Schrift folgen zu lassen, der er den Titel „Der Ausgang der Moderne“ gab.
Wo man aber von der Moderne als einer Angelegenheit handelt, die wie einen Beginn, so auch einen „Ausgang“ hätte und von der sich eine „Bilanz“ aufmachen ließe, da ist die Idee einer „Postmoderne“ nicht mehr fern. In der Tat lassen sich die beiden Schriften von Lublinski als ein früher Anlauf zu einer Theorie der Postmoderne begreifen, auch wenn er das Wort „postmodern“ noch nicht kennt und mit seinen Versuchen womöglich nicht besonders weit gekommen ist.
Hier wie überall, wo man sich an einer solchen Theorie versucht, ist die zentrale Frage, was der Gegenwart an Entwicklungen zugesprochen wird, die es erlauben, ihr einen Ort jenseits der Moderne zuzuweisen. Soll es das Abrücken von einem dogmatisch verfestigten, in einem bestimmten Epochenbild festgeschriebenen Begriff von Moderne und die Erneuerung des Dogmatismus der Offenheit sein, oder aber umgekehrt die Abkehr von dem Dogmatismus der Offenheit und Wiedergewinnung eines produktiven Verhältnisses zu den Traditionen von Kunst und Kultur und zu dem Institut der Traditionsbildung überhaupt? Streng genommen, müßte es sich eigentlich um ein Drittes handeln: um die Überwindung des „Konflikts der modernen Kultur“, des zum Automatismus erstarrten Hin und Her zwischen der dogmatischen Verfestigung neuer Formen und ihrer nicht minder dogmatischen Wiederauflösung – wie immer dies im einzelnen zu denken sein mag.