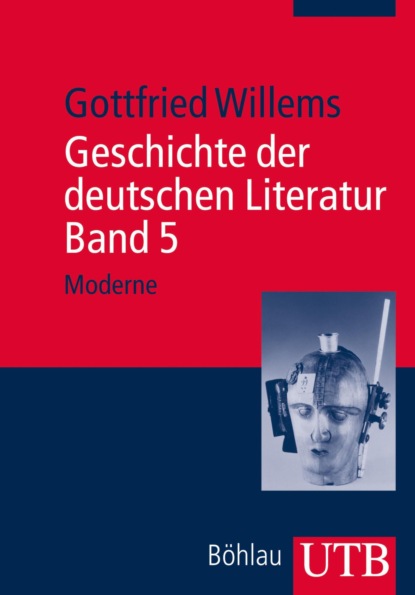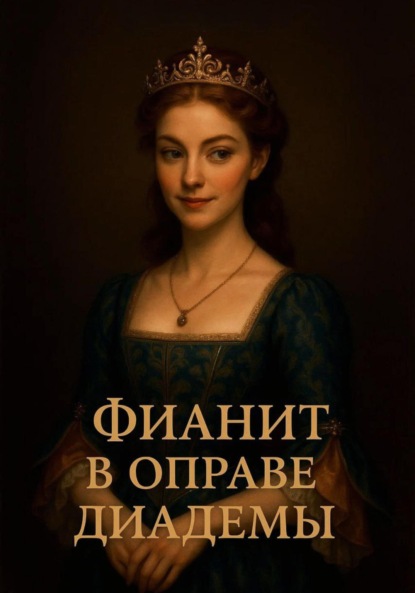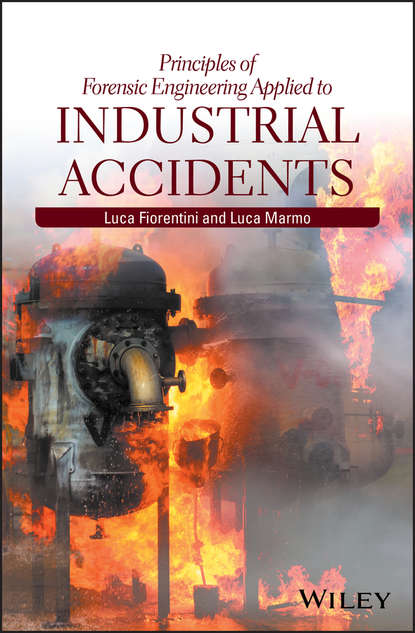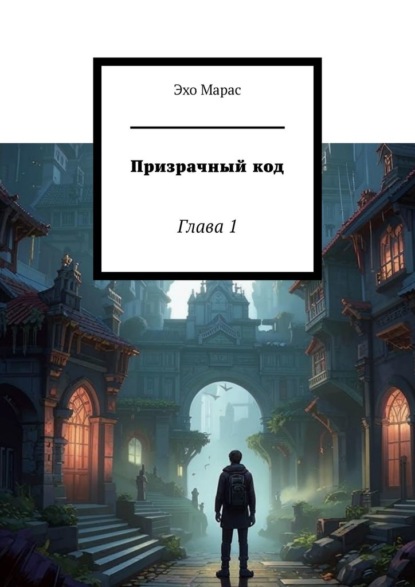- -
- 100%
- +
Dieses Bild tat auch in Deutschland seine Wirkung, einem Land, das noch lange keine Metropole vom Format eines London oder Paris aufzuweisen hatte. Zumal die Romantik machte es sich zueigen, und sie schrieb es auf eine Weise fest, die ihm eine Wirkung durch das gesamte 19. Jahrhundert hindurch und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein sicherte. Die Deutschen hatten also bereits eine fertige Vorstellung von der modernen Großstadt, noch bevor es in Deutschland eine Stadt gab, die diesen Namen verdiente, bevor die großstädtische Lebenswelt für sie zu einer realen Erfahrung geworden war.
Das romantische Bild der GroßstadtAls Beispiel für das romantische Bild der Großstadt sei hier der Roman „Ahnung und Gegenwart“ (1815) von Joseph von Eichendorff angeführt. Da wird zweimal ein Blick auf eine große Stadt geworfen, nur ein Seitenblick zwar, aber einer, der es an Deutlichkeit nicht fehlen läßt. Die Stadt bleibt ohne Namen, wird nur „die Residenz“ genannt; Eichendorff mag dabei an das ihm wohlbekannte Wien gedacht haben, die Residenz zunächst der deutschen, dann der österreichischen Kaiser, die um 1815 gerade einmal 250.000 Einwohner hatte, also noch nicht von besonders furchteinflößender Größe war. Wir hören zunächst die Stimme des Helden Friedrich, der mit ansehen muß, wie sich die geliebte Rosa allein in die große Stadt aufmacht, und sodann die des Erzählers, der Friedrichs Sicht der Dinge nachdrücklich bestätigt und weiter ausführt.
„Siehst du dort“, sagte Friedrich, „die dunklen Türme der Residenz? Sie stehen wie Leichensteine des versunkenen Tages. Anders sind die Menschen dort, unter welche Rosa nun kommt; treue Sitte, Frömmigkeit und Einfalt gilt nicht unter ihnen. Ich möchte sie lieber tot, als so wiedersehn. Ist mir doch, als stiege sie, wie eine Todesbraut, in ein flimmernd aufgeschmücktes, großes Grab, und wir wendeten uns treulos von ihr und ließen sie gehen.“42
Wohl ist der Weltmarkt der großen Städte eine rechte Schule des Ernstes für bessere beschauliche Gemüter, als der getreueste Spiegel ihrer Zeit. Da haben sie den alten, gewaltigen Strom in ihre Maschinen und Räder aufgefangen, daß er nur immer schneller und schneller fließe, bis er gar abfließt, da breitet denn das arme Fabrikenleben in dem ausgetrockneten Bette seine hochmütigen Teppiche aus, deren inwendige Kehrseite ekle, kahle, farblose Fäden sind, verschämt hängen dazwischen wenige Bilder in uralter Schönheit verstaubt, die niemand betrachtet, das Gemeinste und das Größte(,) heftig aneinandergeworfen, wird hier zu Wort und Schlag, die Schwäche wird dreist durch den Haufen, das Hohe ficht allein. Friedrich sah zum ersten Male so recht in den großen Spiegel, da schnitt ihm ein unbeschreiblicher Jammer durch die Brust, und die Schönheit und Hoheit und das heilige Recht, daß sie so allein waren, und wie er sich selber in dem Spiegel so winzig und verloren in dem Ganzen erblickte, schien es ihm herrlich, sich selber vergessend, dem Ganzen treulich zu helfen mit Geist, Mund und Arm.43
Immerhin, schon hier wird der Großstadt zuerkannt, was ihre Bedeutung für die moderne Literatur begründen wird: daß sie „der getreueste Spiegel ihrer Zeit“ ist, doch geschieht dies ausschließlich insofern, als in ihr all das in geballter Form zu erfahren sein soll, was die neue Zeit an Negativem über die Menschen gebracht hat. Als Sitz des modernen Fabriken- und Maschinenwesens soll die Großstadt der Ort sein, wo dem Strom des Lebens das Leben und den Menschen der Schönheitssinn ausgetrieben wird, wo sich lebendige in mechanische Prozesse auflösen und man sich an das „Ekle“, „Kahle“ und „Farblose“ gewöhnt. Mit dem Schönheitssinn soll zugleich der Sinn für das Wahre und Gute ins Wanken geraten, sollen sich „Gemeinheit“ und „Schwäche“ breit machen und dank des großen „Haufens“ auf eine Weise die Oberhand gewinnen, die die wenigen, in denen noch die „Hoheit“ und das „heilige Recht“ leben, zu einem Leben in Einsamkeit verdammt. In der großen Stadt ist für den Romantiker Eichendorff alle „Poesie des Herzens“ am Ende, dominiert „Prosa“ die Verhältnisse, und so entfernt er sie so rasch wie möglich wieder aus dem Fokus der Darstellung. Ihre Bedeutung erschöpft sich bei ihm darin, eine äußerste Herausforderung des „wahren poetischen Sinnes“ zu sein.
3.1.1 Großstadtdichtung bei Baudelaire
Die Großstadt als Schauplatz einer neuen SchönheitDas genaue Gegenstück zu dieser Sicht der großen Stadt findet sich ein knappes halbes Jahrhundert später bei Charles Baudelaire,44 dem Vater der modernen Großstadtdichtung. Nicht daß er die Vorstellung von dem ästhetisch und moralisch zweifelhaften Charakter des Großstadtlebens widerrufen würde – im Gegenteil: es ist auch für ihn ein Ort, „wo jede Scheußlichkeit wie eine Blume blüht“ (où toute énormité fleurit comme une fleur). Aber diese „Scheußlichkeiten“ werden für ihn nun eben zu „Blumen“, begründen eine eigene, neue Form von Schönheit, die auch sie zu einer Quelle der Kunst, ja zu dem einzig lohnenden Objekt einer wahrhaft modernen Dichtung macht.
Es ist die Schönheit einer „ungeheuren“, „feilen“ „Dirne“, der „infernalische Charme“ (charme infernal) der Hure Babylon, also eine Schönheit, die nichts mehr mit dem Wahren und Guten zu tun hat, die jenseits der klassischen Begriffe von Kalokagathie, „jenseits von Gut und Böse“ angesiedelt ist. Aber auch so, ja gerade so wird sie für Baudelaire zu einem wahren Lebenselixier und damit zur Quelle einer „Kunst, die Leben hat“ (Georg Büchner), scheint der „infernalische Charme“ der Hure Babylon doch auf nichts anderes zu zielen als darauf, „daß jung ich immer bliebe“. Für Baudelaire ist die große Stadt mithin durchaus nicht mehr das „flimmernd aufgeschmückte große Grab“, von dem Eichendorff gehandelt hat, ist sie keine Ansammlung von „Leichensteinen“ mehr, sondern der Schauplatz eines besonders intensiven, lebendigen Lebens, ein unversieglicher Quell der „Lebenssteigerung“.
Der Epilog der „Blumen des Bösen“So ist es in einem Gedicht zu lesen, das Baudelaire 1861 als Epilog für eine neue Auflage seines lyrischen Hauptwerks „Les Fleurs du Mal“ (Die Blumen des Bösen, 1857) konzipierte. Wie bei Eichendorff wird der Leser auf einen erhöhten Punkt über der Stadt geführt, von wo aus er sie als Ganze vor sich hat und sich zu ihr als Ganzer ins Verhältnis setzen kann. Das erinnert an jene Szene der Bibel, in der der Teufel Jesus auf einen hohen Berg führt und ihm die „Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit“ zu Füßen legt (Matth. 3, 8–11). Anders als der biblische Jesus und als Eichendorffs Friedrich widersteht Baudelaires lyrisches Ich nicht der Versuchung, ja gibt es sich ihr in vollen Zügen hin.
AusklangDas Herz zufrieden, stieg ich auf des Hügels SchwelleVon wo im weiten Raum die Stadt man liegen sieht,Spital, Fegfeuer, Hölle, Zuchthaus und Bordelle,Wo jede Scheußlichkeit wie eine Blume blüht.Du weißt, o Satan, Schutzherr meiner Unglückstriebe,Nicht hab ich eitle Tränen dort des Wegs versprüht.Doch wie ein alter Lustbock einer alten Liebe,Wollt ich der ungeheuren Dirne trunken sein,Die, höllisch-reizend, will, daß jung ich immer bliebe.Ob Schlaf dich wiegt noch in des Morgens Kissen ein,Schwer, dunkel, frostig, ob du stolz dich in den FahnenDes Abends brüstest mit der goldnen Borten Schein,Ich lieb dich, feile Metropole! KurtisanenUnd Räuber, oft bereit, mir Freuden zu verleihn,Die nicht begreifen die gewöhnlichen Profanen.45Die „Metropole“ ist für Baudelaire geradezu ein Gegenstand der „Liebe“, ein Gegenüber, das seinem „Herzen“ auf die gleiche Weise zu tun gibt wie die Liebe zu einer Frau, die es bald „zufrieden“ sein läßt, ihm bald „Tränen“ abnötigt und bald „Freuden“ bereitet, die sich bis zur „Trunkenheit“ zu steigern vermögen. Sie ist für ihn mithin ein Objekt jener äußersten Form lebendiger Anteilnahme, die eine unabdingbare Voraussetzung für die künstlerische Gestaltung von Erleben ist. Und so wird sie für ihn zum idealen Bezugsfeld für eine Dichtung, die, wie er an anderer Stelle erklärt, aus dem „Abscheu vor der Langeweile“ und dem „unsterblichen Verlangen“ erwächst, „sich leben zu fühlen“ (le désir immortel de se sentir vivre).46 Vor diesem „Verlangen“ schwinden alle ästhetischen und moralischen Bedenken dahin: „Was macht es schon, wie die Wirklichkeit außer mir aussieht, wenn sie mir nur geholfen hat zu leben, zu fühlen, daß ich bin und was ich bin“ (si elle m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis)47 – ein Gedanke, der recht eigentlich das Herzstück des modernen Vitalismus bezeichnet und der zuvor etwa schon von Heinrich Heine, zum Beispiel in dessen Reisebild „Ideen. Das Buch Le Grand“ (1827) erprobt worden ist.
Dichtung und FlanerieBaudelaire geht aber noch einen Schritt weiter. Er will in der modernen „Riesenstadt“ nicht nur jene Intensität des Erlebens gefunden haben, deren der Dichter bedarf, um produktiv zu werden – er schreibt ihr auch eine besondere, nur ihr eigene Form des Erlebens zu, durch die dem Geschäft des Dichters immer schon vorgearbeitet wäre und das insofern selbst bereits Poesie wäre: das Erlebnis des Aufgehens in der Menge, wie es einem „Flaneur“, einem Menschen zuteil wird, der sich ziellos durch die Straßen treiben läßt.48 Das Spezifische des „Lebens in den Riesenstädten“ ist für Baudelaire „das Durcheinander ihrer zahllosen Beziehungen“ (le croisement de leurs innombrables rapports).49 Dieses „Durcheinander“ wird für den, der sie in der Haltung des Flaneurs durchmißt, auf eine handgreifliche, sinnliche Weise erfahrbar. Dabei kommt er jeder Form von Menschentum und Menschenschicksal nahe, wird ihm jene empathische „Verbundenheit mit dem Allgemeinen“ (communion universelle) zuteil, die für Baudelaire das letzte Ziel von Dichtung ist. Es ist eine Allverbundenheit, die vor allem auch das mit einbegreift, was die „gewöhnlichen Profanen“ nach Kräften von sich fernhalten: das „Unbekannte“ und „Unverhoffte“.
Es ist nicht jedem gegeben, im Meer der großen Masse ein Bad zu nehmen: Sich der Menge genießend zu erfreuen, ist eine Kunst; und der allein kann, auf Kosten der Menschheit, in Lebenskraft schwelgen, dem eine Fee, in seiner Wiege, die Lust zur Verkleidung und zur Maske, den Haß des Zuhause und die Leidenschaft des Reisens eingeblasen hat.
Masse, Einsamkeit: gleichwertige Ausdrücke, die der tätige und fruchtbare Dichter miteinander vertauschen kann. Wer seine Einsamkeit nicht zu bevölkern versteht, versteht auch nicht allein zu sein in einer geschäftigen Menge.
Der Dichter genießt das unvergleichliche Vorrecht, nach seinem Belieben er selbst und ein anderer sein zu können. Wie jene irrenden Seelen, die sich einen Körper suchen, geht er, wenn er nur will, in das Wesen jedes Menschen ein. Ihm allein steht alles offen; und wenn manche Plätze ihm verschlossen zu sein scheinen, so nur deshalb, weil sie ihm einen Besuch nicht zu lohnen scheinen.
Der einsame und nachdenkliche Wanderer schöpft einen einzigartigen Rausch aus solcher Verbundenheit mit dem Allgemeinen. Der Mensch, der leicht in der Menge aufgeht, kennt Fieberschauer von Genüssen, um die der selbstsüchtige Ichmensch, verschlossen wie ein Schrein, und der Träge, eingekapselt wie ein Muscheltier, ewig betrogen sind. Er macht sich alle Berufe, als wären es die seinigen, zu eigen, alle Freuden und alles Elend; wie die Umstände es ihm bieten.
Das, was die Menschen Liebe nennen, ist sehr gering, sehr beschränkt und sehr schwach, verglichen mit jenem unsagbaren Rausch, jener heiligen Preisgabe der Seele, die sich ganz und ungeteilt, als Dichtung und barmherzige Liebe, dem Unverhofften, das sich darbietet, dem Unbekannten, das vorübergeht, verschenkt.50
Das sind Passagen aus „Der Spleen von Paris“ (Le Spleen de Paris, 1869), einer Sammlung von Prosagedichten (poèmes en prose), die Baudelaire als sein zweites poetisches Hauptwerk neben den „Blumen des Bösen“ ansah. Das Prosagedicht51 ist eine Form, die er sich, wie er in der Widmungsvorrede erklärt, eigens zur „Beschreibung des modernen Lebens“ hat einfallen lassen. In ihm versucht er sich an der Gestaltung einer Prosa, die auch „ohne Rhythmus und ohne Reim“ den „lyrischen Regungen der Seele“ Ausdruck zu verleihen vermöchte.52 Im Grunde handelt es sich dabei um den Versuch, die journalistische Textsorte des Feuilletons poetisch zu adeln, ein Unternehmen, an dem sich vor Baudelaire bereits Heine in den „Reisebildern“ auf seine Weise versucht hat. So sind denn die meisten Prosagedichte des „Spleen von Paris“ auch zunächst in diversen Tageszeitungen erschienen.
Der Dichter als StraßenköterDas Schlußstück ist ein Prosagedicht, in dem Baudelaire die Dichtung dadurch auf die großstädtische Lebenswelt und das Großstadterlebnis einzuschwören sucht, daß er den Straßenköter, den „chien flâneur“, den Hund, der „einsam in den gewundenen Schluchten der unermeßlichen Städte umherirrt“, zum Modell eines wahrhaft modernen Dichtertums stilisiert; es ist überschrieben „Die braven Hunde“ (Les bons chiens). Der Vergleich mit dem Straßenköter erlaubt es ihm, die Erlebnisform der Flanerie noch etwas grundsätzlicher zu fassen, ihr über die ästhetische Bedeutung hinaus eine existentielle Dimension zu geben.
Daß es sich um einen poetologischen Text handelt, zeigt sich zunächst darin, daß er anders als die übrigen Kapitel des „Spleen von Paris“ mit einer Anrufung der Musen beginnt, genauer gesagt: mit der Absage an die „akademische Muse“ und der Hinwendung zur „alltäglichen, städtischen, lebendigen Muse“ (la muse familière, citadine, vivante). Wie Homer und Vergil die Musen des Götterhimmels der Antike anriefen, damit sie ihnen hälfen, die Geschichten vom Untergang Trojas und von der Gründung Roms zu besingen, so wendet er sich an diese seine Muse, um sich ihres Beistands beim Besingen der Straßenköter zu versichern. Das ist natürlich nur eine poetische façon de parler, ein rhetorischer Kniff; in Wahrheit geht es darum, der „akademischen Muse“ und mit ihr dem „Epigonenschweif der Antike“ den Garaus zu machen und einer am urbanen Leben der Gegenwart orientierten Dichtung zum Durchbruch zu verhelfen. Die poetologische Dimension des Texts gewinnt weiter an Profil, wo der Straßenköter mit „Seiltänzern“ (saltimbanques) und fahrenden Komödianten (histrions) verglichen wird, und er wird vollends offenbar, wo es heißt, daß der Dichter den Straßenköter „brüderlichen Auges betrachte“. Ein Dichter, wie Baudelaire ihn versteht, wird sich mit dem „chien flâneur“ identifizieren, wird in ihm sich selbst und sein Schicksal wiedererkennen, und darauf kommt es bei der Schilderung der „braven Hunde“ vor allem an.
Wie die „großstädtische Muse“ der „akademischen Muse“ gegenübergestellt wird, so der Straßenköter dem Salon- und Schoßhund, der „chien flâneur“ dem „chien bellâtre“: hier der Dichter als armer Hund, und dort der Dichter als Schoßhund der Gesellschaft. In den Salons der Gesellschaft ist der Dichter zwar frei von „Not“, ist er vor Schmutz und Elend sicher, doch nur um den Preis einer Existenz, die irgendwo zwischen denen des „Kinds“, des „galanten Dämchens“ und des „Dienstboten“ angesiedelt ist, um den Preis einer Abhängigkeit, die er nur auf sich nehmen wird, wenn die Eitelkeit in ihm stärker ist als jede andere Regung, und die ihn letztlich ebensowohl seinen „Instinkt“, seine empathischen Talente, wie seinen „Verstand“ kostet, die beiden Vermögen, ohne die man eigentlich nicht Dichter sein kann.
Dem stellt Baudelaire nun eben den Straßenköter als Gegenmodell gegenüber. Es ist das Modell einer Existenz, in der die Mobilität der Moderne geradezu die Form der „Unbehaustheit“ angenommen hat, einer vollkommen ungesicherten Existenz, so wie man es auch beim fahrenden Volk, bei Pennern und „Zigeunern“, Schaustellern, Straßenmusikanten und anderem Jahrmarktsgelichter antreffen mag. Die Schule des Straßenköters ist nicht die „Akademie“ mit ihren nach allen Regeln der Kunst durchgekauten Bildungsschätzen, sondern die Straße, und damit das Leben selbst, ist die Notdurft (nécessité), der Kampf ums Dasein, und eine bessere Schule kann es für die beiden Grundtugenden des Dichters, für „Instinkt“ oder „Witterung“ und „Verstand“ nicht geben.
Weg mit der akademischen Muse! Mit dieser alten Betschwester habe ich nichts zu tun. Ich rufe die alltägliche, die städtische, die lebendige Muse an, damit sie mir helfe(,) die braven Hunde, die armen Hunde, die mit Kot bespritzten Hunde zu besingen, die Hunde, die jeder von sich fern hält, weil sie verpestet und verlaust sind, nur nicht der Arme, dessen Genossen sie sind, und der Dichter, der sie brüderlichen Auges betrachtet.
Pfui über den geleckten Hund, diesen vierfüßigen Gecken, Dänen, King Charles, Mops oder Wachtelhund, so entzückt von sich selbst, daß er höchst zudringlich zwischen die Beine oder auf die Knie des Besuchers springt, wie wenn er sicher wäre(,) ihm Freude zu machen; ausgelassen wie ein Kind, einfältig wie ein galantes Dämchen, manchmal mürrisch und unverschämt wie ein Dienstbote! Pfui über diese vierpfotigen Schlangen, fröstelnd und faul, die man Windhunde nennt und die in ihren spitzen Schnauzen nicht einmal genug Witterung haben, um der Spur eines Freundes zu folgen, noch in ihrem platten Kopf genug Verstand, um Domino zu spielen.
In die Hütte mit all diesen lästigen Schmarotzern! Zurück mit ihnen in ihr seidengefütterte(s) (Körbchen)! Ich singe den kotbespritzten Hund, den armen Hund, den Hund ohne Behausung, den streunenden Hund, den Seiltänzerhund, den Hund, dessen Instinkt, wie der des Armen, des Zigeuners und des Komödianten wunderbar geschärft ist durch die Not, die so gute Mutter, die wahre Schutzgöttin der gescheiten Leute! Ich singe die armseligen Hunde, die einsam in den gewundenen Schluchten der unermeßlichen Städte umherirren, und sie, die dem verlassenen Menschen mit geistvoll blinzelnden Augen sagten: „Nimm mich zu dir, und aus dem Elend von uns beiden machen wir dann vielleicht so etwas wie Glück!“53
3.1.2 Der Weg der deutschen Literatur in die Großstadt
Der Großstadtroman des 19. JahrhundertsDie deutsche Literatur hat sich zunächst mit solchen Vorstellungen schwergetan, sehr viel schwerer jedenfalls als die französische. Diese war bereits durch den Roman an das Thema Großstadt gewöhnt, hatte im Medium des Großstadtromans bereits einen Sinn und eine Sprache für das Spezifische des Großstadtlebens entwickelt und sich ein Bild von den besonderen Möglichkeiten gemacht, die für die Literatur in ihm lagen. Das war vor allem das Verdienst von Honoré (de) Balzac (1799–1850), der seit den dreißiger Jahren eine große Zahl von Romanen vorgelegt hatte, in denen er das Leben in der großen Stadt Paris geschildert hatte, und der damit ein breites Publikum auf das Großstadtleben eingestimmt hatte.
Im deutschen Sprachraum sucht man lange Zeit vergebens nach einem solchen Großstadtroman.54 Es gab hier eben noch keine Metropole vom Format eines Paris; es fehlten auf Seiten der Autoren die Erfahrungen und auf Seiten des Publikums das Interesse, die einen deutschen Großstadtroman hätten entstehen lassen können. Zwar wurden immer einmal wieder Vorstöße in Richtung auf einen Gesellschaftsroman gewagt, der es an Vielschichtigkeit und Vielstimmigkeit mit dem Roman Balzacs aufnehmen könnte – hierher gehört etwa der „Roman des Nebeneinander“ von Karl Gutzkow (1811–1878) – doch lassen gerade sie die Lebensluft der modernen Großstadt besonders schmerzlich vermissen, zeigen auch sie immer nur wieder die deutsche Provinz.
Statt dessen wurde die deutsche Literatur seit den vierziger Jahren mit Dorfgeschichten55 überschwemmt; während die Franzosen und auch die Engländer im Großstadtroman die moderne großstädtische Lebenswelt erkundeten, versenkten sich die Deutschen in das Leben auf dem Lande. Sieht man sich diese Dorfgeschichten näher an, kann man freilich unschwer erkennen, daß auch sie etwas mit dem Aufkommen der modernen Großstadt zu tun haben. Es sind Großstadtromane ex negativo, Großstadtvermeidungsromane, denn was immer in ihnen an ländlichen Szenen entworfen wird, gewinnt seine Bedeutung nur im Bezug zu der großstädtischen Lebensweise, die inzwischen ja auch über den Deutschen heraufzieht, als deren Gegenbild und kritischer Kommentar.
So hat es bis in die späten achtziger Jahre gedauert, bis auch deutsche Großstadtromane entstanden. Hier ist etwa an den dreibändigen Roman „Was die Isar rauscht“ (1887–1890) des Naturalisten Michael Georg Conrad zu denken, einen München-Roman in der Nachfolge von Zola, der seinerseits an die Paris-Romane von Balzac angeknüpft hatte, oder an die Berlin-Romane des Realisten Theodor Fontane, der sich im Alter noch zu einem halben Naturalisten entwickelte, an Romane wie „Irrungen, Wirrungen“ (1888), „Stine“ (1890) und „Frau Jenny Treibel“ (1892). In ihnen wird man freilich noch immer vergeblich suchen, was für Baudelaire die entscheidende Quelle einer modernen Großstadtdichtung ist: das Aufgehen in der Menge als ein Erleben, das zugleich der Ort einer „universellen Kommunion“ und einer existentiellen Selbstbegegnung, einer rauschhaften „Verbundenheit mit dem Allgemeinen“ und eines Innewerdens dessen wäre, „daß ich bin und was ich bin“.
Die Großstadt im deutschen SymbolismusAm längsten hat sich im deutschen Sprachraum die Lyrik dem Großstadtleben verweigert, also eben die Gattung, die für Baudelaire das bevorzugte Medium der Großstadtdichtung war. Das Modell des Naturgedichts hatte eine solche prägende Kraft, daß man sich eine lyrische Selbstaussprache in großstädtischem Ambiente zunächst kaum vorstellen konnte. Das gilt auch für die deutschen Symbolisten, und dies obwohl sie als bekennende Moderne das Leben von Großstadtmenschen führten und obwohl sie ihre Vorbilder vor allem bei den französischen Symbolisten fanden. So viel sie aber auch sonst bei Baudelaire und dessen Schule gelernt hatten – seine Vorstellungen von Großstadtleben und Großstadtdichtung übernahmen sie nicht. Statt dessen blieben sie weithin bei dem Bild, das die Romantiker von der großen Stadt gezeichnet hatten – kein Wunder, wenn seinerzeit der Begriff der Neuromantik die Runde machte.
So erinnert etwa die folgende Passage aus dem lyrischen Einakter „Der Tod des Tizian“ (1902) von Hugo von Hofmannsthal bis in einzelne Formulierungen hinein an das Bild der „bösen Stadt“, das wir bei Eichendorff kennenlernt haben. Wiederum soll es der Blick von oben erlauben, das Wesen der Großstadt zu erfassen.
Siehst du die Stadt, wie jetzt sie drunten ruht?Gehüllt in Duft und goldne AbendglutUnd rosig helles Gelb und helles Grau,Zu ihren Füßen schwarzer Schatten Blau,In Schönheit lockend, feuchtverklärter Reinheit?Allein in diesem Duft, dem ahnungsvollen,Da wohnt die Häßlichkeit und die Gemeinheit,Und bei den Tieren wohnen dort die Tollen;Und was die Ferne weise dir verhüllt,Ist ekelhaft und trüb und schal erfülltVon Wesen, die die Schönheit nicht erkennen (…). (HGW 1, 253)In die gleiche Richtung zielt eine Reihe von Gedichten des lyrischen Zyklus „Das Stundenbuch“ (1905) von Rainer Maria Rilke.56 In ihnen sucht der Autor einen ersten längeren Aufenthalt in Paris zu verarbeiten, der sich für ihn zu einer zutiefst verstörenden Erfahrung gestaltet und mit der Flucht nach Italien geendet hatte. Da heißt es etwa:
Die großen Städte sind nicht wahr; sie täuschenden Tag, die Nacht, die Tiere und das Kind;ihr Schweigen lügt, sie lügen mit Geräuschenund mit den Dingen, welche willig sind. (DG 80)Oder:
Denn, Herr, die großen Städte sindverlorene und aufgelöste;wie Flucht vor Flammen ist die größte, –und ist kein Trost, daß er sie tröste,und ihre kleine Zeit verrinnt.Da leben Menschen, leben schlecht und schwer,in tiefen Zimmern, bange von Gebärde,geängsteter denn eine Erstlingsherde;und draußen wacht und atmet deine Erde,sie aber sind und wissen es nicht mehr. (DG 79)In einer modernen Großstadt kann man nicht wirklich leben, nicht wirklich am „Atmen der Erde“ teilhaben. Indem sie die Nacht zum Tage macht, zerstört sie das Zeitmaß des Lebens. Sie läßt das Tier nicht tiergemäß und das Kind nicht kindgemäß leben, läßt damit eben die beiden Wesen nicht sie selbst sein, in denen nach Rilkes Überzeugung das Leben in besonderem Maße zur Geltung kommt, die nichts als Leben sind. Sie nimmt den „Dingen“ die Würde, die sie als eigensinnig lebendiges Gegenüber des Menschen haben, macht sie zu „willigen“, „feilen“ Objekten allfälligen Gebrauchs und gedankenloser Vernutzung. Hier sperrt sie die Menschen in „tiefe Zimmer“ ein, dort jagt sie sie durch die Straßen, als sei das Inferno hinter ihnen her; sie bannt sie in einen Zustand zwischen Angst und Hetze, der sie nicht zu sich selbst kommen läßt. So wird sie zu einem Raum, in dem sich das breitmacht, was der Philosoph Martin Heidegger (1889–1976), der übrigens ein starker Rilke-Leser war, „Seinsvergessenheit“ genannt und zum entscheidenden Schwachpunkt der Moderne erklärt hat: „sie aber sind und wissen es nicht mehr“.