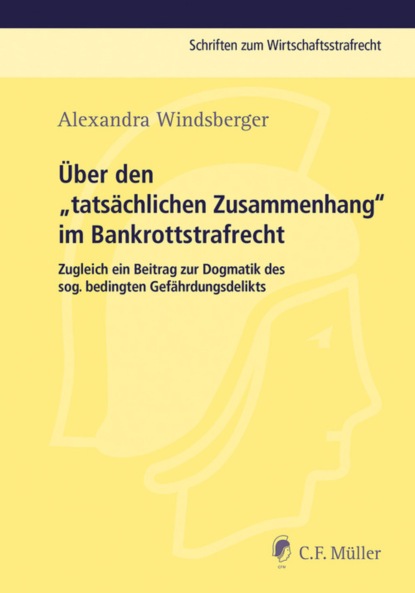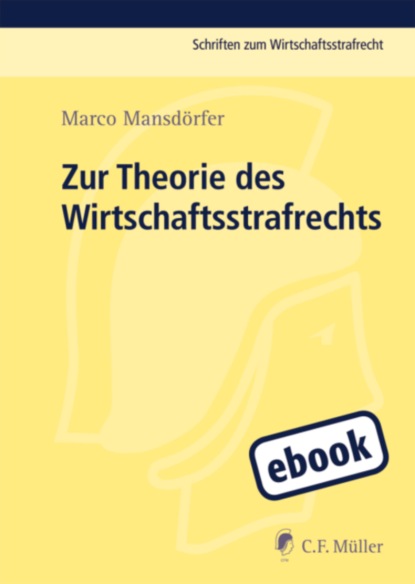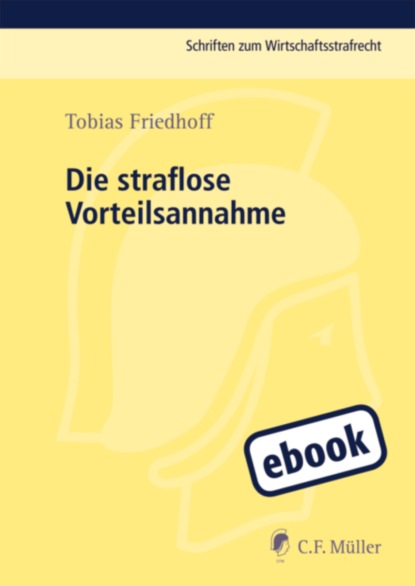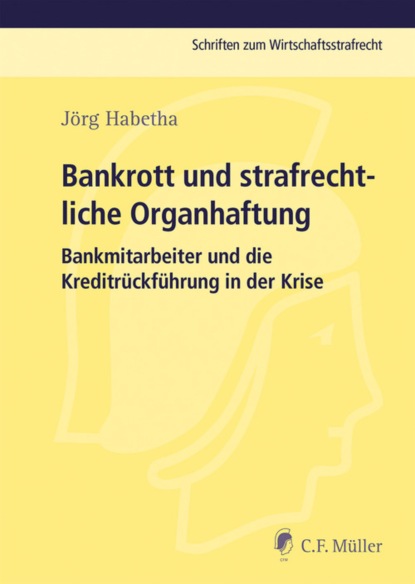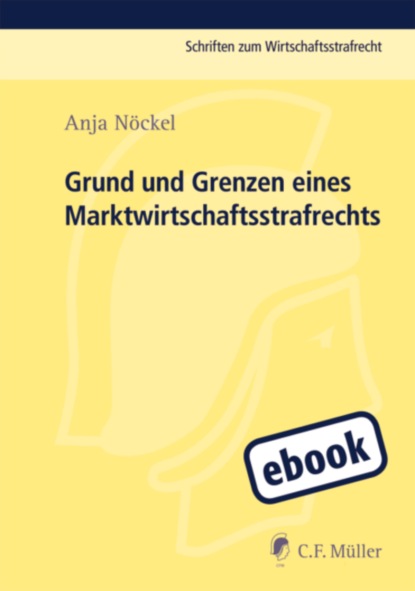- -
- 100%
- +
4. Erste Zwischenbetrachtung: Der „tatsächliche Zusammenhang“ als unrechtsbegründender Faktor
40
Der „tatsächliche Zusammenhang“ in der Interpretation durch das RG kann nur schwer einer einheitlichen Definition zugeführt werden. Das RG machte die Strafbarkeit wegen Bankrotts davon abhängig, ob die vorgenommene Handlung im Einzelfall geeignet war, die Interessen oder Positionen der Konkursgläubiger (irgendwie) negativ zu beeinflussen. Es fällt auf, dass das RG im Rahmen informationsbezogener Bankrotthandlungen vermehrt auf ein zeitliches Element und im Rahmen bestandsbezogener Handlungen auf ein sachliches Element abgestellt hat. Oberflächlich betrachtet, könnte es sich daher – je nachdem, um welche Art von Bankrotthandlung es sich handelt – um unterschiedliche Arten von Zusammenhängen handeln.
a) Der „zeitliche“ Zusammenhang im Rahmen informationsbezogener Bankrotthandlungen
41
Im Rahmen der sog. informationsbezogenen Bankrotthandlungen geht es heute wie damals darum, dass der Täter den Überblick über seinen Vermögensstand vereitelt, so dass sich die am Verfahren beteiligten Gläubiger nicht hinreichend über den Vermögensstand des Schuldners informieren können. Im Idealfall sollten die Gläubiger die Möglichkeit haben, im Hinblick auf das Ob und Wie der Befriedigung selbst abschätzen zu können, ob das was ihnen an quotaler Befriedigung angeboten wird, auch verglichen mit den tatsächlichen Vermögensverhältnissen des Schuldners, angemessen ist.[107] Ab Konkurseröffnung hatte die Gläubigerschaft bereits zum damaligen Zeitpunkt ein Mitbestimmungsrecht daran, wie mit der Aktivmasse und dem Geschäft des Schuldners weiter zu verfahren ist. Um all diese Umstände beurteilen zu können, sind die Gläubiger auf die Informationen aus den Handelsbüchern zwingend angewiesen. Sind solche nicht vorhanden oder unzureichend geführt, ist das Interesse der Gläubigerschaft an der Beschaffung einer ausreichenden Informationsgrundlage berührt. Das RG stellte im Rahmen der Buchdelikte vielleicht deshalb des Öfteren auf „das Interesse der Gläubiger, sich eine Übersicht zu verschaffen“ ab. Solange der Schuldner solvent ist, ist das Führen von Handelsbüchern eine bloße Obliegenheit. Strafrechtliche Relevanz erlangen die Verstöße damit erst im Zeitpunkt des Konkurses. Nach Ansicht des Reichsgerichts waren diese Obliegenheitsverletzungen nur dann strafbar, wenn die Möglichkeit der Konkursgläubiger, einen Überblick über die Vermögensverhältnisse zu gewinnen, im Zeitpunkt des Konkurses „tatsächlich beeinträchtigt“ wurde. Dies sollte zumindest dann der Fall sein, wenn die Handlung (unterlassene Buchführung) einen „tatsächlichen Zusammenhang in Form eines zeitlichen Zusammenhangs“ zur Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung aufweist. Die Verletzung der Buchführungs- und Bilanzierungspflichten war daher ihrem Wesen nach nur in diesem bestimmten Zeitraum geeignet, eine konkrete Beeinträchtigung der Gläubigerinteressen darzustellen. Deshalb wurde im Rahmen der informationsbezogenen Bankrotthandlungen stets auf einen tatsächlichen Zusammenhang in Form eines zeitlichen Zusammenhangs abgestellt. Erfolgt die Handlung einige Zeit vor ZE/Konkursverfahren oder danach, sollte dies nur ausnahmsweise strafbar sein, wenn „ein Gläubigerinteresse an den Handelsbüchern fortbestand “. Mit Hilfe eines zeitlichen Zusammenhangs wurden nur noch die Buchführungsverstöße bestraft, die gerade im Moment des Konkurses ihre „nachteilige Wirkung“ entfalteten. Der Schritt zum strafwürdigen Kriminalunrecht hing mithin ganz entscheidend vom Eintritt des Konkurses und den damit verbundenen konkreten Gefahren für die Gläubiger ab. Nur, wenn die Handlung im Moment des Konkurses nachteilige Auswirkungen hatte, also die Interessen der Konkursgläubiger konkret gefährdet oder beeinträchtigt waren, wurde der Schuldner bestraft.
b) Der „sachliche“ Zusammenhang im Rahmen bestandsbezogener Bankrotthandlungen
42
Im Rahmen der Bankrotthandlungen, die den Bestand des Vermögens betrafen, indem der Schuldner Verfügungen über die Aktivmasse traf, hatte der „tatsächliche Zusammenhang“ dieselbe Funktion, allerdings einen anderen Namen. Kennzeichnend für diese Art der Bankrotthandlungen ist noch heute eine unmittelbare Einwirkung des Schuldners auf das eigene Vermögen und damit die potentielle Insolvenzmasse. Unproblematisch strafbedürftig waren solche Fälle, in denen der Schuldner die Konkursmasse dadurch schmälerte, dass er nach Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung Vermögensbestandteile bei Seite schaffte. Problematisch waren hingegen die Fälle, in denen der Täter Bestandteile seines Vermögens bei Seite schaffte oder übermäßige Summen verbrauchte und später aus anderen Gründen in Konkurs geriet. Hierbei fällt auf, dass im Rahmen der bestandsbezogenen Handlungen gerade keine zeitliche, sondern eine sachliche, tatsächliche Beziehung als maßgeblich erachtet wurde. Dies findet seine Erklärung erneut in der Art der Bankrotthandlung: ein ordnungsgemäßes Wirtschaften und der rechtstreue Umgang mit der potentiellen Masse ist für die Gläubiger in jedem Zeitpunkt von Belang, da eben niemand weiß, ob und wann ein Konkurs eintreten wird. Dennoch verlangte das RG ein Korrektiv in Form eines „äußeren Zusammenhangs“, welcher vorlag, wenn „dieselben Gläubiger oder wenigstens ein Teil von ihnen, sowohl durch die Bankrotthandlung benachteiligt, als auch durch die Zahlungseinstellung betroffen“ waren. Auch diese Passage belegt, dass es entscheidend darauf ankam, ob die Bankrotthandlung konkrete Auswirkungen auf die Positionen der Konkursgläubiger hatte. Wenn das RG eine „Betroffenheit derselben Gläubiger“ verlangt, könnte damit eine Verfügung des Täters angesprochen sein, die gerade solche Bestandteile betraf, die später zur Konkursmasse gehörten. Die Bestrafung der bestandsbezogenen Handlungen diente demnach offenbar dem materiellen Verwertungs-/Befriedigungsinteresse der Gläubiger. Mit sachlichem Zusammenhang könnte daher gemeint sein, dass sich die bestandsbezogene Handlung des Täters und die eingetretene Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung auf dieselbe Sache (denselben Gegenstand), nämlich auf die zur Befriedigung der Gläubiger vorhandene Aktivmasse (die Konkursmasse), beziehen musste. Dies bedeutet aber zugleich, dass das RG auch hier eine konkrete Benachteiligung der Gläubiger verlangte.
c) Der „tatsächliche“ Zusammenhang als restringierendes teleologisches Korrektiv?
43
Die Analyse der reichsgerichtlichen Rechtsprechung zeigt, dass es dem Reichsgericht in allen zu entscheidenden Fällen um die Frage ging, ob das Verhalten des Schuldners im konkreten Einzelfall bestraft werden soll. Allgemein hängt diese Frage davon ab, ob der Schuldner durch sein Verhalten die Tatbestandsmerkmale eines Strafgesetzes verwirklicht hat.[108] Die Subsumtion unter den zugrundeliegenden Rechtssatz (in der Regel § 210 KO) bereitete jedoch zunächst keine Schwierigkeiten. Bereits die Koexistenz von schuldhafter Bankrotthandlung und tatsächlichem Konkurseintritt eröffneten nach dem Wortlaut der Norm eine Bestrafung des Täters. Die Entscheidungsgründe der reichsgerichtlichen Rechtsprechung zeigen jedoch, dass die Rechtsbegriffe des Bankrotttatbestandes nicht allein in ihrem grammatikalischen Sinne gedeutet wurden.[109] Obwohl das Geschehene unter den Tatbestand fiel, sollte die Rechtsfolge nicht eintreten, weshalb der Tatbestand mit einem zusätzlichen Unrechtsmerkmal „aufgefüllt“ wurde. Bei der Frage, ob die vom Schuldner vorgenommene Handlung und sein Konkurseintritt strafbarbedürftig sind, stellte das RG maßgeblich auf die konkrete Beeinträchtigung oder Gefährdung der Gläubiger im Einzelfall ab, was einige Passagen belegen:
– „Das Gesetz bedroht zwar den einfachen Bankrott mit Strafe, weil sich das Delikt als eine Gefährdung der Vermögensansprüche der Gläubiger darstellt. Das Interesse der Gläubiger ist daher auch der Grund, auf welchem sich die Grenzbestimmung aufbaut; ist dasselbe erloschen, so kann auch die erst demnächst begangene, sich als Bankrotthandlung darstellende Tat nicht mehr strafbar werden“.[110] – „Es besteht auch noch nach der Aufhebung des Konkursverfahrens ein Interesse der Gläubiger an dem Vorhandensein der Handelsbücher fort.“[111] – „Die in den §§ 209 ff. KO vorgesehenen Handlungen und Unterlassungen sind an sich nicht strafbar, solange nicht die durch die Zahlungseinstellung oder Konkurseröffnung bedingte Beeinträchtigung der Gläubigerrechte hinzutritt.“[112] – „Darin aber verkörpert sich gerade die Bedeutung der Tat als zu strafende Gefährdung der Gläubigerinteressen in dem Zustande der Zahlungseinstellung: ohne sie ist ein Bankrott, also auch der strafbare Bankrott, begrifflich nicht denkbar.“[113] – „Das Wesen des strafbaren Bankrotts blieb aber immer die Beeinträchtigung der Forderungsrechte der Gläubiger, welche in der Zahlungseinstellung oder Konkurseröffnung an den Tag tritt.“[114] – „Ein solcher Zusammenhang ergibt sich aus dem Urteil, denn es werden darin mehrere Gläubiger erwähnt, deren Forderung schon zur Zeit der Bankrotthandlung im Juni 1948-Februar 1949 bestanden, aber auch zur Zeit der Zahlungseinstellung (Ende April 1949) noch nicht getilgt waren.“[115] – „Die Bestrafung eines Schuldners nach § 240 Abs. 1 Nr. 1 KO kann nicht eintreten, wenn die durch Spiel verbrauchten übermäßigen Summen nicht aus dem Vermögen herrührten, das die Gläubiger zu ihrer Befriedigung in Anspruch nehmen konnten.“[116]44
Diese Passagen belegen, dass das RG die Bestrafung des Bankrotttäters davon abhängig machte, ob eine Beeinträchtigung der Gläubigerinteressen oder der Vermögensansprüche der Gläubiger im Einzelfall vorlag. Nach dem Willen des historischen Gesetzgebers wurde diese konkrete Auswirkung der Bankrotthandlung jedoch gerade vermutet bzw. unterstellt. Entsprechend der Deliktsstruktur der Konkursstrafbestimmungen fehlte gerade ein tatbestandlicher Rechtsgutsbezug, der bei Erfolgsdelikten durch das Erfolgsunrecht normiert wird. Diesen Umstand korrigierte das Reichsgericht mittels Auslegung, indem der fehlende tatbestandliche Rechtsgutsbezug über den „tatsächlichen Zusammenhang“ hergestellt wurde. Die Pönalisierung eines bloßen Verhaltens ohne unmittelbaren (kausalen) Schädigungserfolg erschien unangemessen. Das Unrecht der Tat wurde damit eindeutig erfolgsorientiert interpretiert. Ein Täter, der die Bankrotthandlung schuldhaft vornahm und bei dem Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung auch tatsächlich eingetreten sind, wurde nur dann bestraft, wenn zusätzlich ein tatsächlicher Zusammenhang zwischen Handlung und Beeinträchtigung der Interessen, Rechte, oder Positionen der Konkursgläubiger (verkörpert durch Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung) feststellbar war. Das durch Subsumtion unter den Normtext gefundene Ergebnis wurde im Wege einer ergänzenden, teleologischen Auslegung modifiziert, so dass eine Bestrafung des Täters nach § 210 KO von einer „irgendwie gearteten konkreten Gläubigergefährdung“ abhing. Diese Interpretation des Reichsgerichts impliziert jedoch im Mindestmaß einen Kausalzusammenhang zwischen Handlung und konkreter Gefährdung/Beeinträchtigung. Das Reichsgericht stellte dabei wahlweise auf die Interessen, das Vermögen, die Vermögensrechte oder die Forderungsrechte der Konkursgläubiger ab. Je nach Schutzobjekt erschien das Verletzbarkeitskriterium jedoch als überaus schwierig. Um die Grenzen des Wortlauts nicht zu überdehnen, wurde stattdessen darauf verwiesen, dass ein Kausalzusammenhang gerade nicht erforderlich sein soll. Diese formale Feststellung führt jedoch insgesamt zu einer inkonsistenten Interpretation, da das Reichsgericht im Kern einen Kausalzusammenhang prüfte und diesen lediglich umetikettierte. Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Geltungsbereich der Konkursordnung hatte damit die Aufgabe eine gesetzlich nicht fixierte Beziehung des Täterverhaltens zur Beeinträchtigung des geschützten Rechtsguts herzustellen. Der „tatsächliche Zusammenhang“ umschrieb damit im Kern den Zusammenhang zwischen Handlung und Rechtsgutsbeeinträchtigung bzw. Rechtsgutsgefährdung. Dafür spricht auch, dass das RG bis Anfang des 19. Jahrhunderts die Merkmale des Relativsatzes als Tatbestandsmerkmal eingeordnet hat.[117] Die Tatsache, dass der Zusammenhang nur ein Platzhalter war, birgt heute wie damals die Gefahr von Fehlinterpretationen, was eine Gefahr für Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit impliziert. Insbesondere das Verschleiern seiner wahren Bedeutung führte in der Folgezeit zu erheblichen Fehlinterpretationen und Anschlussproblemen.
Teil 1 Die dogmengeschichtliche Entwicklung › A. Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Geltungsbereich der Konkursordnung › III. Der „tatsächliche Zusammenhang“ in der Interpretation durch das konkursstrafrechtliche Schrifttum: Zusammenhang zwischen Handlung und Erfolg?
III. Der „tatsächliche Zusammenhang“ in der Interpretation durch das konkursstrafrechtliche Schrifttum: Zusammenhang zwischen Handlung und Erfolg?
45
Die Rechtsprechung des Reichsgerichts zum „tatsächlichen Zusammenhang“ wurde von einem breiten Schrifttum rezipiert.[118] Die Frage, wie sich der Gesetzgeber das Verhältnis dieser Tatsachen zueinander denkt, sei für die Auslegung von der allergrößten Bedeutung und hänge nach Ansicht des Schrifttums davon ab, was Gegenstand der Bestrafung gewesen sei.
Die Kernfrage sei, was der Gesetzgeber eigentlich verbietet?[119] Das konkursstrafrechtliche Schrifttum unternahm zwischen 1880 und 1950 vielfach den Versuch, den Bankrotttatbestand einer Deliktsart zuzuordnen und hierbei den Zusammenhang zwischen Tathandlung und Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung zu benennen.[120] Die Frage nach Erforderlichkeit und Inhalt des Zusammenhangs wurde hierbei an unterschiedlichen Stellen aufgeworfen: im Rahmen der Kommentarliteratur wurde der Problembereich „tatsächlicher Zusammenhang“ in der Regel bei der Frage, wie Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung im Hinblick auf den Gesamtunrechtstatbestand auszulegen sind, diskutiert. Mancherorts wurde vorab die Frage nach dem „Strafgrund“ und dem Wesen der Bankrottdelikte gestellt und dort auf den Zusammenhang zwischen Handlung und Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung Bezug genommen.[121] Andere stellten sich die Frage, worin das Hauptgewicht des „Unrechts“ liege: in der „Bankrotthandlung“ oder vielmehr im „Bankrottwerden“?[122] Die Vertreter des Schrifttums waren sich jedenfalls einig, dass der Bankrott „zu denjenigen Delikten gehört, welche sich am schwersten unter die allgemeinen Regeln subsumieren lassen und deren Stoff sich am sprödesten zeigt gegenüber den Versuchen, die allgemeinen Grundsätze des Strafrechts auf ihn anzuwenden.“[123] Die Interpretation des konkursstrafrechtlichen Schrifttums zeigte deutliche Parallelen zur Interpretation des Reichsgerichts. Nach einer breiten Auffassung im Schrifttum hingen die dogmatischen Grundlagenfragen im Rahmen des Bankrotts von der Bestimmung des „geschützten Rechtsguts“ ab. Auch das Schrifttum stellte wie das Reichsgericht die Belange der Konkursgläubiger in den Mittelpunkt der Auslegung. Anders als das Reichsgericht, bemühte sich das Schrifttum allerdings um eine begriffliche Erfassung und die inhaltliche Konkretisierung des „geschützten Rechtsguts“. Unerlässlich für das „materiale Unrecht“ eines Verbrechens sei jedenfalls eine „aggressive Gerichtetheit“, ein Angriff auf eben dieses Rechtsgut.[124]
a) Zum Stand der Rechtsgüterlehre des 19. Jahrhunderts
46
Außerordentlich umstritten zu dieser Zeit aber war der Begriff und die Funktion des „geschützten Rechtsguts“. Dogmengeschichtlich war die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts zunehmend damit beschäftigt, den Begriff des Verbrechens abstrakt generell zu erfassen und die Grenzen legitimer Bestrafung auszuloten.[125] Hierbei nahm der Begriff des Rechtsguts eine Schlüsselstellung ein. Das, was der Staat legitimerweise mit Strafe belegen dürfe, sei, wie bereits zu einem früheren Zeitpunkt von Feuerbach formuliert, auf eine Rechtsverletzung beschränkt: „Verbrechen ist eine durch das Strafgesetz bedrohte dem Recht eines Anderen widersprechende Handlung“.[126] Dem widersprach Birnbaum,[127] da das Recht weder vermindert noch entzogen werde, wenn der Gegenstand des Rechts, das Gut, vermindert oder entzogen wird.[128] Sonach gelte für die „Beziehung des in dem Verbrechensbegriff enthaltenen Merkmal der Verletzung “, dass dieser Begriff naturgemäß nicht auf den eines Rechts, sondern auf den eines Guts bezogen werden muss.[129] Birnbaum verstand unter strafbaren „Verbrechen“ eine dem Menschen zuzurechnende Verletzung oder Gefährdung eines Gutes, im Sinne eines körperlichen Gegenstandes (sog. Güterlehre/Schutzobjekttheorie).[130]
47
Der Streit um diese Güterschutzlehre erreichte gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Rahmen des sog. „Schulenstreits“ einen ersten Höhepunkt. Als Anhänger des Rechtspositivismus definierte Binding 1872 das Verbrechen als Verstoß gegen eine Norm. Schutzobjekt der Norm sei hierbei „alles, an dessen unveränderter und ungestörter Erhaltung das positive Recht ein Interesse hat, was deshalb durch seine Normen vor unerwünschter Verletzung oder Gefährdung zu sichern bestrebt ist.“[131] Geschützt werde nicht die Verletzung subjektiver Rechte, sondern die „Sicherstellung sämtlicher Bedingungen eines gesunden Rechtslebens, in welchem der Friede ungestört walte“.[132] Erst durch die Rechtsnorm werde ein Gegenstand zum Rechtsgut.[133] Der Begriff des Rechtsguts wurde zum zentralen Begriff in der Verbrechenslehre des Positivismus.[134] Dennoch war auch die Rechtsgüterlehre Bindings nicht geeignet, dem Gesetzgeber einen vorgelagerten Maßstab vorzugeben und damit die Grenzen eines legitimen Verbrechensbegriffs zu definieren. Da das Rechtsgut durch die Bildung eines Straftatbestandes und damit durch den Gesetzgeber selbst erschaffen wurde, hatte der Gesetzgeber die Macht, sich seine Grenzen selbst zu ziehen. Noch heute wird der Schlussfolgerung Bindings deshalb Zirkularität vorgeworfen.[135]
48
Eine breite Strömung in der Strafrechtswissenschaft begann diese klassische (positivistische) Schule zu kritisieren und die Frage nach dem Sinn und Zweck der Norm in den Mittelpunkt der Erörterungen über das Wesen eines Delikts zu stellen.[136] Vornehmlich Liszt und Ihering (Marburger Schule) lösten den Schulenstreit aus, da sie sich auch im Hinblick auf andere Fragen, nicht mit dem rein positivistischen Ansatz begnügten.[137] Die sog. „moderne Schule“ ernannte sodann die Ausrichtung am Zweckgedanken als oberstes Prinzip im Strafrecht.[138] Ihering stellte darauf ab, dass allein der Zweck „der Schöpfer des Rechts“ sei.[139] Nach der Ansicht von Liszt enthalte das Verbrechen etwas „Reales“ und etwas „Vergeistigtes“: Real sind Handlung und die dadurch (kausal) verursachte Veränderung des Handlungsobjekts (im Sinne eines Gegenstandes) der Außenwelt.[140] Das Handlungsobjekt müsse hierbei strikt vom Rechtsgut getrennt werden. Im Hinblick auf das Rechtsgut sei eine kausale Verletzung nicht möglich, weil das Rechtsgut kein Ding, sondern ein Begriff sei.[141] Von Verletzung oder Gefährdung eines Rechtsguts könne nur im übertragenen Sinne gesprochen werden (sog. vergeistigter Rechtsgutsbegriff), „jedes Rechtsgut verkörpere sich in einem Ding“.[142] Die Notwendigkeit einer Trennung von Rechtsgut und Angriffsobjekt wurde zunehmend gemeinsamer dogmatischer Nenner, wobei der Kern materiellen Unrechts noch immer wenig konkretisiert war.[143]
49
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war nicht nur die Definition des Begriffs Rechtsgut, sondern auch seine Stellung in der Verbrechenslehre und seine Bedeutung für die Praxis unklar.[144] Einigkeit bestand nur insofern, als dass auf dieses Konstrukt offenbar nicht verzichtet werden konnte.[145] Dennoch sorgte die bis dahin sehr vage Rechtsgüterlehre für Verwirrung und Unklarheit.[146] Aus heutiger Sicht kann die Rechtsgüterlehre zwar als eine der ersten „dogmatischen Früchte der freiheitlich-reformoptimistischen Epoche“[147] der Aufklärung bezeichnet werden, stand aber gleichzeitig im frühen Geltungszeitraum der Konkursordnung (1877-1920) noch in ihren Anfängen. Der dogmatische Ertrag der Rechtsgüterlehre, was Inhalt und Funktion des Rechtsguts in der Verbrechenslehre angeht, war gering.[148] Obgleich eine Definition fehlte, wurde das Rechtsgut zum Dreh- und Angelpunkt wissenschaftlicher Auslegung und auch entscheidendes Auslegungskriterium der Konkursstrafbestimmungen. Konsens im Hinblick auf eine allgemeine Verbrechenslehre bestand insofern, als dass ein strafbares Verbrechen jedenfalls ein Subjekt voraussetzt, das seinerseits ein (wie auch immer ausgestaltetes) Objekt positiv bewertet und damit zu seinem Gut erhebt, welches vom Täter (irgendwie) angegriffen wird.[149]
b) Das geschützte Rechtsgut der Konkursdelikte
50
Angesichts der Tatsache, dass der Begriff des Rechtsguts weder definiert noch in seiner Funktion bestimmt war, ist kaum verwunderlich, dass das Meinungsspektrum zum Rechtsgut der Konkursdelikte außerordentlich vielfältig war.[150] Gemeinsamer Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass die Norm an den eigenen Konkurseintritt des Schuldners anknüpft („...indem er seine Zahlungen einstellt, oder über sein Vermögen...“). Daher war Gegenstand einer breiten Diskussion, welchen Schutz Dritter der Gesetzgeber mit der Schaffung der Norm bezweckt haben könnte. Die überwiegende Ansicht sah das „geschützte Rechtsgut“ im Rahmen des Bankrotts, akzessorisch zur Konkursordnung, im „vermögensrechtlichen Schutz der vom Konkurs betroffenen Gläubiger“.[151] Geschützt werde also das „Vermögen der Gläubiger“.[152] Da das Vermögen jedoch ein bloßer Sammelbegriff sei, müsse näher konkretisiert werden, aus welchen schützenswerten Bestandteilen, Positionen und Zuständen sich der Begriff des Vermögens zusammensetze.[153] Die Einzelauffassungen hierzu reichen vom Vermögen in Gestalt der „Gläubigerforderungen“, über die „einzelnen Forderungsrechte“ der Gläubiger[154], bis hin zum „materiellen Befriedigungsrecht“ der Gläubigerschaft[155] oder aber den „fremden Vermögensrechten insgesamt“.[156]
51
Vermehrt wurde, in Anlehnung an Birnbaum, darauf hingewiesen, dass „das Recht“ der Gläubiger auf Erfüllung einer Forderung durch ihre Nichterfüllung nicht berührt werde.[157] Das geschützte Rechtsgut sei daher die den Forderungsrechten als Grundlage dienenden „Forderungen selbst“, und damit sämtliche Forderungen im wirtschaftlichen Sinne.[158] Andere vertraten mit Liszt,[159] dass das geschützte Rechtsgut „Interessen“ natürlicher Personen seien. Interesse sei hierbei „der Wert, den der Eintritt oder Nichteintritt einer Veränderung in der Außenwelt hat“. Für den Bankrott bedeutete dies, dass der Bankrotteur die „Aussicht der Gläubiger auf Befriedigung ihrer Forderungen“ verletze,[160] das geschützte Rechtsgut also die materiellen „Befriedigungsinteressen“ der Gläubiger seien.[161] Nur deshalb sei auch das Vernichten der Bücher mit Strafe bedroht, da die Gläubiger sich dann die „für die Wahrung ihrer Forderungen notwendige Kenntnis nicht beschaffen können.“[162] Ausgehend von diesen diversen Interpretationen des geschützten Rechtsguts ordneten die Vertreter die Tatbestandsmerkmale des Bankrotts neu. Fraglich war nunmehr, worin der Angriff des Täters auf dieses Rechtsgut lag, was also gleichsam das Unrecht der Bankrotttat ausmachte.