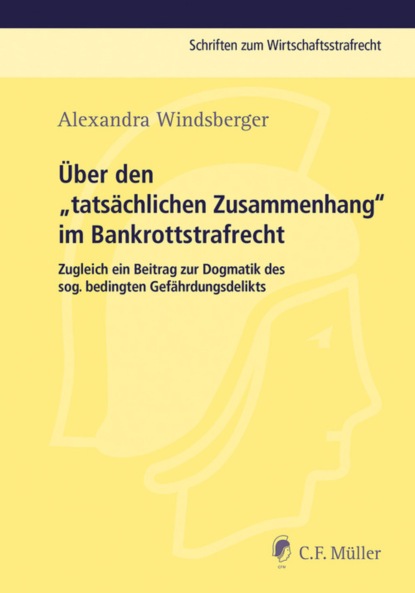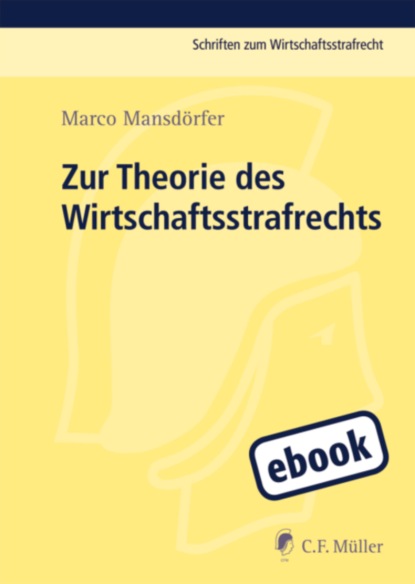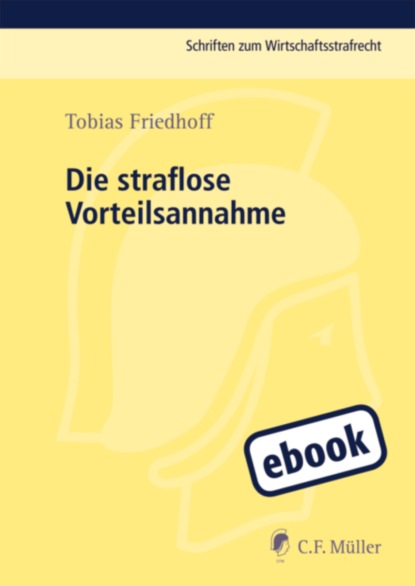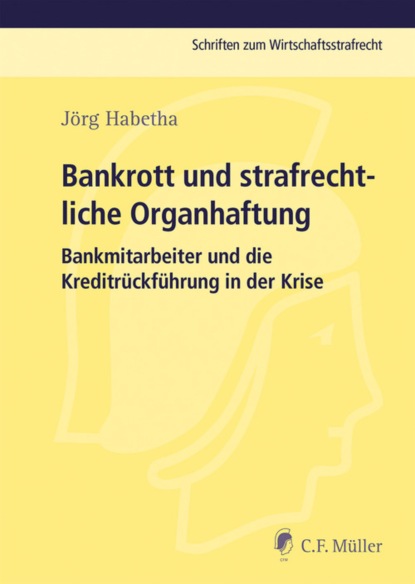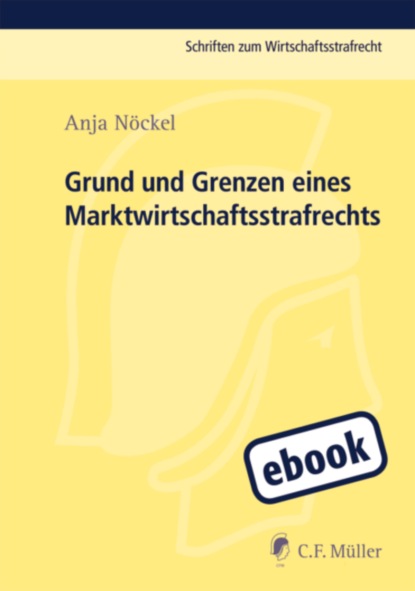- -
- 100%
- +
2. Der Relativsatz als Umschreibung der „Rechtsgutsbeeinträchtigung“
52
Ausgehend von der Prämisse, dass der Bankrott den Vermögensdelikten zuzuordnen sei und das Vermögen der Konkursgläubiger oder ihre Befriedigungsinteressen schütze, stellten sich die Autoren in einem zweiten Schritt die Frage, worin nun der Angriff durch den Bankrotteur auf dieses Rechtsgut liege.[163] Hierbei waren die Autoren der Ansicht, dass dem Relativsatz bei der Bestimmung des Unrechts entscheidende Bedeutung zukomme.[164] Die Elemente der Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung kennzeichneten gerade den „Vermögensverfall“, also den wirtschaftlichen Zusammenbruch des Schuldners, weshalb die „Rechtsgutsbeeinträchtigung“ gerade in diesem Umstand „zu Tage trete“.[165] Erst, wenn entweder eine Befriedigung der Gläubiger wegen Forderungsausfalls gänzlich unterbleibt (wegen ZE) oder aber die Gläubiger eine quotale Befriedigung hinnehmen müssen (nach einer Entscheidung des Gerichts im Konkursverfahren), sei „dieses“ Rechtsgut betroffen.[166] Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung besäßen mithin „rechtsgutsumschreibende Funktion“, der Eintritt des Bankrotts mache aus einer Handlung erst eine Bankrotthandlung.[167] Die Bankrotthandlung sei für sich genommen eine bloße Einwirkung auf den eigenen Vermögensstand, die ohne Eintritt des „Falliments“ straflos bleibe.[168] Für den Schutzzweck der Norm sei „die Herrschaftsbeziehung des Verletzten zu seinem Rechtsgute entscheidend, das durch die vom Täter ausgehende normwidrige Handlung angegriffen wird, welches bei den Konkursverbrechen erst durch die Zahlungseinstellung ins Dasein berufen wird“.[169] Die Konkurseröffnung bzw. Zahlungseinstellung verhalte sich daher zum Rechtsgut und dessen Subjekt wie „die Ursache zur Wirkung“.[170] Insofern folgte das Schrifttum den Ausführungen des Reichsgerichts. Die Merkmale der Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung seien daher den „Tatbestandsmerkmalen“ zuzuordnen.[171] Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung seien ein „objektives Merkmal bzw. Element der tatbestandsmäßigen Handlung “[172], eine Art „Erfolg“[173] oder ein besonderes persönliches Tätermerkmal.[174] Unabhängig davon, dass dem Relativsatz kein genauer Platz innerhalb des Tatbestandes zugewiesen werden konnte, spreche nach Ansicht der Vertreter jedenfalls der Sinn und Zweck der Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung für eine Einordnung als gesetzliches Tatbestandsmerkmal, wegen der Nähe dieser Merkmale zum geschützten Rechtsgut.[175]
3. Zusammenhang zwischen Bankrotthandlung und „Rechtsgutsbeeinträchtigung“?
53
Letztlich war offen, was nun das Verhalten des Täters mit der „Rechtsgutsbeeinträchtigung“, also der Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung, „zu tun haben“ musste.[176] Sieht man in den Merkmalen der Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung die Rechtsgutsbeeinträchtigung in Form der Schädigung oder Gefährdung des Vermögens der Gläubiger, ihrer Rechte oder ihrer Interessen, dann liegt die Annahme eines Kausalzusammenhangs zwischen Handlung und Konkurs nahe. Wenn gerade die Zahlungseinstellung jener Zustand ist, der die Befriedigungsinteressen oder das Vermögen der Gläubiger und damit das geschützte Rechtsgut gefährdet oder verletzt, weshalb Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung die Umstände sind, um deren Willen der Schuldner bestraft wird, dann kann der Schuldner außerdem nur dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn er diesen Umstand verschuldet.[177] Angesichts des eindeutigen Wortlauts und dem Willen des historischen Gesetzgebers sei jedoch auf beides gerade zu verzichten.[178] Stattdessen vertrat das Schrifttum in Anlehnung an das RG, dass der Zusammenhang zwischen Handlung und Rechtsgutsbeeinträchtigung ausnahmsweise kein Kausalzusammenhang sei, sondern ein „Zusammenhang sui generis“:
1.) Nach einer Ansicht sei das Verhältnis zwischen Bankrotthandlung und Bankrott durch einen schuldindifferenten äußeren, tatsächlichen Zusammenhang hinreichend beschrieben.[179] 2.) Die Gegenansicht sah ein, dass es sich im Kern um einen Kausalzusammenhang handelte. Um den Wortlaut der Vorschrift nicht zu überdehnen müsse dieser Kausalzusammenhang allerdings ausnahmsweise nicht positiv festgestellt werden, sondern werde präsumiert.[180]a) Der „tatsächliche Zusammenhang“ als „schuldindifferenter äußerer Zusammenhang“ zwischen Handlung und Erfolg?
54
Zur Begründung führten die Vertreter an, Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung seien lediglich „äußere Tatbestandsmerkmale“.[181] Danach bestehe der Tatbestand eines Deliktes nicht nur aus Tatbestandsmerkmalen, die vom Täter verschuldet werden müssen (Tathandlung und Erfolg), sondern darüber hinaus enthalte jeder Tatbestand weitere äußere, schuldindifferente Tatbestandsmerkmale.[182] Die Zahlungseinstellung sei als solche nicht verboten und müsse demgemäß auch nicht schuldhaft begangen werden.[183] Die Beziehung zwischen der Handlung und den schuldindifferenten Tatbestandsmerkmalen sei daher, wie vom RG zutreffend definiert, mit dem Begriff des „äußeren, tatsächlichen Zusammenhangs“ hinreichend erfasst.[184] Ein Definitionsvorschlag oder eine nähere Konkretisierung für diesen „Zusammenhang“ fehlte.
b) Der „tatsächliche Zusammenhang“ als „präsumtiver Kausalzusammenhang“?
55
Angesichts der Schwierigkeiten im Hinblick auf einen derart unbestimmten Zusammenhang, bediente sich die Gegenansicht sog. „Präsumtionen“.[185] Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung seien ein „Symptom“, ein „Indiz“,[186] für das Verursachen einer Rechtsgutsbeeinträchtigung.[187] Lägen die Merkmale der Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung vor, würden die Kausalbeziehung und die Schuld des Täters schlichtweg präsumiert.[188] Um von einem ahndungsbedürftigen Angriff des Täters ausgehen zu können, ohne zugleich eine kausale Rechtsgutsverletzung zu verlangen, sei zwar maßgeblich auf den Konkurseintritt abzustellen, allerdings gelte eine Besonderheit: Für den Fall, dass der Täter eine Bankrotthandlung vornahm und Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung tatsächlich (irgendwann) eintraten, werde nunmehr „vermutet“, dass eine „Rechtsgutsbeeinträchtigung“ (irgendwie, vermutlich kausal) stattgefunden hat.[189] Der bloße Eintritt von Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung genüge also, um annehmen zu können, dass die zuvor vorgenommene Bankrotthandlung die Gläubigerinteressen oder das Gläubigervermögen beeinträchtigt hat. Der Eintritt von Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung begründen demnach eine Vermutung dafür, dass durch die Bankrotthandlung die Gläubiger gefährdet oder geschädigt worden sind. Die Straftat des einfachen Bankrotts bestehe folglich in der „präsumtiven Verursachung eines Gläubigerschadens bzw. einer Gläubigergefährdung durch die Bankrotthandlung“, wobei dies bereits durch den Eintritt der Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung als bewiesen gilt.[190] Präsumiert werde damit bei Vorliegen von Bankrotthandlung und Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung der „Schädigungserfolg“, der kausale Zusammenhang zwischen dem Täterverhalten und dem präsumierten Erfolg und der Schuldvorwurf (sog. Präsumtionstheorie).[191] Das Gesetz enthalte mithin eine Fiktion, indem es alle Bankrotthandlungen, in denen der ursächliche Zusammenhang zur Zahlungseinstellung nicht bewiesen, nicht vorhanden oder sogar unmöglich ist, denjenigen, in welchen er nachweisbar ist, unter die gleiche Strafandrohung stellt.[192]
56
Die Verwendung solcher gesetzlicher Präsumtionen sei hierbei eine verfahrensökonomische Notwendigkeit.[193] Sie fänden ihre Rechtfertigung in der Methode des Gesetzgebers bei der Schaffung von Gesetzen.[194] Jeder Deliktstypus im Strafrecht komme auf dem Weg der Abstraktion zu Stande, was bedeutet, dass der Gesetzgeber auf bestimmte Merkmale im Gesetz abstellt, während er andere Merkmale unberücksichtigt lässt, um eine möglichst große Zahl von Einzelfällen tatbestandlich zu erfassen.[195] Verzichtet der Gesetzgeber hierbei auf wichtige Merkmale, so läge der Grund dafür stets in dem Bestreben Beweisschwierigkeiten zu vermeiden.[196] Je schwieriger also einzelne Merkmale zu beweisen sind, umso größer sei „die Versuchung, sie womöglich nicht mit aufzunehmen“.[197] Je einfacher aber die deliktische Natur, umso leichter ist die Anwendbarkeit und damit die Praktikabilität der Norm. Auf den Bankrotttatbestand angewandt bedeutete dies, dass das Gesetz auf die nach außen unproblematisch in Erscheinung tretenden Merkmale A (hier: Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung) und B (Vornahme der Bankrotthandlung) abstellte, obwohl außer diesen Beiden noch ein weiteres Merkmal C den „rechtlichen Unwert“ der Tat mitbestimme (= sog. praesumptio juris et jure).[198] Dieses zusätzliche Merkmal (C) bestünde in der Schädigung des Handlungsobjekts, vielfach „Rechtsgutsverletzung“ genannt, wobei sich die Vertreter nicht einig waren, ob es sich um die Verletzung oder nur die Gefährdung des Vermögens der Gläubiger handeln sollte. Dies hing auch damit zusammen, dass nicht klar war, wie ein Interesse oder sonstige ideelle Objekte (Sicherheit des Handels) überhaupt „verletzt“ werden können. Würde der Gesetzgeber aber den Eintritt einer konkreten Gläubigergefahr oder gar eines Gläubigerschadens verlangen, so müsste diesbezüglich immer auch Kausalität, Vorsatz und Schuld nachgewiesen werden können. Dieser Nachweis wird nur oftmals schwer zu erbringen sein, vor allem in Bezug auf die Herbeiführung des eigenen Konkurses. Deshalb sei der Tatbestand des Bankrotts so konzipiert, dass, falls der Beweis für A (Eintritt der Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung) und B (schuldhafte Vornahme der Handlung) erbracht werden kann, die Tatsache C (Rechtsgutsbeeinträchtigung) als erwiesen angesehen wird.[199] Die Zulässigkeit dieser Vorgehensweise, die zu Recht scharf kritisiert wurde,[200] hänge hierbei entscheidend von dem Verhältnis zwischen A/B und C ab. Wenn das Merkmal C notwendigerweise mit A/B verbunden sei, soll es sich um eine unschädliche Präsumtion handeln.[201] Für diesen Fall seien Präsumtionen unbedenklich, da nur „diejenigen Handlungen vertatbestandlicht werden, die typischerweise, also regelmäßig mit einer Rechtsgutsgefährdung verbunden sind“, ergo „je typischer die Handlung für die Rechtsgutsgefährdung ist, desto erträglicher wird die Präsumtion“.[202] Anders liegt der Fall, wenn C niemals oder nur selten mit B verbunden ist. Dann handele es sich um eine Präsumtion in Form einer „Fiktion im objektiven Sinn“, die zu unerträglichen Ergebnissen führe, weil es zu einer Vielzahl an Fehlbewertungen von konkreten Einzelfällen käme.[203] Die Vertreter der Präsumtionstheorie stellten hierbei fest, dass bei einem der Schuldner, der seine Zahlungen einstellte davon ausgegangen werden könne, dass er tatsächlich zahlungsunfähig ist.[204] Für den Fall der Zahlungsunfähigkeit könne sicher davon ausgegangen werden, dass die Befriedigungsinteressen der Gläubiger betroffen sind.[205] Strittig war nur, wie mit den Fällen umzugehen war, in denen eine Rechtsgutsbeeinträchtigung „widerlegt “ werden konnte. Wenn die Beeinträchtigung der Gläubigerinteressen nachweisbar auf einer völlig anderen Ursache beruhte, wie z.B. ein Konkurs basierend auf Zufall, Krieg oder Naturkatastrophe, sah die überwiegende Auffassung die Präsumtion als widerlegt an.[206] Die Handlung des Schuldners hatte dann erwiesenermaßen nichts mit der Rechtsgutsbeeinträchtigung zu tun. Eine Einschränkung des Tatbestandes sei da geboten, „wo der Erfolg aus einem ganz anderen als dem mit der Handlung in Verbindung stehenden Ursachenkomplex hervorgegangen ist.“[207] Wenn der Täter eine erwiesen ungefährliche Handlung vorgenommen hat, könne er nicht bestraft werden.[208]
4. Zweite Zwischenbetrachtung: Der „tatsächliche Zusammenhang“ als verkappter Kausalzusammenhang?
57
Das Abstellen auf einen „schuldindifferenten, äußeren Zusammenhang“ entbehrt jeder nachvollziehbaren Begründung und kann bereits auf Grund der Unmöglichkeit einer begrifflichen Konkretisierung nicht Ernst genommen werden. Die Präsumtionstheorie basiert auf Fiktionen und Unterstellungen.[209] Es ist zudem mit allen Auslegungsregeln unvereinbar, einen Kausalzusammenhang zu vermuten, da „die Vermutung des Kausalzusammenhangs weiter zu einer Vermutung der Schuld in Beziehung auf die Herbeiführung dieses Zusammenhangs“ nötigt.[210] Der „tatsächliche Zusammenhang“ in der Interpretation des frühen Reichsgerichts und des oben skizzierten Schrifttums, das in Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung die Umschreibung des geschützten Rechtsguts sieht, ist letztlich ein verkappter, umetikettierter Kausalzusammenhang, der außerhalb eines Schuldzusammenhangs bestehen soll.
Teil 1 Die dogmengeschichtliche Entwicklung › A. Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Geltungsbereich der Konkursordnung › IV. Stellungnahme: Der „tatsächliche Zusammenhang“ als Hilfsmittel einer erfolgsorientierten Auslegung
IV. Stellungnahme: Der „tatsächliche Zusammenhang“ als Hilfsmittel einer erfolgsorientierten Auslegung
58
Die Konstruktion des Bankrottdelikts in Anlehnung an Napoleons code de commerce, schaffte die Grundlage für die Erfindung des „tatsächlichen Zusammenhangs“, da unter Umständen neutrale Handlungen, die durch ein zufälliges Ereignis qualifiziert wurden, erheblich (Gefängnisstrafe) bestraft werden konnten. Das Anwendungsproblem des RG und des Schrifttums war, dass der vom Gesetzgeber gefasste Rechtssatz keinen unmittelbaren tatbestandlichen Bezug zu dem geschützten Rechtsgut erforderte. Das Unrecht der Tat wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts jedoch ausschließlich vom Erfolg her begriffen. In dieses System konnte jedoch ein Rechtssatz wie der einfache Bankrott (als bloßes Tätigkeitsdelikt) nicht eingeordnet werden. Der „präsumtive Kausalzusammenhang“ bzw. der „schuldindifferente Kausalzusammenhang“ war demnach ein „Hilfsmittel“ der Strafrechtswissenschaft die befürchtete Systemwidrigkeit einer Norm, die auf ein Erfolgsunrecht verzichtet, zu umgehen.[211] Mithilfe dieses „Kunstgriffs“ wurden die Strafrechtssätze der KO auf das vorherrschende System, das sich durch die Erfolgsbezogenheit der Tat auszeichnete, angepasst. Da diese Methode sich jedoch fiktiver Instrumente bedient, ohne den Strafrechtssatz an sich zu prüfen, muss der hiernach ausgerichtete „tatsächliche Zusammenhang“ letztlich als Teil des Problems bezeichnet werden. Der Zusammenhang diente letztlich dazu, die erfolgsgeneigte Interpretation und der damit zwingende Verstoß gegen das Erfordernis einer Korrespondenzbeziehung zwischen Unrecht und Schuld zu kaschieren. Die Konstruktion des „tatsächlichen Zusammenhangs“ ist daher insgesamt dogmatisch inkonsistent. Zusammenfassend lassen sich folgende Einwände ausmachen:
1.) Die Argumentation hängt maßgeblich vom geschützten Rechtsgut ab, ohne an irgendeiner Stelle zu definieren, was ein Rechtsgut im Allgemeinen ist. 2.) Der „tatsächliche Zusammenhang“ stellt einen verkappten Kausalzusammenhang dar, der gegen das Schuldprinzip verstößt.[212] 3.) Der Wortlaut, die historische Entwicklung und teilweise der Sinn und Zweck der Norm sprechen gegen das Erfordernis eines Kausalzusammenhangs zwischen Handlung und Konkurs.[213] 4.) Eine Übertragung des Zusammenhangs auf Versuchs- und Teilnahmekonstellationen führt zu erheblichen Inkonsistenzen.[214]a) Strafe ohne Schuld
59
Die Behauptung, der „tatsächliche Zusammenhang“ sei kein Kausalzusammenhang, weil er schuldindifferent sei, ist insgesamt widersprüchlich. Diese Annahme basiert auf inkonsistenten Prämissen:
– Einerseits wird behauptet, Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung verkörperten die Rechtgutsbeeinträchtigung und seien daher für das Unrecht der Tat konstitutiv. – Gleichzeitig müssten Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung nicht von der Schuld des Täters umfasst sein. – Daraus wird geschlossen, dass zwischen Handlung und Rechtsgutsbeeinträchtigung ein schuldindifferenter Zusammenhang bestehen müsse.60
Die ersten beiden Annahmen sind inkonsistent. Die Behauptung, es bedürfe eines äußeren „tatsächlichen Zusammenhangs“, basiert nur darauf, dass angenommen wird, Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung besäßen einerseits „Unrechtsrelevanz“ und müssten gleichzeitig aus dem Schuldzusammenhang ausgeklammert werden. Darin liegt ein offensichtlicher Widerspruch. Die positive Anordnung, dass sich die Schuld nicht auf den Konkurs beziehen soll, wird zirkelschlussartig als Grund dafür angegeben, dass sich die Schuld nicht darauf beziehen muss. Mit der Kennzeichnung, Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung und der erforderliche Zusammenhang seien „schuldindifferent“, ist nur eine formale Feststellung getroffen, die einer sachlichen Begründung entbehrt. Heute kann als gesichert angenommen werden, dass der Schuldgedanke, als oberstes Prinzip gerechter Zurechnung[215], im Mindestmaß eine „Entsprechung von Unrecht und Schuld“[216] fordert und zwar in dem Sinne, dass sich innere und äußere Tatseite decken. Der Unrechtsbegriff darf daher nichts enthalten, was in einen Schuldzusammenhang nicht integrierbar ist.[217] Wenn alle Strafe Schuld voraussetzt,[218] so ergibt sich daraus jedenfalls, dass alle unrechtsrelevanten und damit strafbegründenden Merkmale des gesetzlichen Unrechtstatbestandes von der Schuld erfasst sein müssen.[219] Es sind mithin keine Umstände denkbar, die auf die Bewertung der Tat als strafbar oder straflos einen Einfluss haben, das Unrecht der Tat also mitbegründen, und gleichzeitig außerhalb der Schuld stehen.[220] Spricht man Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung Unrechtsrelevanz zu, weil sie gerade die Rechtsgutsverletzung umschreiben, so sind sie Teil des Unrechts und daher muss sich die Schuld auf diesen Umstand beziehen.[221] Die oben genannten Annahmen, Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung seien einerseits eine Art Erfolg, der aber andererseits aus dem Schuldzusammenhang ausgeschlossen ist, enthalten zwangsläufig einen inneren Widerspruch und führen daher zu einem Verstoß gegen das Kongruenzgebot. Bestimmt sich die Verantwortlichkeit auf diese Weise allein nach dem „außenweltlichen Geschehen“[222], also dem Vorliegen objektiver Merkmale, ohne Rücksicht auf die subjektiven Bewusstseinsinhalte des Täters, so handelt es sich um frühmittelalterliche Erfolgshaftung.[223] Ausnahmen von der Korrespondenzbeziehung zwischen Unrecht und Schuld werden mittlerweile nur im Hinblick auf objektive Bedingungen der Strafbarkeit anerkannt, da diese regelmäßig unrechtsirrelevant seien, also völlig außerhalb des Unrechts stünden.[224] Nach Ansicht des RG und des oben genannten Schrifttums handelt es sich bei Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung jedoch gerade um Tatbestandsmerkmale und nicht um bloße Strafbarkeitsbedingungen. Der „tatsächliche Zusammenhang“, verstanden als äußerer Zusammenhang zwischen Handlung und Rechtsgutsbeeinträchtigung, stellt damit eine unzulässige Ausnahme vom grundsätzlichen Erfordernis einer Korrespondenz zwischen Unrecht und Schuld dar. Nichts anderes ergibt sich, wenn man die beiden unrechtskonstitutiven Merkmale nicht ausklammert, sondern präsumiert.[225] Dies läuft dann auf eine „praesumtio culpa“ hinaus, da letztlich auch die Schuld im Hinblick auf diesen Teil des Unrechts vermutet wird.[226] Dies erinnert an das primitive Strafrecht des Mittelalters, das auf ein Verschulden des Täters keine Rücksicht nahm und stattdessen die verstaatlichte Rache gegen den schuldlosen Urheber einer Verletzung ermöglichte.[227] Die Abwendung vom Prinzip der Erfolgshaftung und die Hinwendung zu einem Schuldstrafrecht gilt aber als eine der bedeutendsten Errungenschaften eines gerechten Strafrechts.[228] Anders als unter Geltung der Erfolgshaftung bestimmt sich strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht mehr nur objektiv nach dem außenweltlichen Geschehen, sondern auch und maßgeblich nach dem subjektiven Bewusstsein, d.h. die strafrechtliche Zuschreibung hängt von der subjektiven Zurechnung der Tat ab, auf die hier unzulässigerweise verzichtet wird.[229]
b) Auslegung contra legem
61
Gegen das Erfordernis von Kausalität zwischen Handlung und Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung und damit gegen das Erfordernis einer konkreten Gläubigerbenachteiligung sprechen überdies der Wortlaut und die historische Entwicklung der Konkursstrafbestimmungen. Der Rechtssatz lautete gerade nicht: Schuldner, welche eine der Bankrotthandlungen vornehmen und dadurch ihre Gläubiger gefährden oder schädigen, werden bestraft. Außerdem erfasst der Bankrotttatbestand unstreitig auch solche Fallkonstellationen in denen die Bankrotthandlung der Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung nachfolgt. Die Einordnung als „Indiz“ versagt damit in Konstellationen, in denen Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung vor der Vornahme der Bankrotthandlung vorliegt, was dem Begriff eines Symptoms oder Indiz widerspricht.[230]
2. Anschlussprobleme
62
Neben der dogmatischen Unvereinbarkeit des „tatsächlichen Zusammenhangs“ mit den allgemeinen Prinzipien des Strafrechts, führte eine Übertragung dieses Konstrukts zu diversen Anschlussproblemen. Da es bei der Erfindung des „tatsächlichen Zusammenhangs“ durch das Reichsgericht um die Aufnahme und Ausbildung neuer Rechtsgedanken ging, deren Realisierung den ursprünglichen Plan des Gesetzgebers modifizierte,[231] wurde diese neu aufgestellte Maxime[232] von nun an auf sämtliche Fälle des Bankrotts übertragen. Es ist kaum verwunderlich, dass die Anwendung und Übertragung des, wie oben beschriebenen Zusammenhangs, in der Folgezeit zu erheblichen Anschlussproblemen führte. Die von den meisten Senaten gebilligte grundsätzliche Anerkennung eines „tatsächlichen Zusammenhangs“ führte bei dem Versuch, diesen Zusammenhang auf Fragen des allgemeinen Teils anzuwenden, zu unlösbaren Schwierigkeiten. Da sich dieser Zusammenhang von den allgemeinen Kategorien wie Kausalität und objektive Zurechnung gerade abheben sollte, gab es im Hinblick auf seine Bedeutung für Vorsatz, Versuchsbeginn und Teilnahme diverse Schwierigkeiten.
a) Beginn der Strafverfolgungsverjährung?
63
Ungeklärt war beispielsweise von welchem Merkmal der Beginn der Verjährung abhängen sollte. Wenn die Verjährung mit Eintritt des Konkurses beginnen soll, wird man zugeben müssen, wie bereits von Wach zutreffend erwähnt, dass „unbegrenzte Zeit zwischen dem Konkurs und der ihr vorausgehenden Bankerutthandlung liegen kann“.[233] Dann aber kann die Strafbarkeit völlig unbegrenzt in die Zukunft verlagert werden.[234] Der „tatsächliche Zusammenhang“ enthielt hierbei jedenfalls keine verbindliche zeitliche Grenze für den Beginn der Verjährung sofern der Konkurs der Handlung nachfolgte. Für den umgekehrten Fall, die Tathandlung erfolgt nach Eintritt des Konkurses, stellte der 1. Senat[235] lediglich auf das Interesse der Gläubiger ab. Der Beginn der Strafverfolgungsverjährung stünde dann aber zur Disposition der Gläubiger, was zweifelhaft erscheint.
b) Inkonsistenzen im Bereich der Versuchsstrafbarkeit
64
Der 1. Senat hatte die Frage zu beantworten, ob eine Versuchsstrafbarkeit wegen Bankrotts vor Eintritt des Konkurses möglich sein konnte.[236] In der Begründung wurde zunächst festgestellt, dass, sofern der Täter zu einer der beschriebenen Tathandlungen „unmittelbar ansetzt“, eine Versuchsstrafbarkeit vorliegt, auch wenn eine Zahlungseinstellung nicht erfolgt.