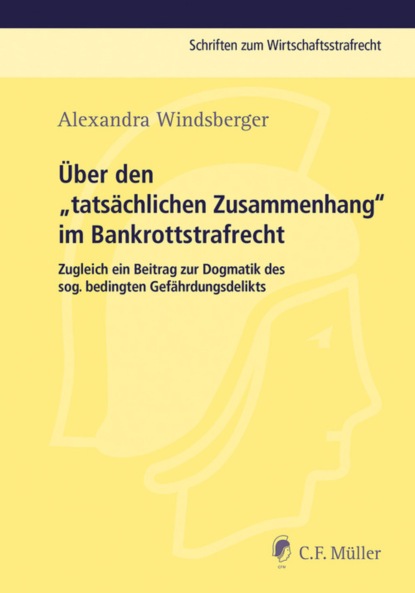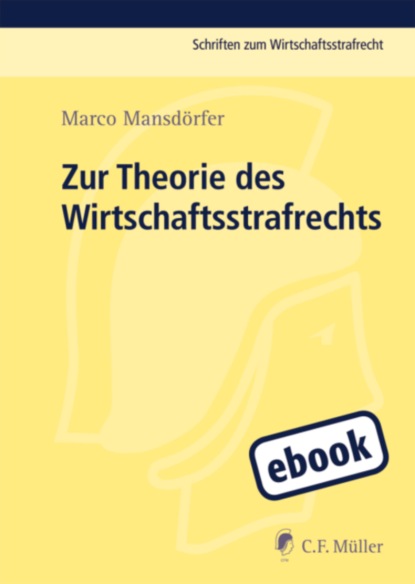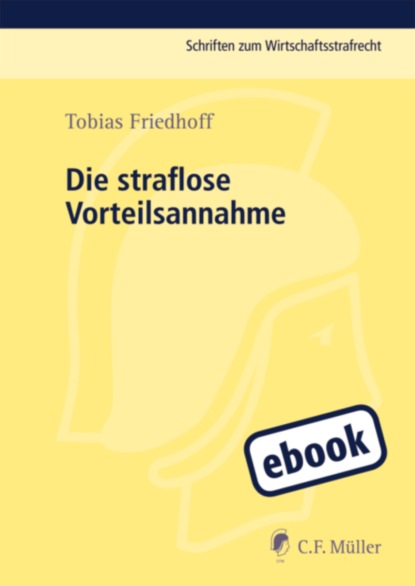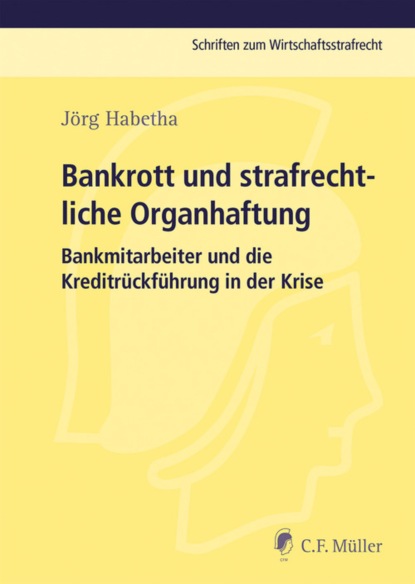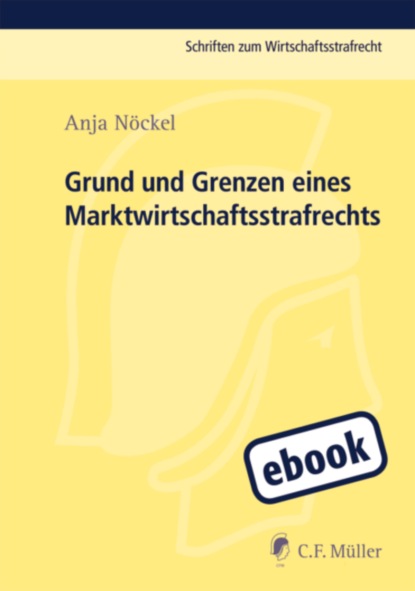- -
- 100%
- +
Es entspreche allgemeiner Überzeugung, dass „der Versuch nicht verlangt, dass ein Anfang der Ausführung aller Tatbestandsmerkmale vorliege, sondern es genügt, dass der Täter in Voraussicht oder Erwartung der Zahlungseinstellung, absichtlich zur Benachteiligung der Gläubiger Vermögensstücke beiseite schafft“.[237]
65
Damit bejahte der 1. Senat, der seinerseits Vertreter des „tatsächlichen Zusammenhangs“ war, eine Strafbarkeit wegen versuchten Bankrotts, ohne auf das Erfordernis eines „tatsächlichen Zusammenhangs“ einzugehen.[238] Der 1. Senat, der sich einige Jahre zuvor für das grundsätzliche Erfordernis eines Zusammenhangs aussprach, wendete diesen bewusst nicht auf den Versuch an, da er ansonsten genötigt gewesen wäre, darzulegen, ob und inwieweit der „tatsächliche Zusammenhang“, der nicht Kausalzusammenhang ist, antizipierbar wäre und subjektiv bezogen werden muss. Dies bedeutete aber, dass nach Ansicht des Reichsgerichts der Vollendungstäter auf das Fehlen des „tatsächlichen Zusammenhangs“ und damit auf ein strafbarkeitseinschränkendes Korrektiv hoffen konnte, der Versuchstäter hingegen nicht. Dann aber würde die Versuchsstrafbarkeit härter bestraft werden als die vollendete Tat, was systemwidrig erscheint.
c) Inkonsistenzen im Bereich der Teilnahmestrafbarkeit
66
Ebenso große Schwierigkeiten bereitete die Übertragung des Korrektivs auf die Fälle der Teilnahme am Bankrott. In einer Entscheidung des 4. Senats vom 2.7.1895[239] wegen Beihilfe zum Bankrott war wegen des Grundsatzes der limitierten Akzessorietät zu klären, welche Anforderungen an den doppelten Gehilfenvorsatz zu stellen sind.
„(...) Hierin (in der Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung) ist vom Gesetze ein Tatbestandsmerkmal fixiert, nicht eine Voraussetzung der Strafverfolgung oder eine objektive Bedingung der Strafbarkeit. Als Strafbarkeitsbedingungen insbesondere lässt man nur Umstände gelten, welche zu der Tat als ihr innerlich fremde hinzutreten, nicht die Elemente der Tat selbst. Hier aber verkörpert sich gerade die Bedeutung der Tat als zu strafende Gefährdung der Gläubigerinteressen in dem Zustande der Zahlungseinstellung: ohne sie ist ein Bankrott, also auch der strafbare Bankrott, begrifflich nicht denkbar. Sonach ergibt sich, dass auch dieses Tatbestandsmerkmal in der Weise, wie es seiner Bedeutung entspricht, vom Vorsatze umfasst werden muss. Unbestritten wird nicht erfordert und kann bei einzelnen Begehungsformen nicht erfordert werden, dass die Bankrotthandlung die Zahlungseinstellung (Konkurseröffnung) verursacht habe. Es hat sich folglich der Vorsatz nicht in der Richtung geltend zu machen, dass der Schuldner in der Voraussicht handele, dass seine Tat jenen Erfolg haben werde. Dagegen kann aus diesem Umstand nicht die Folgerung abgeleitet werden, dass nunmehr die Zahlungseinstellung außer allem und jedem Zusammenhange mit der Willensrichtung des Täters stehen dürfe. Wie jederzeit eine objektive Beziehung der Bankrotthandlung zur Zahlungseinstellung (Konkurseröffnung) vorhanden sein muss, um die Strafbarkeit der Tat zu begründen, so muss auch die Erkenntnis, dass solche Beziehung bestehe, ein Element des Vorsatzes bilden, also ein Handeln in dem Bewusstsein vorliegen, dass der Bankrotthandlung eine Zahlungseinstellung (Konkurseröffnung) vorangegangen sei oder in einem Zeitpunkte, der jene Beziehung noch zulässt, nachfolgen werde.“[240]
67
Eine Bestrafung des Gehilfen hing demnach davon ab, ob ihm subjektiv die Erkenntnis, „dass eine objektive Beziehung zwischen Handlung und ZE besteht“, nachgewiesen werden konnte. Hier offenbart sich in aller Deutlichkeit die Vagheit und Unbestimmtheit des „tatsächlichen Zusammenhangs“ und die sich daraus ergebene Unmöglichkeit, ihn als Korrektiv auf sämtliche Fälle des Bankrotts zu übertragen.
3. Zusammenfassung
68
Ziel des RG war es, mit Hilfe des Zusammenhangs eine sachgerechte Rechtsanwendung zu gewährleisten und einen Strafgrund des Bankrotts auszumachen.[241] Als entscheidend wurde hierbei die (schädliche) Wirkung der Bankrotthandlung in der Außenwelt angesehen. Die Pönalisierung einer bloßen Handlung, ohne eine solche „drittschädigende Wirkung“, wurde als „unangemessen“ empfunden.[242] Zusammenfassend:
1.) Der „tatsächliche Zusammenhang“ ist ein übergesetzliches strafbarkeitseinschränkendes Korrektiv in Form eines Zusammenhangs zwischen Handlung und Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung, der einen Bezug zwischen Handlung und Schädigungserfolg in der Außenwelt herstellt. 2.) Der „tatsächliche Zusammenhang“ kann als schuldindifferenter Zusammenhang dogmatisch nicht abgesichert werden. 3.) Der „tatsächliche Zusammenhang“ entspricht inhaltlich einem Kausalzusammenhang zwischen Bankrotthandlung und der Benachteiligung/Gefährdung der Konkursgläubiger.Anmerkungen
[1]
Hagemeier in: Steinberg/Valerius/Popp, Wirtschaftsstrafrecht, 129 (134); Lindemann Voraussetzungen und Grenzen legitimen Wirtschaftsstrafrechts, S. 196; Lackner in: Lackner/Kühl, StGB, § 283 Rn. 29; Hoyer in: SK-StGB, Bd. V, Vor § 283 Rn. 2; Radtke/Petermann in: MüKo-StGB, Vor § 283 Rn. 106 f.; D.-M. Krause Ordnungsgemäßes Wirtschaften, S. 305; Tiedemann in: LK-StGB 9. Bd., Vor § 283 Rn. 92; Penzlin Strafrechtliche Auswirkungen der InsO, S. 185; Richter in: Müller-Gugenberger, Wirtschaftsstrafrecht, § 81 Rn. 11; Weyand/Diversy Insolvenzdelikte, Rn. 59; Geisler Objektive Bedingungen der Strafbarkeit, S. 402; Fischer StGB, Vor § 283 Rn. 17. Differenzierend: Bittmann in: Bittmann, Insolvenzstrafrecht, § 12 Rn. 314 ff. und Dannecker/Hagemeier in: Dannecker/Knierim/Hagemeier, Insolvenzstrafrecht, Rn. 1017 ff.
[2]
BGHSt 1, 186 (186 ff.); GA 1954, 73; JZ 1979, 75; MDR 1981, 454; BGHSt 28, 231 (232) = JR 1979, 512; NStZ 2008, 401; NJW 2009, 3383; NStZ 2012, 89; wistra 2014, 354 (354).
[3]
BGH Urt. v. 8.5.1951, BGHSt 1, 186 (186).
[4]
Deutsches Reichsgesetzblatt 1898, S. 612.
[5]
Beispielsweise auf RG Urt. v. 21.11.1881, RGSt 5, 415; Urt. v. 8.10.1883, RGSt 9, 134; Urt. v. 8.12.1884, RGSt 11, 386; Urt. v. 8.6.1920, RGSt 55, 30.
[6]
RG Urt. v. 21.11.1881, RGSt 5, 415 (415).
[7]
Wortgleich mit § 239 KO in der Fassung vom 20.5.1898.
[8]
Wortgleich mit § 240 KO in der Fassung vom 20.5.1898.
[9]
Ein Überblick über die Geschichte des deutschen Konkursstrafrechts u.a. bei Meier Die Geschichte des deutschen Konkursrechts, S. 35; Neumeyer Bankrott, S. 1; Diethelm Die Tatbestände der Insolvenzstrafbestimmungen, S. 18.
[10]
Hahn Materialien zur Konkursordnung, S. 404; Bauer Der betrügliche und der einfache Bankrott, S. 1; Hälschner Strafrecht, 2. Bd., S. 399; Sarwey in: Sarwey, KO für das deutsche Reich, Vor § 209 Rn. 1.
[11]
Bauer Der betrügliche und der einfache Bankrott, S. 1.
[12]
Siehe § 239 KO: Schuldner, welche ihre Zahlungen eingestellt haben, oder über deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist, werden wegen betrüglichen Bankerutts mit Zuchthaus bestraft, wenn sie in der Absicht, ihre Gläubiger zu benachteiligen, 1. Vermögensstücke verheimlicht oder bei Seite geschafft haben, 2. Schulden oder Rechtsgeschäfte anerkannt oder aufgestellt haben, welche ganz oder teilweise erdichtet sind, 3. Handelsbücher zu führen unterlassen haben, deren Führung ihnen gesetzlich oblag, oder 4. ihre Handelsbücher vernichtet oder verheimlicht oder so geführt oder verändert haben, dass dieselben keine Übersicht des Vermögenszustandes gewähren. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter drei Monaten ein.
[13]
„Der Bankrott setzt sich aus zwei Momenten zusammen, der Zahlungseinstellung und der Handlung“, Hahn Materialien zur Konkursordnung, S. 404; Jäger Konkursordnung, § 240 Rn. 1.
[14]
Hälschner Strafrecht, 2. Bd. S. 404.
[15]
Darras in: Cohendy, code de commerce, tome deuxième, Art. 585 Rn. 1; Sirey in: Sirey, code commerce, tome second, Art. 585 Rn. 1.
[16]
Neumeyer Bankrott, S. 113; Meier Die Geschichte des deutschen Konkursrechts, S. 87; Diethelm Die Tatbestände der Insolvenzstrafbestimmungen, S. 45; Köstlin GA 1857, 722 (729); Hälschner Strafrecht, 2. Bd. S. 404.
[17]
Nach Art. 584 und 585 des code de commerce.
[18]
Nach Art. 591 ff. des code de commerce.
[19]
Art. 595 code de commerce: Sera déclaré banqueroutier simple tout commercant failli qui se trouvera dans un des cas suivants, (...).
[20]
Art. 585 Nr. 1 code de commerce.
[21]
Art. 585 Nr. 2 code de commerce.
[22]
Art. 585 Nr. 3 code de commerce.
[23]
Sirey in: Sirey, code commerce, tome second, Art. 586 Nr. 13.
[24]
Neumeyer Bankrott, S. 125.
[25]
Darras in: Cohendy, code de commerce, tome deuxième, Art. 586 Rn. a und b.
[26]
Neumeyer Bankrott, S. 112.
[27]
Eingehend dazu Vormbaum Strafrechtsgeschichte, S. 116 ff.
[28]
Neumeyer Bankrott, S. 126; Olshausen Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, 2. Bd., S. 1523; Frank StGB für das deutsche Reich, S. 644.
[29]
Art. 586 code de commerce: „Sera poursuivi comme banqueroutier simple et pourra être declare tel, le commercant failli qui se trouvera dans l‘un ou plusieurs des cas suivants, savoir [...]“. Tauglicher Täter war daher nur der „fallit-gewordene“, „gescheiterte“, „wirtschaftlich zusammengebrochene“ oder „zahlungsunfähige“ Kaufmann, Oppenhoff in: Goltdammer, Materialien, Teil 2, S. 592.
[30]
Darras in: Cohendy, code de commerce, tome deuxième, Art. 586 Rn. d.
[31]
Sirey in: Sirey, code commerce, tome second, Art. 586 Rn. b 5.
[32]
Diverse Auffassungen interpretierten den Umstand des „Falliments“ des französischen Handelsgesetzbuches in der darauffolgenden Zeit als das Merkmal der „Zahlungseinstellung“ oder „Konkurseröffnung“ der KO, m.w.N.: Hager Der Bankrott, S. 66; Hahn Materialien zur Konkursordnung, S. 291.
[33]
Helferich Die Bedeutung von Zahlungseinstellung und Konkurseröffnung, S. 1 ff.
[34]
Nach teilweise vertretener Ansicht handele es sich um ein „delictum proprium“: Hälschner GA 1870, 665 (669); Meves GA 1888, 377 (380); unbekannt GA 1870, 289 (290).
[35]
Olshausen Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, 2. Bd., S. 1523.
[36]
Oppenhoff in: Schubert/Regge/Schmid/Schröder, StGB für die preußischen Staaten, § 259 Rn. 18; a.A.: Reichart GS 1893, 81 (257), der die Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung als „echtes Tatbestandsmerkmal“, das von Schuld und Vorsatz erfasst sein müsse, bezeichnete.
[37]
Hälschner GA 1870, 665 (671): „Man wird daher immer wieder darauf zurück geführt, dass es die Zahlungseinstellung ist, welche bestraft wird, sofern sie mit einem weiteren Momente in Verbindung tritt, vermöge dessen sie als eine schuldhafte erscheint, und dass darum die Zahlungseinstellung zum Tatbestande gehört. Die Zahlungseinstellung ist also nicht eine vom Tatbestande auszuschließende Tatsache, sondern sie selbst die vermöge ihrer gemeingefährlichen Wirksamkeit zu strafende Tat.“.
[38]
Reichart GS 1893, 81 (256).
[39]
A. Weber GS 1905, 63 (86): „Weder Herbeiführung der Zahlungseinstellung durch die Bankrotthandlung noch auch nur unter Begleitung der Bankrotthandlung ist Bankrott im Sinne unserer Konkursordnung.“ Zustimmend: Oppenhoff in: Schubert/Regge/Schmid/Schröder, StGB für die preußischen Staaten, § 259 Rn. 20.
[40]
Insbesondere der Verwendung des Relativsatzes „Schuldner, welche (...)“.
[41]
Insbesondere der Intention des französischen Gesetzgebers.
[42]
Darras in: Cohendy, code de commerce, tome deuxième, Art. 586 Rn. a und b: „(...) il en résulte que la banqueroute simple peut être prononcée, quelle que soit la cause de la nouvelle faillite.“.
[43]
G. Schmidt Der strafbare Bankbruch, S. 46; Hälschner Strafrecht, 2. Bd., S. 405.
[44]
Diethelm Die Tatbestände der Insolvenzstrafbestimmungen, S. 21; G. Schmidt Der strafbare Bankbruch, S. 46.
[45]
G. Schmidt Der strafbare Bankbruch, S. 46.
[46]
Hager Der Bankrott, S. 49; G. Schmidt Der strafbare Bankbruch, S. 53; Diethelm Die Tatbestände der Insolvenzstrafbestimmungen, S. 26; Hälschner Strafrecht, 2. Bd., S. 398; Neumeyer Bankrott, S. 72.
[47]
G. Schmidt Der strafbare Bankbruch, S. 54.
[48]
So ausdrücklich Hager Der Bankrott, S. 49.
[49]
G. Schmidt Der strafbare Bankbruch, S. 55; Hager Der Bankrott, S. 49. Voraussetzung zu dieser Zeit war, dass der Schuldner vorsätzlich „Bankrott machte und austrünnig (flüchtig) wurde“.
[50]
Dieses enthielt erstmals umfangreiche, insolvenzstrafrechtliche Regelungen in 36 Einzelparagrafen (§§ 1452-1487).
[51]
Hager Der Bankrott, S. 58.
[52]
Vormbaum Strafrechtsgeschichte S. 68 f.
[53]
G. Schmidt Der strafbare Bankbruch, S. 108; Hager Der Bankrott, S. 64; Neumeyer Bankrott, S. 111.
[54]
G. Schmidt Der strafbare Bankbruch, S. 108.
[55]
Bankbruch war ein älterer Begriff für Bankrott.
[56]
G. Schmidt Der strafbare Bankbruch, S. 108; Beseler StGB für Preußen, S. 490.
[57]
Meier Die Geschichte des deutschen Konkursrechts, S. 88.
[58]
G. Schmidt Der strafbare Bankbruch, S. 128.
[59]
Beseler StGB für Preußen, S. 490; Wobei der einfache Bankrott zu dieser Zeit als mutwilliger Bankrott bezeichnet wurde, der dann vorlag, wenn zwar nicht Betrug aber Verschwendung, unordentliches Wesen oder Leben des Schuldners zum Vermögensverfall geführt hatte. Ein ausführlicher Überblick bei: G. Schmidt Der strafbare Bankbruch, S. 61.
[60]
Vom Tatbestand sollten insbesondere auch Bankrotthandlungen erfasst werden, die erst nach Eintritt des Konkurses erfolgten, weshalb ein Kausalitätserfordernis auch dazu geführt hätte, dass diese besonders strafwürdige Fallgruppe nicht hätte bestraft werden können.
[61]
Wobei insbesondere manche der Bankrotthandlungen (die Bilanz- und Buchführungspflichtverstöße) in der Regel als (alleinige) Konkursursache nicht denkbar waren. Eingehend dazu: Neumeyer Bankrott, S. 132.
[62]
Reichart GS 1893, 81 (265).
[63]
„Der Zweck der Strafbestimmungen ist, die Sicherung des Kredits durch das Strafgesetz, welcher da geboten erscheine, wo ein solcher beansprucht oder gewährt werden muss, ohne dass eine genauere Prüfung der persönlichen Zuverlässigkeit sowohl der Vermögensverhältnisse erfolgen kann. Ein solcher Kredit ist für den Handel notwendig, wer denselben missbrauche, verletzte nicht bloß das Vermögen eines einzelnen bestimmten Gläubigers sondern die Sicherheit des Handels.“, Cohn GA 1893, 198 (199); Bauer Der betrügliche und der einfache Bankrott, S. 2.
[64]
Hahn Materialien zur Konkursordnung, S. 404.
[65]
Hahn Materialien zur Konkursordnung, S. 404.
[66]
RG Urt. v. 31.3.1880, RGSt 1, 282; Urt. v. 15.2.1881, RGSt 3, 350; Urt. v. 17.9.1881, RGSt 4, 418.
[67]
Hervorhebung nicht im Original.
[68]
RGSt 4, 418 (418).
[69]
RGSt 4, 418 (418 ff.).
[70]
Reichart GS 1893, 81 (260).
[71]
So wörtlich RGSt 3, 350 (283).
[72]
Olshausen Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, 2. Bd., S. 1523; Reichart GS 1893, 81 (260 ff.).
[73]
Reichart GS 1893, 81 (268).
[74]
RGSt 9, 134 (134 ff.); 11, 386 (386 ff.); 15, 64 (64 ff.).
[75]
In der Fassung vom 10.2.1877.
[76]
In der Fassung vom 20.5.1898.
[77]
RGSt 5, 415 (416); 29, 222 (223).
[78]
RGSt 9, 134 (136).
[79]
RGSt 22, 436 (437); 55, 30 (30).
[80]
BGH Urt. v. 20.3.1951, GA 1954, 73 (74).
[81]
BGH Urt. v. 8.5.1951, BGHSt 1, 186 (191).
[82]
RGSt 5, 415 (415).
[83]
RGSt 5, 415 (415).
[84]
Hervorhebung im Original.
[85]
RGSt 5, 415 (416).
[86]
RGSt 29, 222 (222).
[87]
Hervorhebung nicht im Original.
[88]
RGSt 29, 222 (222).
[89]
Der „Zusammenhang“ zwischen Bankrotthandlung und Konkurs ist für diese Fallgruppe rein zeitlicher Natur und liegt vor, wenn 1. die mangelnde Übersicht und der Konkurs tatsächlich parallel also zeitgleich vorliegen, oder aber 2. wenn ein Übersichtsmangel aus einem früheren Rechnungsjahr bis zum Konkurs fortwirkt.
[90]
RGSt 9, 134 (134).
[91]
Hervorhebung nicht im Original.
[92]
Hervorhebung nicht im Original.
[93]
RGSt 9, 134 (135).
[94]
RGSt 11, 386 (386).
[95]
RGSt 11, 386 (386).
[96]
RGSt 22, 436 (436).
[97]
„[…] Es steht daher auch der Anwendbarkeit des Gesetzes nicht entgegen, wenn bei dem Vorliegen dieser Beziehung die erstere der letzteren nachfolgt. Wenn also die Vorinstanz als erwiesen annimmt, dass der Angeklagte zur Vernichtung der Bücher erst geschritten, nachdem der Konkurs über sein Vermögen eröffnet worden war, so war dieser Umstand, da sich die Bücher auf das in Konkurs geratene Vermögen bezogen, zur Ausschließung des angeführten Paragraphen nicht geeignet.“
[98]
Hervorhebung nicht im Original.
[99]
„[…] Dass dieses Interesse während des Laufes des Konkursverfahrens vorhanden ist, kann nicht zweifelhaft sein; aber auch ebenso wenig, dass es in der Regel mit der definitiven Beendigung desselben, sei es durch Schlussverteilung oder durch den Abschluss eines Zwangsvergleichs erlischt.“
[100]
„[…] oder ob sie von der rechtsirrigen Ansicht ausgegangen, dass die Vernichtung der Bücher, weil innerhalb der durch Art 33 HGB gesetzten Frist geschehen, in jedem Falle § 210 Ziff. 2 KO zu unterstellen sei. Anscheinend ist die Vorinstanz dieser letzten Ansicht gefolgt und hat sich für dieselbe auf das Urteil des Reichsgerichts vom 8.12.1884 – in Bd. 11 – berufen.“
[101]
RGSt 22, 436 (438).
[102]
RGSt 22, 436 (438).
[103]
Die 2. Konkursordnung, in der Fassung vom 20.5.1898, bekanntgemacht am 14.6.1898, verlagerte die Konkursstrafbestimmungen von §§ 209 ff. auf die §§ 239 ff. KO. Die Reform enthielt jedoch keine relevanten inhaltlichen Änderungen. Lediglich der Abschnitt des Bankrotts wurde von den §§ 209 ff. KO auf die §§ 239 ff. KO verschoben.
[104]
RGSt 55, 30 (30).
[105]
BGH GA 1954, 73 (74).
[106]
BGHSt 1, 186 (191).
[107]
Siehe auch A. Weber GS 1905, 63 (85).
[108]
Engisch Einführung in das juristische Denken, S. 87.
[109]
Engisch Einführung in das juristische Denken, S. 55.
[110]
RGSt 22, 436 (436).
[111]
RGSt 11, 386 (386).
[112]
RGSt 29, 222 (223 ff.).
[113]
RGSt 27, 316 (320).
[114]
RGSt 16, 188 (189).
[115]
BGH GA 1954, 73 (74).
[116]
RGSt 55, 30 (30).
[117]
RGSt 3, 350 (351).
[118]
Reichart GS 1893, 81 (260); Binding Normen, Bd. II, 1, S. 480; Binding Normen, Bd. I, 1. Aufl. 1872, S. 114; Mentzel in: Mentzel, Konkursordnung, § 239 KO Rn. 2; Neumeyer Bankrott, S. 128; Wilmowsky Deutsche Reichs-Konkursordnung, S. 618; Kleinfeller in: Petersen/Kleinfeller, Konkursordnung, S. 681; Kleinfeller GS 1890, 161 (161); A. Weber GS 1905, 63 (82); Meves GA 1888, 377 (383); Bemmann Objektive Bedingung der Strafbarkeit, S. 50; J. Schmidt Abstraktionsgrad abstrakter Gefährdungsdelikte, S. 130; Wach in: Birkmeyer/Calker/Hippel, Vergleichende Darstellung, Bd. 8, 1 (70 ff.); Liszt Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 21. Aufl. 1919, S. 449; Rohland Die Gefahr im Strafrecht, S. 33; Kadečka Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform 1931, 65 (74); Schäfer in: LK-StGB, 1958, 2. Bd. § 239 KO Rn. 5; Daude StGB für das deutsche Reich, § 240 Rn. 27; Cohn GA 1893, 198 (204); Stree in: Schönke/Schröder, StGB, 18. Aufl. 1976, § 239 KO Rn. 9; Wachenfeld Lehrbuch des deutschen Strafrechts, S. 430; Hammerl Bankrottdelikte, S. 129; Holtzendorff Handbuch Strafrecht, 3. Bd., S. 820; Gerland Deutsches Reichsstrafrecht, S. 629; Merkel Lehrbuch des deutschen Strafrechts, S. 333; Stenglein Nebengesetze, Bd. 1, S. 224. Das Verhältnis zwischen Handlung und Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung wurde hierbei als eine „außerordentlich umstrittene Frage“ bezeichnet: Reichart GS 1893, 81 (265).
[119]
Die Frage stellte u.a. Frank StGB für das deutsche Reich, S. 644.