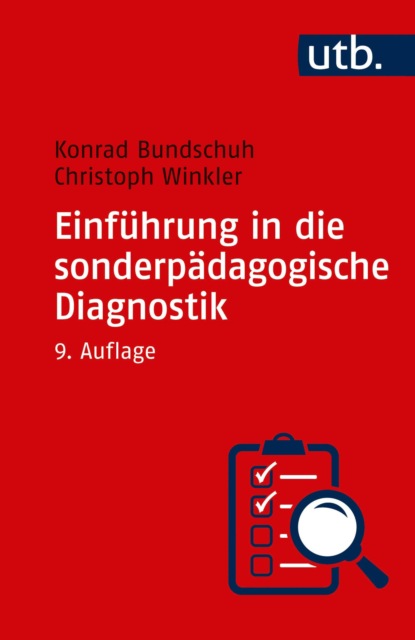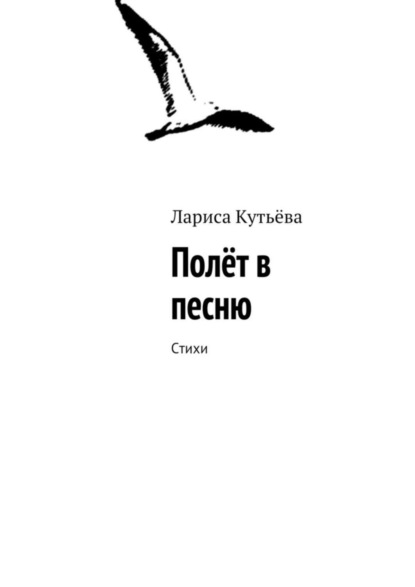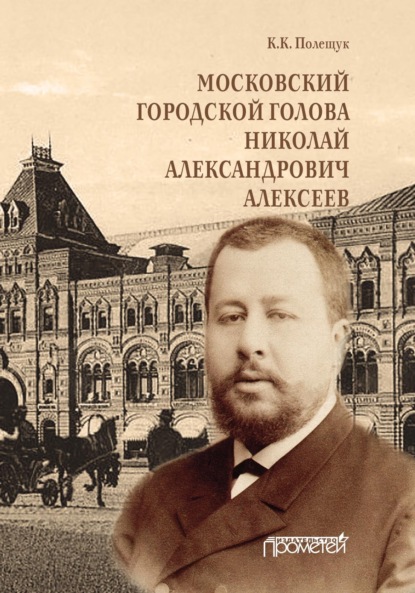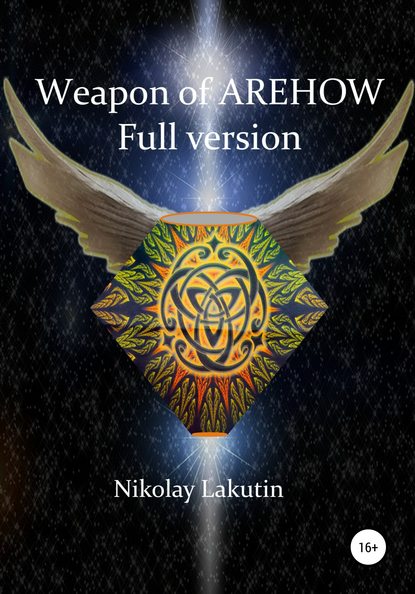- -
- 100%
- +
Im pädagogischen Bereich ist eine solche Einteilung zu kritisieren:
1. Mit dieser schematischen Klassifizierung verbindet sich die Gefahr, dass die so bezeichneten Kinder „festgeschrieben“ werden, d. h., die Beurteilung bzw. Einschätzung der Intelligenz wird als weitgehend endgültig gesehen.
2. Der milieutheoretische Aspekt bleibt unberücksichtigt; die Intelligenzentwicklung scheint damit im Wesentlichen von Anlagefaktoren abzuhängen.
3. Der Versuch einer Charakterisierung menschlicher Leistungen und Fähigkeiten durch die Attribute „Unterhalt selbstständig erwerben“, „weder lesen noch schreiben können“, „nicht sprechen und nicht verstehen“, muss scheitern, weil etwa der Persönlichkeitsbereich völlig unberücksichtigt bleibt, wie z. B. das Gefühlsleben und der musische Bereich, weil insgesamt gesehen die Ausgangsbasis viel zu schmal und zu schematisch ist.
4. Die Begriffe „Debilität“, „Imbezillität“ und „Idiotie“ werden zwar heute teilweise noch im psychiatrischen Bereich verwendet, ihr Gebrauch sollte aber – nicht nur im pädagogischen Feld – entschieden abgelehnt werden, weil deren Inhalte mit Vorurteilen behaftet sind und damit einen diffamierenden Charakter tragen („Menschen zweiter Klasse“ ...).
Bei aller Kritik an der Klassifizierung Binets darf nicht der Impuls dieses Wissenschaftlers für die Problematik der Intelligenzprüfung in Vergessenheit geraten. Seine Ansätze stellten einen wesentlichen Fortschritt dar; so etwa der Aufbau der Verfahren nach dem sogenannten „Staffelsystem“ (Staffel- oder Stufenprinzip), d. h., es liegt eine Staffelung des Tests nach steigendem Schwierigkeitsgrad mit ansteigendem Lebensalter vor. Binet überprüfte die einzelnen Aufgaben ständig. Verbesserungen wurden durchgeführt. Noch vor seinem Tode im Jahre 1911 bestimmte er, dass einheitlich für jede Altersstufe fünf Tests verwendet wurden. Für die 11 Altersstufen vom 3. bis zum 13. Lebensjahr wurden insgesamt 59 Testaufgaben eingeführt (vgl. Dorsch 1963, 53).
Die Forschung und Wissenschaft erkannte Binets Leistung an. Seine Tests und seine Werke wurden in etwa 50 Sprachen übersetzt. Vor allem die Psychiater griffen sein Verfahren, die „Binet-Simon-Stufenleiter zur Messung der Intelligenz“, auf. Binet konnte den mächtigen Aufschwung und den raschen Ausbau seines Systems, aber auch die teilweise heftigen, kritischen Einwände nicht mehr erleben.
Die Leistung Binets wird sicherlich treffend durch einen Beitrag Groffmanns (1971, 167) charakterisiert:
Geht man davon aus, dass ein psychologischer Test im Wesentlichen ein objektives und standardisiertes Maß einer Stichprobe von Verhaltensweisen darstellt, so ist im Zusammenhang mit dem Stufentest von Binet und Simon festzustellen, dass diese Definition in einem Maße erfüllt wurde, wie dies vorher nicht der Fall war. Das Verfahren ist in Anwendung und Auswertung standardisiert, beruht auf einer empirisch hergestellten, objektiven Schwierigkeitsordnung der Aufgaben, Die Notwendigkeit von Reliabilität und Validität war erkannt, der Schritt zum Testsystem vollzogen und ein Vorbild psychologischer Messung geschaffen.
2.4 Die Weiterentwicklung des Binet-Systems
Es begann nun ein rascher Aufschwung der Intelligenzmessung, zunächst am stärksten in den USA.
Um 1912 versuchte L. M. Terman eine Revision des Stufentests herauszugeben. Aus den Vorarbeiten entstand 1916 die sehr erfolgreiche „Stanford Revision of the Binet-Simon Intelligence Scale“. 1937 wurde diese Revision weiter ausgebaut und als Stanford-Revision von Terman und M. A. Merrill herausgebracht. Inzwischen erschien 1960 eine dritte Stanford-Revision. In den USA gilt dieser Test heute noch als gut standardisiert. Die Stanford-Revisionen hatten vor allem deshalb Erfolge, weil sie doch sorgfältig konstruiert und geeicht, aber auch praktisch problemlos durchzuführen waren. Eine deutsche Bearbeitung von H. R. Lückert (1957) lehnt sich an die Stanford-Revision von Terman und Merrill aus dem Jahre 1937 an.
In Deutschland beschäftigte sich bereits 1910 bis 1914 O. Bobertag mit der Übertragung des Binet-Tests auf deutsche Verhältnisse.
Irmgard Norden gab 1953 das Binetarium – eine Zusammenstellung des Testmaterials – heraus. Damit war der Test so bearbeitet, dass er in Deutschland Verwendung finden konnte. 1954 wurde das Binetarium nochmals überarbeitet.
In Deutschland wurden Eichversuche des Binet-Tests unternommen von Elisabeth Höhn, Gerhild von Staabs und Alf Kleiner.
In der Schweiz sorgten Hans Biäsch, Josefine Kramer und Ernst Probst für die Ausbreitung und Überarbeitungen des Binet-Testsystems.
J. Kramer war mehrere Jahre lang in Heimen tätig, in denen Kinder von 8 bis 16 Jahren betreut wurden. Zugleich war sie Leiterin einer Erziehungs- und Schulberatungsstelle. Kramer überarbeitete den Binet-Test besonders für Schulversager und weniger begabte Kinder (Groffmann 1971; Kramer 1972, 72–78).
2.5 Fortschritte der Intelligenzmessung
Wie bereits dargelegt, sollte nach Binet die Differenz zwischen IA und LA, d. h. die Abweichung von der altersmäßigen Intelligenznorm, als Richtmaß gelten. Es ergeben sich jedoch Probleme, wenn man die Intelligenzhöhe eines Menschen mit den Begriffen „Intelligenzvorsprung“ bzw. „Intelligenzrückstand“ in Form von Monaten und Jahren zum Ausdruck bringen will. An einem praktischen Beispiel soll veranschaulicht werden, dass die Bezeichnungen „Intelligenzvorsprung“ oder „Intelligenzrückstand“ die objektiven Tatbestände verfälschen können. So besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen einem 14-Jährigen mit einem Intelligenzrückstand von zwei Jahren (er befindet sich also auf der Intelligenzstufe eines 12-Jährigen) und einem vierjährigen Kind mit einem Intelligenzrückstand von ebenfalls zwei Jahren (es befindet sich auf der Intelligenzstufe eines zweijährigen Kindes). Es ist offensichtlich, dass ein Intelligenzrückstand von zwei Jahren bei einem vierjährigen Kind viel gravierender ist als bei einem 14-jährigen Jugendlichen, denn die Intelligenzentwicklung vollzieht sich beim Kleinkind viel rascher.
Aufgrund dieser Probleme musste ein Maßstab gefunden werden, der die Gegebenheiten in objektiver Form darstellen konnte. Einen wichtigen Beitrag hierzu leistete William Stern (1871–1938) im Jahre 1912 mit der Einführung des Intelligenzquotienten (IQ). Stern schlug vor, den Quotienten aus Intelligenzalter und Lebensalter zu errechnen und damit ein „Entwicklungsmaß der Intelligenz“ zu bilden.
Die Formel hierzu lautet:

Später multiplizierte man mit 100. Dies ergab dann eine ganzzahlige „Quotientenskala“, so dass die Formel lautete:

Es ist zu erkennen, dass dasjenige Kind den IQ 1 (100) aufweist, dessen Intelligenzalter genau dem Lebensalter entspricht. Bei überdurchschnittlich intelligenten Kindern müsste demnach der IQ größer als eins (unechter Bruch), bei unterdurchschnittlich intelligenten Kindern kleiner als eins (echter Bruch) sein. Hierzu einige praktische Beispiele:
IA:8 J.9 J.12 J.9;2 J. = 110 MonateLA:8 J.12 J.10 J.10;4 J. = 124 MonateIQ:1,00,751,200,89(100)(75,00)(120,00)(89)Diese Darstellungen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass bereits W. Stern klar war, dass die Intelligenzentwicklung im Gegensatz zum Lebensalter nicht gleichmäßig fortschreitet, sondern in der frühen Kindheit rasch und später langsamer verläuft, bis sie schließlich, was angenommen wurde, zum Stillstand kommt, dass also keine lineare Beziehung zwischen IA und LA besteht. Das war der Grund für den Vorschlag des IQ, aber auch die Wurzel der Erkenntnis, dass selbst der IQ kein unbedingt konstanter Ausdruck von Vorsprüngen und Rückständen sein muss. Man weiß z. B. bei den Bearbeitungen von Norden (1953), Kramer (1972) oder Lückert (1957) nicht, „ob Kinder verschiedener Altersstufen bei gleichem IQ wirklich gleich, intelligent‘ oder bei demselben Kind der gleiche IQ in verschiedenen Lebensaltern dasselbe bedeutet“ (Groffmann 1971, 173).
Binet-Tests wurden bis 1985 relativ häufig verwendet. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass der aufgrund der Binet-Tests bestimmte IQ kein Standardwert ist, „sondern ein Quotient aus einem Maß für intellektuelle Entwicklung, dem Intelligenzalter und dem Lebensalter“ ist. Der IQ von 1.00 bzw. 100 stellt nicht notwendigerweise den Mittelwert der IQ-Verteilung dar. Damit zeigen sich gewisse unsichere Implikationen, die mit der Verwendung der genannten Tests verbunden sind.
Wichtige Richtungen der weiteren Entwicklung von Tests:
1. Weiterentwicklung bisheriger Verfahren, Neuentwicklungen unter Einbezug des Säuglings bis zum Schulkind: Zu nennen sind in diesem Zusammenhang z. B. Namen wie Arnold Gesell (Beobachtung der Entwicklung des Säuglings und des Kleinkindes hinsichtlich Motorik, Reizanpassung, Lallen, ersten sprachlichen Äußerungen und sozialem Kontakt seit 1925), Charlotte Bühler sowie Hildegard Hetzer (Erfassung der kindlichen Entwicklungsstufen aus den wesentlichen Merkmalen der Körperbewegung, der sinnlichen Rezeption, Sozialität, Materialbeherrschung und Denkleistung seit 1928), Lotte Schenk- Danzinger (Entwicklungstests für Kinder vom 5. bis 11. Lebensjahr), Inge Flehmig u. a. (Denver-Entwicklungsskalen), Ernst J. Kiphard (Sensomotorisches Entwicklungsgitter für die Entwicklungsbereiche optische Wahrnehmung, Handgeschicklichkeit, Körperkontrolle, Sprache, akustische Wahrnehmung für das Alter von 6 bis 48 Monaten), Reimer Kornmann (Testbatterie für entwicklungsrückständige Schulanfänger).
Dorsch (1963, 55) nennt noch die Entwicklung von „Spieltests“, die jedoch auch als projektive Verfahren Verwendung finden, wie z. B. von Gerhild v. Staabs den „Scenotest“, von Margaret Lowenfeld das „Weltspiel“ und von Charlotte Bühler den „Welttest“.
2. Entwicklung sprachunabhängiger Tests (nonverbale Verfahren): Diese Verfahren reichen zurück bis zu den Formbrettern (Einlegebrettern), die bereits 1866 von einem französischen Arzt zum Training von „Schwachsinnigen“ benützt wurden (Dorsch 1963, 55).
Als in der heutigen Zeit Verwendung findende nonverbale Verfahren kann man beispielsweise nennen den „Progressiven Matrizentest“ von Raven (1947, 1975), Tests zur Erfassung der Grundintelligenz von Weiss und Cattell (1997), evtl. auch Teile aus dem Intelligenztest von Kramer (1972) und den „Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder“ von Wechsler (Hawik-Revision 1985, WISC-IV 2011).
3. Entwicklung analytischer Intelligenztests: Der Intelligenzquotient geht bei diesen Tests nicht etwa auf das Intelligenzalter zurück, vielmehr auf bestimmte Intelligenzfunktionen, die hinsichtlich ihrer Verteilung auf statistischem Wege mit Leistungsmittelwerten verglichen werden. Hierzu gehören die von Meili (1971) und Thurstone und Thurstone (1953) herausgegebenen Testserien sowie die von Wechsler 1939 entwickelte und erprobte Intelligenz-Skala für Erwachsene und der Intelligenzstrukturtest (IST) von Amthauer (1955).
4. Die Entwicklung von Gruppentestverfahren: Aus der praktischen Notwendigkeit heraus, möglichst schnell qualifizierte Personen für bestimmte Aufgaben der amerikanischen Armee auszulesen, wurden Gruppentests entwickelt (Army-Alpha-Test; er setzt englische Sprachkenntnisse und Lesefähigkeit voraus. Army-Beta-Test als sprachfreier Test).
Gruppentests wurden wohl erstmals von W. Stern entwickelt. Gruppentests sind z. B. der bereits genannte Intelligenz-Struktur-Test (IST) von Amthauer (1955), das Begabungs-Test-System (BTS) von Horn (1972), der Grundintelligenztest von Weiß und Cattell (1997), die speziell zur Überprüfung von schulleistungsschwachen Schülern entwikkelte „Schulleistungsbatterie für Lernbehinderte und für schulleistungsschwache Grundschüler“ (SBL 1 und SBL 2) von Kautter und Storz (2000, SBL 2 2002).
Es gibt zahlreiche Gruppenverfahren, die auch für den sonderpädagogischen Bereich Bedeutung haben, wenn es beispielsweise um Intelligenz-, Schul-, Wahrnehmungsleistungen oder um die Erfassung von Feinmotorik und Händigkeit geht.
Gruppentests haben den Vorteil, dass sie unter gleichen Bedingungen durchgeführt und in gleicher Weise ausgewertet werden, dass alle untersuchten Individuen die gleiche Anweisung erhalten, diese Tests ganz global ausgedrückt objektiver und ökonomischer zu handhaben sind.
Zusammenfassung
Die ersten Versuche, Intelligenz zu erfassen und messbar zu machen, wurden unter Einbeziehung geistiger, physiologisch motorischer und perzeptiver Leistungen unternommen. Anregungen lieferten neben der Psychologie und Medizin (spez. Psychiatrie) vor allem auch die Mathematik und Physik. Der Gedanke, vom „durchschnittlichen“ Individuum, von „durchschnittlichen“ Leistungen und von Abweichungen vom Durchschnitt auszugehen, gewann stärker an Bedeutung.
Binet bezog in sein „Staffelsystem“ die Idee einer relativen Übereinstimmung von Intelligenzleistungen und Lebensalter ein. Sein Stufentest wurde verbreitet und weiterentwickelt in den USA, in Deutschland, in der Schweiz und in zahlreichen anderen Ländern. Mit der Einführung des „Intelligenzquotienten“ (IQ) durch William Stern (1912) wurde ein heute noch gebräuchliches Maß für die Messung der Intelligenz geschaffen. Die Methoden der Intelligenzerfassung fanden unter Einbezug sogenannter Gruppen- und nonverbaler Verfahren rasche Verbreitung.
Im pädagogisch-sonderpädagogischen Bereich wäre die Entwicklung von „Verfahren“ zur Einschätzung der kognitiven Möglichkeiten eines Kindes unter Einbezug von Handlungen aus dem Bereich seiner bisherigen Umwelt, also in seiner natürlichen Umgebung, wünschenswert. Hierbei einen gangbaren Mittelweg zwischen „objektiver“ und „subjektiver“ Beobachtung auch im Sinne qualitativer Diagnostik zu finden (Bundschuh 2019, 58 ff., Kap. 5.5.2), könnte eine zukünftige pädagogische Aufgabe sein. Die Kritik am Intelligenzbegriff hat auch zu einer deutlichen Verunsicherung der Intelligenzdiagnostik insbesondere im sonder- oder heilpädagogischen Arbeitsfeld geführt.
Psychologische Diagnostik gilt zunächst als ein Teilgebiet der Psychologie, speziell der angewandten Psychologie. Diagnostik umfasst die Gesamtheit der Verfahren und Theorien, die dazu dienen, Verhalten und psychische Prozesse einzelner Personen oder auch Gruppen zu erforschen. Diagnostik hatte im Rahmen sonder- oder heilpädagogischer Problemstellungen schon immer eine große Bedeutung, wurde aber auch kritisch hinterfragt.
Die Erwartungen an die Diagnostik im sonder- und heilpädagogischen Arbeitsfeld, speziell auch bezüglich der Kinder mit mehrfachen und komplexen Problemen im Lernen und Verhalten bis hin zu Mehrfachbehinderungen, erweisen sich als hoch. Diese Erwartungen im Sinne des Auffindens optimaler Förderungswege in Richtung Therapie und „Heilung“ sind nicht immer ganz erfüllbar. Dennoch wird eine kinderorientierte, d. h. für die wirklichen Probleme eines Kindes und seines sozialen Umfeldes offene heilpädagogische Diagnostik gute Dienste im Rahmen des Entwicklungs- und Erziehungsgeschehens leisten, vor allem durch die Möglichkeiten der Informationsgewinnung zur differenzierten Beschreibung des Verhaltens und der Lernausgangslage bei Kindern mit einem besonderen Förderungsbedarf, der Diagnose behindernder Bedingungen sowie den daraus hervorgehenden Ansätzen zu deren Beseitigung in Verbindung mit Beratung, Förderung, ggf. Therapie. Insofern nimmt die Beschäftigung mit diagnostischen Fragestellungen angesichts der Zunahme von Not- und Problemsituationen bei Kindern und Jugendlichen auch in einer Zeit des Umbruchs und Wandels im sonder- und heilpädagogischen Arbeitsfeld einen wichtigen Platz ein.
Diagnostik erhält auch eine neue Bedeutung im Rahmen der Erstellung von Förderplänen (Kap. 6.6.3) sowie der herausfordernden Fragen nach Integration und Inklusion (Bundschuh 2010, 91–99; 2019) bis hin zu Möglichkeiten von Therapien (Bundschuh 2008, 242–302), speziell auch Lerntherapie (Metzger 2008).
3 Begriff, Aufgaben, Funktionen und Bereiche der sonder- und heilpädagogischen Diagnostik
Lernziele
1. Den Begriff „Psychodiagnostik“ kennen lernen.
2. In der Lage sein, zwischen Psychodiagnostik und sonderpädagogischer Diagnostik zu differenzieren.
3. Die Einsicht gewinnen, dass der Aufgabenbereich sonderpädagogischer und heilpädagogischer Diagnostik in unmittelbarem Zusammenhang mit dem pädagogischen Feld, d. h. mit Problembereichen von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen, Störungen, Behinderungen und behindernden Bedingungen steht.
4. Erkennen, dass sonder- und heilpädagogische Diagnostik primär „Förderdiagnostik“ sein sollte.
Zur Orientierung: In diesem Abschnitt wird es um die Klärung des Begriffes Psychodiagnostik, um die Abgrenzung der sonder- und heilpädagogischen Diagnostik von der Diagnostik im Bereich der Medizin, aber auch der Psychologie gehen; schließlich werden Aufgabenbereich und Funktion sonderpädagogischer Diagnostik im Hinblick auf den Aspekt Förderdiagnostik thematisiert.
3.1 Zum Begriff „Psychodiagnostik“
Der Begriff „Diagnose“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie „Unterscheidung“, „Entscheidung“. Im medizinischen Sinne ist das Erkennen einer Krankheit gemeint oder ganz allgemein die Erkenntnis der Beschaffenheit eines psychischen oder physischen Zustandes aufgrund von Symptomen. Bei der medizinischen Diagnostik handelt es sich – obgleich gegenwärtig sehr viel von „Vorsorge“ gesprochen wird – mehr oder weniger um die Feststellung eines momentanen Zustandes.
Dagegen soll die Psychodiagnostik im Allgemeinen überdauernde Eigenschaften bestimmen. Die Psychodiagnostik ist daher weitgehend nicht nur Diagnose, sondern auch Prognose (Vorhersage) (Schmidt-Atzert / Amelang 2012, 4). Ein eher traditionelles Vorgehen in der Persönlichkeitsdiagnostik zielt auf ein Verstehen der dem Individuum zugrunde liegenden Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften ab, um auf diesem Weg Verhalten vorherzusagen. Es ergibt sich die Frage, ob die Psychodiagnostik, vor allem die traditionelle Psychodiagnostik, mit der Vorhersage von Verhalten nicht in hohem Maße stärker eine „Selektionsstrategie“ im Sinne einer Optimierung durch geeignete Auswahl von Personen und / oder Bedingungen betrieb als eine „Modifikationsstrategie“ im Sinne einer „Optimierung durch eine Veränderung des Verhaltens und / oder von Bedingungen“ (Pawlik 1982, 15 f.).
Selektionsstrategie im Zusammenhang mit Personenselektion würde im engeren Sinne realisiert, wenn es z. B. um Aufnahme oder Ablehnung, um die Platzierung eines Bewerbers bei der Personaleinstellung oder im pädagogischen Bereich um die Selektion durch Vorschultestung (Schulreife) oder um die Aufnahme in eine Förderschule geht.
Zu fordern wäre auf jeden Fall im pädagogischen Bereich eine Betonung der Modifikationsstrategie, obgleich die Realität teilweise nur eine „Mischstrategie“ zuzulassen scheint. Nachdem an dieser Stelle der Problemkreis „Strategien der Psychodiagnostik“ nur tangiert werden kann, sollen einige Forderungen an die Psychodiagnostik im pädagogischen Bereich in akzentuierter Form angeführt werden:
Die Verwendung psychodiagnostischer Methoden muss dem jeweiligen Problemfall angepasst sein. So kann z. B. die Intelligenzleistung eines Kindes mit einer Sprachstörung nicht erschöpfend mit dem WISC-IV / HAWIK-IV (2011; 2010) erfasst werden. Weiterhin darf das Ergebnis einer psychodiagnostischen Untersuchung für die betroffene Person nicht „Festlegung“ bedeuten, vielmehr den Ansatz zur Hilfe, zur Förderung und zur Emanzipation der Persönlichkeit. Diagnostik muss also Information zwecks Förderung, ggf. Therapie, d. h. effektive Hilfe für die betroffene Person bedeuten.
Diagnose und damit auch Prognose implizieren den Impuls zu weiteren diagnostischen Maßnahmen in einem späteren Zeitpunkt. So versteht bereits Pawlik alternativ zur „Diagnostik als Messung“ die Diagnostik in einem „übergreifenden Ansatz als Einbringen von Information für und über Behandlung […]. Zielsetzung bei der Konstruktion psychodiagnostischer Verfahren und bei ihrer Gütekontrolle muss daher der Gewinn (Nutzen, „utility“) sein, den diese diagnostische Information 1. für die Auswahl einer geeigneten Behandlung der untersuchten Person und / oder 2. für die Beurteilung der Effektivität der danach realisierten Behandlung bringt. Dabei ist mit „Behandlung“ […] jede Handlung gemeint, die der Psychologe, der Proband selbst und / oder andere Personen mit Wirkung für den Probanden setzen“ (Pawlik 1982, 34).
Welcher Methoden bedient sich nun die Psychodiagnostik? Diagnostiziert wird aufgrund von Anamnese (med. Aspekt: Ermittlung der Krankengeschichte; psychol. Aspekte: Erhellung des Lebenslaufes im Hinblick auf eine Störung, Ermittlung der Lebensgeschichte einer Person; objektive Daten über die Entwicklung: Geburtsverlauf, vorschulische Phase, Schulbesuch, Krankheiten, Berufsausbildung …), Exploration (das Aufsuchen, Erforschen, Erfragen psychischer oder physischer Besonderheiten; heute mehr durch Gespräch, Interview als Stellungnahme zu den erhobenen Anamnesedaten, zu Testdaten sowie zu dem jeweiligen Problem gedacht), Verhaltensbeobachtung, durch vorliegende Befunde und ganz allgemein durch Tests (Methoden der Psychologie thematisiert informativ und anwendungsbezogen speziell Kap. 5). Der Tests, in all ihren Formen, bedient sich die Psychodiagnostik je nach vorliegender Fragestellung in verschiedener Auswahl immer häufiger, ja ausschließlicher, um möglichst objektive und umfassende Informationen zu erhalten. Historisch gesehen entstand die Leitidee von einer Wissenschaft der psychologischen Diagnostik im Zusammenhang mit der Entwicklung des Testbegriffes. Seit der Erscheinung des Rorschachbuchs mit dem Titel „Psychodiagnostik“ im Jahre 1920 setzte sich dieser Begriff immer mehr durch. Rorschach verstand sein Verfahren einmal als „Test“ oder „Prüftest“, zum anderen aber auch als „wahrnehmungs-diagnostisches Experiment“, d. h., aufgrund der Art der Wahrnehmung sollten psychische Krankheiten erkannt werden. In der Folgezeit erschienen Werke über „psychologische Diagnose“, Lehrbücher wurden geschrieben mit den Titeln „Psychodiagnose“, „psychologische Diagnose“, „diagnostische Psychologie“. Unter diesen Bezeichnungen und speziell unter dem Begriff psychologische Diagnose versteht man die Gesamtheit aller Verfahren, welche der Erkundung der individuellen psychischen Struktur eines Menschen dienen.
Die Diskussion der Frage, ob durch diese „Erkundung“ und durch Vorhersage von Verhalten nicht „festgeschrieben“, „selegiert“, statt modifiziert wird, erfolgt an anderer Stelle.
3.2 Gegenstands- und Aufgabenbereich sonderpädagogischer Diagnostik
Am besten gelingt der Zugang zu dem angesprochenen Problembereich, wenn zunächst die Personengruppe beschrieben wird, mit der die sonderpädagogische Diagnostik konfrontiert wird.
Traditionell gesehen lässt sich die sonderpädagogische Diagnostik dadurch kennzeichnen, dass sie es mit – möglicherweise – psychisch-kognitiv oder auch physisch behinderten Kindern und Jugendlichen zu tun hat, die in ihrer geistigen, emotionalen, sozialen, möglicherweise auch motorischen und sensomotorischen Entfaltung beeinträchtigt, gestört oder behindert sind, d. h. von sogenannten durchschnittlich entwikkelten oder nichtbehinderten Kindern hinsichtlich Lern- und / oder Sozial- und Emotionalverhalten abweichen. Dabei ist auf die Problematik des Verständnisses und damit auf die Relativität und auf das unterschiedliche Verständnis von „Störung“ und „Behinderung“ hinzuweisen. Im Zusammenhang mit Schülern mit Lernbehinderungen z. B. wird von einer Gruppe gesprochen, die unterhalb der durchschnittlichen Leistungsfähigkeit liegt, wobei sonderpädagogischer Förderbedarf nach den KMK-Empfehlungen von 1994 eben nicht nur an speziellen Sonder- oder Förderschulen eingebracht werden kann, vielmehr an allen Schulen denkbar ist, z. B. im Bereich der Grund- und Hauptschule bis hin zu Gymnasien etwa bei vorliegenden Lern-, Leistungs- und Verhaltensstörungen, wie auch immer verursacht. Die spezielle Bedürfnis- und Problemsituation von Kindern fordert gegenwärtig verstärkt vor allem im Präventivbereich psychologische, speziell diagnostische und allgemein didaktisch-fachliche Kompetenzen im Hinblick auf Diagnose und Erkennung der Problematik sowie Unterstützung des Kindes und der Erziehungspersonen und mit der Zielrichtung Förderung ggf. Lerntherapie (Bundschuh 2008, 32–36; 2019).