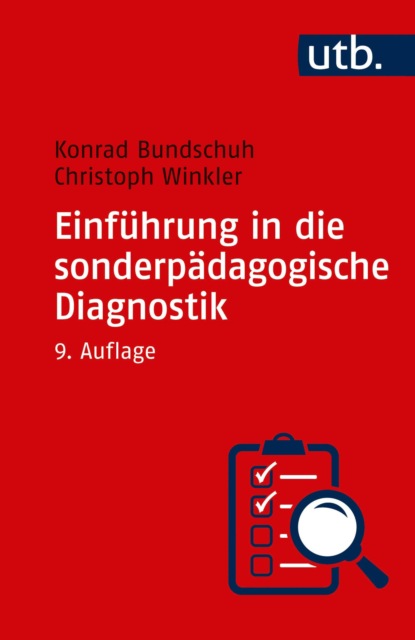- -
- 100%
- +
Wenn auch die Gruppe der Schüler mit Lernbehinderungen (Förderbedarf Lernen) und / oder Verhaltensstörungen (Förderbedarf Verhalten, soziale und emotionale Entwicklung) den größten Bereich der mit sonderpädagogisch-diagnostischen Maßnahmen zu Konfrontierenden umfasst, geht es nicht allein und primär um diese Gruppe, vielmehr steht die Frage der Hilfe, Unterstützung und Förderung aller Kinder mit einem besonderen Förder- und / oder Lerntherapiebedarf im Vordergrund der Überlegungen.
Traditionell gesehen hat es die sonderpädagogische Diagnostik mit allen Personen zu tun, mit denen sich die allgemeine Sonderpädagogik beschäftigt, also mit allen „Formen der Beeinträchtigung“, wie sie von Bach beschrieben wurden (1995, 8 f.). Wenn man vom Schweregrad ausgeht, müsste man die teilweise nicht oder kaum objektiv feststellbare Form der „Gefährdung“ (Auffälligkeit) sowie das Bedrohtsein von Behinderung an den Anfang stellen und als gravierende Form die Behinderung nennen.
Bach definiert „Beeinträchtigung“ als „die Erschwerung“ der Personalisation und Sozialisation eines Menschen. Sie ist durch besondere Herausforderungen an Erziehung und Förderung bei Erziehungsprozessen in Familie, Schulen, ggf. auch in Heimen gekennzeichnet.
Liegt noch keine objektive Feststellung vor, wird erst von bloßer Auffälligkeit gesprochen. Der Übergang zwischen regelhaften und erschwerenden, unregelhaften Gegebenheiten des Erziehungsprozesses ist fließend, Beginn und Ausmaß der einzelnen Beeinträchtigungen sind nicht präzise zu fixieren. Beeinträchtigungen müssen unter dem Aspekt subjektiver, sozialer, situativer und temporärer Relativität gesehen werden.
Im diagnostischen Bereich wird es notwendig sein, die Probleme eines Kindes sowie die behindernden Bedingungen im Umfeld in differenzierter Form zu erkennen und zu analysieren. Traditionell gesehen wurde zwischen einzelnen Formen von Beeinträchtigungen unterschieden, demgemäß zwischen Schweregraden von Beeinträchtigungen.
Kinder mit Behinderungen waren auf der Basis der Überlegungen des Deutschen Bildungsrates der 1970er Jahre dadurch gekennzeichnet, dass ihre individuellen Beeinträchtigungen, „umfänglich“, (d. h., mehrere Lernbereiche sind betroffen), „schwer“ (d. h., graduell mehr als ein Fünftel unter dem Regelbereich liegend) und „langfristig“ (d. h. eine Angleichung an den Regelbereich ist voraussichtlich innerhalb von zwei Jahren nicht möglich) waren. Die Frage wäre natürlich, ob z. B. alle „Lernbehinderten“ „behindert“ waren im Sinne dieser Definition.
Heute beschäftigt sich die Diagnostik im Arbeitsfeld Sonder- und Heilpädagogik vor allem mit der Problemsituation des einzelnen Kindes im Kontext Beeinflussung durch das Umfeld, speziell mit der Frage nach dem individuellen Förderbedarf – im Unterschied zu Klassifizierungen und Zuordnungen zu „Schweregraden von Beeinträchtigungen“.
Die sonderpädagogische Diagnostik befasst sich auch mit Kindern mit Lern- und Verhaltensstörungen bzw. -auffälligkeiten. Bach definiert Störungen als „individuale Beeinträchtigungen, die partiell (d. h. nur einen Lernbereich betreffend), oder weniger schwer (d. h. graduell weniger als ein Fünftel vom Regelbereich abweichend) oder kurzfristig (d. h. voraussichtlich in bis zu zwei Jahren dem Regelbereich anzugleichen) sind“ (1995, 9 f.). Auch hierbei geht es in erster Linie – wiederum traditionell betrachtet – um Zuordnungen.
Bei Kindern mit Lernstörungen und Verhaltensauffälligkeiten kommt der sonderpädagogischen Diagnostik primär die Aufgabe zu, Störungen hinsichtlich ihrer Ätiologie, vor allem im Kontext behindernder Bedingungen zu analysieren, das Kind zu stützen und eine für das Kind positive Veränderung im Umfeld zu bewirken.
Die nächste Personengruppe, mit der sonderpädagogische Diagnostik konfrontiert wird, sind Kinder und Jugendliche mit Gefährdungen. Gefährdungen bezeichnet Bach als
„Beeinträchtigungen, die in der Form somatischer, ökonomischer oder sozialer Lernbedingungen mit erschwerendem Charakter Störungen oder Behinderungen zu bewirken oder zu verstärken angetan sind“ (1995, 10).
Im Zusammenhang mit Gefährdungen sind vor allem „Prävention“und „Prophylaxe“ von Bedeutung (Bundschuh 2009, 26–30). So ist es dringend notwendig, dass im vorschulischen Stadium (Kindergarten, Vorschule, Schulkindergarten oder schon früher) Gefährdungen erkannt und aufgrund von Verhaltensbeobachtungen und des Einbezugs von Entwicklungsskalen Möglichkeiten kompensatorischer Erziehung und Förderung im Hinblick etwa auf Lernreize und soziales Verhalten entworfen und realisiert werden.
Schließlich ist es auch notwendig, „Sozialrückständigkeiten“ zu diagnostizieren, d. h. Beeinträchtigungen der Gesellschaft, die in der Form von Einstellungen, Verhaltensweisen, Gepflogenheiten, materiellen Bedingungen und gesetzlichen Regelungen, Gefährdungen, Störungen und Behinderungen teils verursachen, teils steigern und teils ignorieren und damit mögliche Hilfestellungen verhindern (Bach 1995, 19). Die „Diagnose behindernder Bedingungen“ (Bundschuh 2019, 101–105) wird seit einigen Jahren verstärkt gesehen und erforscht.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angeführten Formen der Beeinträchtigung häufig in Verbindung unterschiedlicher Kombinationen mit wechselseitigem Verstärkungscharakter auftreten und dass zwischen Behinderungen und Störungen, zwischen Störungen und Gefährdungen und zwischen Gefährdungen und Sozialrückständigkeiten fließende Übergänge bestehen können.
Aufgabe des vorliegenden Buches ist es nicht primär, über eine Grundlageninformation hinausgehend, Probleme und Kritik der aufgezeigten „Beeinträchtigungen“ mit der Vielfalt wechselseitiger Bezüge und Verflechtungen zu diskutieren und zu erörtern. Hierzu sei auf kritische Literatur im Bereich Sonderpädagogik verwiesen, die sich mit Detailfragen bezüglich Beeinträchtigungen, Störungen und Behinderungen unter dem Aspekt historischer und gegenwärtiger Problemstellungen auseinandersetzt.
Resümierend ist hervorzuheben, dass es nicht nur zum Gegenstandsbereich sonderpädagogischer Diagnostik gehören kann, besondere Strategien der Diagnose in Anlehnung an verschiedene Arten und Schweregrade vorkommender Beeinträchtigungen zu entwickeln, vielmehr wird der Schwerpunkt auf der differenzierten und individuellen Diagnose der kindlichen Problematik und der Bedürfnisse (Bundschuh 2010, 169–178; 2019, 32–42)unter Einbezug des Umfeldes im Sinne des Helfens, Förderns, Kompensierens und des Lernens liegen. Demnach wird die sonderpädagogische Diagnostik in flexibler, dynamischer und differenzierter Weise aktiv werden im Rahmen einer Erziehung unter „erschwerten Bedingungen“ bei vorliegender Behinderung, im Rahmen einer „Fördererziehung“ bei vorliegender Störung, im Rahmen einer „Vorsorgeerziehung“ bei Gefährdung und im Rahmen der „Gesellschaftserziehung“ bei vorliegender Sozialrückständigkeit mit dem Schwerpunkt der Analyse behindernder Bedingungen im Umfeld des Kindes unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Bedingungen.
Aufgrund dieser weiten Aufgabenbereiche kann es nicht genügen, wenn der im Bereich der Sonderpädagogik tätig werdende Diagnostiker nur psychologisch-diagnostisch „in Aktion tritt“ oder handelt, er muss vielmehr zuerst auch als pädagogischer und didaktischer Fachmann ausgewiesen sein (Bundschuh 2008, 232–241), d. h. es geht um die Vermittlung zwischen Lernausgangslage und Lernen bzw. Lernfortschritt.
Zusammenfassend gesehen umfasst das sonder- und heilpädagogische Arbeitsfeld unter Berücksichtigung institutioneller Entscheidungsbereiche primär die folgenden Personengruppen:
1. Kinder, die in früher Kindheit und im vorschulischen Alter als auffällig, teilweise auch als „entwicklungsverzögert“ bezeichnet werden. Pädagogisch relevante Stichworte sind „Früherkennung“, „Früherfassung“ und „Frühbetreuung“, wobei in diesem Zusammenhang auf die ungelöste Problematik der frühen Erkennung bzw. Diagnose und Förderung hinzuweisen ist, d. h. Behinderungen können auch durch Diagnosen erzeugt werden (Bundschuh 2008, 314, 326 ff.).
2. Kinder, die bei der Einschulung individuellen sonderpädagogischen Förderbedarf aufweisen wie z. B. bei offensichtlichen geistigen, sozialen, emotionalen oder körperlichen Beeinträchtigungen.
3. Kinder, die in der Regelschule auffällig werden infolge partiellen oder auch generellen Nichtleistenkönnens (Leistungs- und Schulversagen im Hinblick auf den vorgegebenen Lehrplan, an sich ein „Versagen“ der Schule) in Unterrichtsfächern, wobei keinesfalls gesagt ist, dass diese Kinder in eine „besondere Schule“ / Förderschule aufgenommen werden müssen. Andere Möglichkeiten spezieller Hilfe und Förderung wären unterrichtliche Maßnahmen, Änderung der Einstellung von Eltern und Lehrern gegenüber dem Kind, Überweisung an eine Erziehungsberatungsstelle, therapeutische Maßnahmen. Optimal wären wohl Förder- und Stützmaßnahmen durch Regel- und Sonder- bzw. Förderschullehrer in der Grund- und Hauptschule nach einem gemeinsam erstellten Förder- und Therapieplan.
4. Kinder, die aufgrund ihres Verhaltens in der Regelschule „als nicht mehr tragbar“ gelten. Zu denken wäre dabei an erziehungsschwierige oder verhaltensgestörte Kinder.
5. Kinder, die irgendwelche die Lernleistung und das Sozialverhalten beeinträchtigende Sinnesschädigungen aufweisen (Hör- und Sehstörungen bzw. -behinderungen);
6. körperbehinderte oder hinsichtlich ihrer Motorik beeinträchtigte Kinder;
7. sprachgestörte und -behinderte Kinder;
8. beeinträchtigte Schüler, die vor der Berufswahl stehen. Ihnen sollte bei der Berufsfindung und -ausbildung geholfen werden.
9. Allgemein gesehen Kinder, Jugendliche und Eltern, die sich im Rahmen von Erziehung und Unterricht (Lernen) in einer Problemsituation befinden, vielleicht unter behindernden Bedingungen wie z. B. Armut leben, individuelle Beratung, Hilfe und Unterstützung in Erziehungs- und Lernfragen suchen.
Diagnostik von Behinderung hängt auch von Rahmenbedingungen (auch Langfeldt 2006, 626 ff.) ab, nämlich davon, was man unter „Behinderung“ verstehen möchte. Der Deutsche Bildungsrat (1973, 32) definierte: „Als behindert im erziehungswissenschaftlichen Sinne gelten alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in der sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten soweit beeinträchtigt sind, dass ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft wesentlich erschwert ist. Deshalb bedürfen sie besonderer pädagogischer Förderung.“
Es ist sehr fraglich, ob diese Definition in Zeiten des Bemühens um Integration und Inklusion noch eine Gültigkeit hat. Diese Definition weist auf zweierlei hin:
– Nicht ein funktionales Defizit macht die Behinderung aus, sondern die Einschränkung, die sich daraus für die gesellschaftliche Integration ergibt.
– Es besteht eine uneingeschränkte ethische Pflicht zur Förderung.
Die ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) hingegen konzentriert sich weniger auf ein medizinisches Verständnis von Behinderung und Defekten als die traditionelle Beschreibung von Behinderung, sondern berücksichtigt deren soziale Konstruktion. Die der ICF zugrunde liegenden, in Wechselwirkung stehenden Komponenten „Körperfunktionen und –strukturen“, „Aktivitäten und Partizipation“, „Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren“ (Hollenweger / Kraus de Camago 2013, 36 ff.) ermöglichen die Verwendung sowohl positiver wie negativer Begriffe und setzen damit auch deutliche ressourcen- und kompetenzorientierte Akzente. Darüber hinaus werten Göttgens und Schröder (2014, 36) die ICF als „Schlüssel für eine gelingende interdisziplinäre Zusammenarbeit, da das Klassifikationssystem eine gemeinsame Sprache für die am förderdiagnostischen Prozess beteiligten Professionen ermöglicht“.
Tab. 1: Anzahl der schulpflichtigen Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Bundesrepublik im Jahr 2002
AnzahlProzentschulpflichtige Schüler der Klassen 1 bis 10 insgesamt8.941.561100,000darunter Behinderte mit Förderschwerpunkt:Lernen (Lernbehinderte)262.3892,934Sehen (Sehbehinderte und Blinde)6.6130,074Hören (Schwerhörige und Gehörlose)14.5180,162Sprache (Sprachbehinderte)44.8910,502Körperliche und motorische Entwicklung (Körperbehinderte)26.4830,296Geistige Entwicklung (Geistigbehinderte)70.4510,788Emotionale und soziale Entwicklung (Verhaltensgestörte)41.0120,459Förderschwerpunkt übergreifend bzw. ohne Zuordnung19.2950,216Kranke9.5920,107Behinderte insgesamt495.2445,539Pragmatisch lässt sich festhalten, dass Kinder, die dem Bildungsgang der Regelschule (Grund- und / oder Hauptschule) nicht zu folgen vermögen, als „behindert“ gelten und deshalb in besonderer Weise gefördert werden müssen. Sie stellen einen Teil der Klientel der sonderpädagogischen Diagnostik dar, deren Umfang gegenwärtig fast eine halbe Million Schüler betrifft (Tab. 1). Jährlich werden schätzungsweise 50.000 Kinder und Jugendliche diagnostiziert und begutachtet. Nimmt man allerdings den Präventionsbereich und die damit verbundene wichtige Aufgabe des Lern- und Leistungsbereiches mit hinzu, dürfte sich die Zahl der zu untersuchenden Kinder wohl eher verdoppeln.
Zur Erziehung und Unterrichtung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder verfügt die Bundesrepublik über ein differenziertes System unterschiedlicher Förderschulen. Es gibt Förderschulen (für Blinde, Sehbehinderte, Gehörlose, Hörgeschädigte, Körperbehinderte und für Kranke), die in Analogie zum Regelschulwesen zu sehen sind. In ihnen ist es wenigstens prinzipiell möglich, bis zur Hochschulreife zu gelangen. Schulen für den Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung und für den Förderbedarf Sprache streben nach entsprechendem therapeutischem Erfolg eine Rückführung in das Regelschulsystem an. Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen hingegen vermitteln einen eigenen Abschluss und bieten die Option einer externen Hauptschulabschlussprüfung. Schulen für Kinder mit Förderbedarf geistige Entwicklung führen meistens in eine beschützende Einrichtung. In einigen Bundesländern gibt es nachdrückliche Bemühungen, diese Differenzierung zu überwinden und Kinder mit Behinderung bzw. mit einem speziellen Förderbedarf in Regelschulen „integrativ“ zu fördern. Insgesamt werden gegenwärtig fast 66.000 (13,3 %) der Schüler mit Behinderung in Regelschulen integrativ unterrichtet. Die Integrationsquote variiert jedoch in Abhängigkeit vom Schweregrad der Behinderung, der Behinderungsart oder auch von der Höhe des Förderbedarfs beträchtlich (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2003). Im Zusammenhang mit der Integrations- und Inklusionsdebatte wird in der erziehungswissenschaftlichen Literatur und im Praxisfeld zunehmend der Begriff „behindert“ zu Gunsten der Umschreibung „Person / Schüler mit besonderem / speziellem Förderbedarf“ ersetzt.
Anforderungen an die Diagnostik
Primäres Ziel der sonderpädagogischen Diagnostik ist die Feststellung des besonderen Förderbedarfs mit einer anschließenden Entscheidung über den angemessenen Förderort (Förderschule oder Regelschule). Das dabei von Lehrkräften der Sonder- bzw. Förderschulen durchzuführende Verfahren ist weitgehend durch Verordnungen der Bundesländer geregelt, in denen u. a. eine medizinische und eine sonderpädagogisch-diagnostische Überprüfung verbindlich vorgeschrieben werden. Soweit es sich auf schulische Entscheidungen bezieht, ist das Verfahren für die verschiedenen Gruppen von Kindern mit Behinderung formal weitgehend gleich und von der Wahl des späteren Förderortes unabhängig. Verantwortlich für seine korrekte Durchführung ist die Schulaufsicht.
Spezielle Förderung kann darüber hinaus auch an Regelschulen unter Einbezug mobiler sonderpädagogischer Dienste an Sonderpädagogischen Förderzentren erfolgen. Die Regelschule hat an sich auch die Aufgabe, Schüler zu fördern. Hierzu ist ein von einem Kompetenzteam erstellter Förderplan hilfreich (Bundschuh 2019, 231–247, Kap. 6.6.3), d. h., auch an der Regelschule kann individuelle Förderung mittels eines Förderplanes durchgeführt werden.
Bei Kindern mit Sinnesbeeinträchtigung (-schädigung) oder Kindern mit Körperbehinderung erfolgt eine einschlägige Diagnostik bereits im Kleinkind- oder Vorschulalter (Kap. 5.2.2). Sie ist im Rahmen von Frühförderung teils medizinisch, teils pädagogisch-psychologisch an den Möglichkeiten sensorischer oder motorischer Förderung orientiert (Bundschuh 2019, 256–267). Bei Kindern mit Sprachstörung ist eine Diagnostik der Sprachentwicklung (Sprachdiagnostik), die in logopädische Therapien münden kann, schon im Vorschulalter möglich. Bei vorliegendem Förderbedarf geistige Entwicklung (traditionell „geistige Behinderung“) steht pädagogisch-psychologisch betrachtet die Diagnostik des Entwicklungsstandes mit Hilfe von Entwicklungsskalen und Entwicklungstests, speziell auch unter Anwendung diagnostischer Verfahren für verschiedene Schweregrade von Behinderung, und darüber hinaus die Diagnostik adaptiver Kompetenzen im Vordergrund (Kap. 5.2.2.2 bis 5.2.2.4). Entwicklungsstörungen, speziell auch Förderbedarf geistige Entwicklung, zu diagnostizieren bedeutet, sich an pädagogischen Prinzipien der Frühdiagnostik und Frühförderung zu orientieren.
Obwohl Verhaltensstörungen relativ frühzeitig diagnostiziert werden können, wird die Diagnose für viele Kinder erst im Grundschulalter relevant, wenn sie mit den Regeln für angemessenes schulisches Verhalten kollidieren. In der schulischen Praxis werden Aufmerksamkeitsstörungen (Aufmerksamkeitsdiagnostik) und soziale sowie emotionale Störungen (Bundschuh 2003, 159–180; 2019, 193–206, 219–229) häufig als dominierend beschrieben.
Förderbedarf Lernen tritt in der Regel im Gegensatz zu den übrigen Förderbedürfnissen (traditionell: Behinderungsarten) erst im unmittelbaren Zusammenhang mit der Beschulung auf. Aus diesem Grund ist es grundsätzlich diskussionswürdig, inwieweit Lern- und / oder Verhaltensprobleme mit den Ressourcen des Kindes zusammenhängen oder als institutionelles Versagen der Schule zu betrachten sind.
Die Diagnostik von Kindern mit einem speziellen Förderbedarf erweist sich häufig als komplex, denn es muss meist auch die Kind-Umfeld-Diagnose einbezogen werden, teilweise verbunden mit der Problematik „Grenzfälle“ und Mehrfachbehinderung. Kinder mit Lernschwierigkeiten zeigen häufig auch Verhaltensstörungen; Kinder mit Sprachstörungen haben teilweise auch Schwierigkeiten im Lernen; sinnes- und / oder organgeschädigte Kinder können ebenso verhaltensgestört, sprachgestört oder lernbehindert sein wie sensorisch und körperlich gesunde Kinder. In solchen Fällen kann die vorgesehene Beschulung dann eher von äußeren Umständen (z. B. Erreichbarkeit von Schulen) als von konkreten Ergebnissen der Diagnostik abhängen.
Gerade die Diagnostik von „Lernbehinderung“ galt lange Zeit und gilt heute noch als problematisch im Kontext umstrittener Praxis.
Im Jahre 1973 verabschiedete der Deutsche Bildungsrat eine einflussreiche Definition von Lernbehinderung, die unterdurchschnittliche Intelligenzleistung und schwerwiegendes, umfängliches Schulversagen als bestimmende Merkmale von Lernbehinderung vorsah (Deutscher Bildungsrat 1973, 38). Die Diagnose Förderbedarf Lernen umfasst weit mehr als Intelligenzdiagnostik und Schulleistungsdiagnostik.
Die angeführte Definition von Lernbehinderung stimmt nicht, wie man vermuten könnte, mit dem überein, was im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch unter „learning disabilities“ verstanden wird. Diese werden als Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher und unterscheidbarer Störungen (oder Schwierigkeiten) verwendet, die das Lernen beeinträchtigen können. Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, Rechenschwierigkeiten oder Aufmerksamkeitsstörungen gehören beispielsweise dazu. Learning disabilities werden vorwiegend als isolierte Teilleistungsstörungen bei durchschnittlicher Intelligenz betrachtet, die nicht zu „umfänglichem Schulversagen“ führen müssen. Sie fallen daher nicht unter den Begriff der Lernbehinderung.
Je umfänglicher der Förderbedarf – „das Schulversagen“ – eines Kindes ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Teilleistungsstörungen gemeinsam auftreten.
Insofern bedeutet eine Diagnostik von Lernbehinderung auch Sprachdiagnostik, Aufmerksamkeitsdiagnostik und Diagnostik von Lernstörungen.
Dies stimmt mit einem differenzierten Beschreibungsversuch von Kanter (1980) überein, in dem Lernbehinderung einerseits auf niedrige Intelligenz zurückgeführt wird und andererseits auf chronifizierte Lernstörungen, die neurologisch, konstitutionell, psychoreaktiv und / oder sozio-kulturell bedingt sein können. Es handelt sich demnach bei den Schülern mit einem speziellen Förderbedarf Lernen (bisher „Lernbehinderung“ genannt) um eine heterogene Gruppe. Dies zeigt sich auch an den Inhalten der diagnostischen Gutachten.
Aus Sicht der Psychologie unterscheidet sich der diagnostische Prozess bei Kindern mit einem hohen Förderbedarf (Kinder mit Behinderung) nicht grundsätzlich von sonstiger pädagogisch-psychologischer Diagnostik, allerdings liegt der Schwerpunkt auf der sonder- und heilpädagogischen Verantwortung. Im außerschulischen Kontext arbeiten Psychologen u. a. mit (Kinder-)Ärzten, Kinder- und Jugendpsychiatern, Kindertherapeuten, Logopäden oder Physiotherapeuten zusammen. Dabei geht es um individuelle Diagnostik und Therapie, die in der Regel als unmittelbare Hilfe wahrgenommen werden. Im schulischen Kontext dagegen sind auch schwierige institutionelle Entscheidungen zu treffen, dabei sind Sonderpädagogen die professionellen Interaktionspartner.
In Ablehnung einer Diagnostik, die Selektionsentscheidungen im Schulsystem unterstützen oder gar legitimieren sollte, entwickelte sich das Programm Förderdiagnostik (Bundschuh 1994; 2007; 2019). Es geht dabei zunächst um das (Fremd-) Verstehen der Kinder, um Beziehungsgestaltung, ganzheitliche, qualitative und / oder prozessorientierte-systemische Sichtweisen. Quantitative Diagnostik (standardisierte Tests oder Kategoriensysteme) spielt vor allem im institutionellen Bereich eine Rolle. Darüber hinaus leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Erkennung von Ursachen (z. B. Wahrnehmungsstörungen, Ängste, psychische Probleme allgemein) und kann damit auch im Dienste einer differenzierteren Analyse einer Lern-Leistungs- und / oder Verhaltensproblematik und der sich daraus abzuleitenden Fördermaßnahmen stehen.
Man muss davon ausgehen, dass Behinderungen nicht isoliert auftreten, dass sie sekundäre Beeinträchtigungen im Gefolge haben. So kann man sagen, dass jedes Kind mit einer Behinderung auch „mehrfachbehindert“ sein wird, denn auch soziale und emotionale Bereiche sind in der Regel betroffen (Bundschuh 2003). Daraus ergibt sich die Aufgabe, durch Förderpläne und Einleitung kompensatorischer Maßnahmen Folgebeeinträchtigungen orientiert an vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen vorzubeugen.
Aber auch nach der Beseitigung einer Störung werden weitere Betreuung und Fürsorge notwendig sein, dafür müssen behindernde Bedingungen im Umfeld des Kindes analysiert und neutralisiert werden.
Man kann wie folgt den Gegenstand sonderpädagogischer Diagnostik beschreiben: Gegenstand einer sonderpädagogischen Diagnostik ist der Mensch / das Kind, der / das bezüglich einer (optimalen) Entfaltung seiner Möglichkeiten im geistigen, sozialen, emotionalen oder physischen Bereich gefährdet, bedroht, gestört oder behindert ist, wobei Prozesse der Isolation von der Aneignung der Welt (behindernde Bedingungen) stets mitgedacht werden müssen.
Einbezogen werden demnach in den Gegenstandsbereich die Sozialrückständigkeiten der Gesellschaft, die in der Form von Einstellungen, Verhaltensweisen, Gepflogenheiten, materiellen Bedingungen und gesetzlichen Regelungen, Gefährdungen, Störungen und Behinderungen teils verursachen, teils steigern, teils ignorieren und damit mögliche Hilfestellungen verhindern.
Aus diesem komplexen Gegenstand ergibt sich für die sonderpädagogisch-psychologische Diagnostik ein weites Aufgabenfeld.
3.3 Aufgabenbereiche sonder- und heilpädagogischer Diagnostik im Rahmen institutioneller und organisatorischer Entscheidungsfelder
Innerhalb unseres Schulsystems stehen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der individuellen Schulkarriere institutionelle Entscheidungen über den weiteren schulischen Werdegang an. Dabei stellt die Entscheidung für oder gegen den Förderschulbesuch eines Kindes oder Jugendlichen eine Besonderheit dar. Sie verlangt die Durchführung eines formellen Verfahrens, in dessen Verlauf eine pädagogisch-psychologische Diagnostik und Begutachtung erfolgt. Dieses Tätigkeitsfeld wird in der deutschen Sonderpädagogik als eine genuin pädagogische Aufgabe betrachtet, bei welcher der Psychologie nur der Status einer Hilfswissenschaft zugesprochen wird. In der Praxis werden daher in der Regel ausschließlich Lehrer für Sonderpädagogik mit dieser Aufgabe betraut; die Beteiligung von Diplom-Psychologen stellt eine Ausnahme dar, wenngleich Kooperation stets wünschenswert ist.