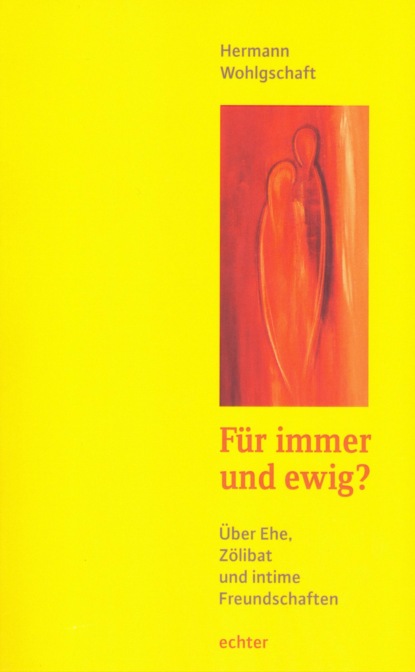- -
- 100%
- +
Ein Kulturkritiker, ein Pessimist könnte nun klagen: In sehr vielen Fällen bleibt die Begegnung der Geschlechter ein Intermezzo. Nicht selten auch bleibt die ›Liebe‹ etwas Banales, etwas rein Oberflächliches, etwas sehr Kurzweiliges, das über Spaß und sexuelles Vergnügen kaum hinausreicht. Wenn ein junger Mann und eine junge Frau sich heftig verlieben und anschließend ›zusammen‹ sind, so dauert das oft nur wenige Wochen. Lebendige Paarbeziehungen auf Lebenszeit sind eher die Ausnahme. Denn die hohen Scheidungsraten in den westlichen Industrieländern sind ja sicherlich nur die Spitze eines riesigen Eisbergs. Sehr häufig kommt es nach kurzer Zeit – manchmal auch nach sehr langer Zeit – zur äußeren oder inneren Trennung, auch ohne förmliches Scheidungsverfahren.
Oftmals, so könnte der Kritiker hinzufügen, wird eine feste Beziehung – eine Eheschließung oder ein eheähnliches Zusammenleben – von Anfang an gar nicht angestrebt. Die ›Liebesbeziehung‹ wird von vornherein als Episode, als vorübergehendes Abenteuer betrachtet. Man trennt sich im gegenseitigen Einvernehmen (oder auch gegen den Willen des anderen), sobald es die ersten Schwierigkeiten gibt. Oder man bleibt zwar nach außen hin ein Paar, hat sich aber schon längst entfremdet und auseinandergelebt.
3. Zur Geschlechterbeziehung
Solche oder ähnliche Analysen werden im Kern ja wohl zutreffen. Dennoch wende ich ein: Was als Abenteuer, was als Flirt, als unverbindliches Spielchen beginnt, kann immer noch Liebe werden. Das Leben insgesamt ist ja Übung. Gerade auch die Liebe will eingeübt sein – oft über tragische Umwege, manchmal über längere Irrwege und schwerwiegende Fehler. Es kann dann unter Umständen sein, dass eine Paarbeziehung als zerrüttet, als nicht mehr lebbar erscheint und deshalb beendet wird – um mit einem anderen Partner eine neue Chance zu erleben und mit ihm einen neuen Anfang zu suchen.
Dem Bruch oder der inneren Aushöhlung einer Partnerbeziehung geht meist ein mehr oder weniger schuldhaftes Verhalten auf beiden Seiten voraus. Das heißt aber nicht, dass die Trennung vom Partner in jedem Fall etwas Verwerfliches wäre. Es kann – wie noch genauer zu erörtern ist6 – Situationen geben, in welchen die Trennung um der Würde der Partner willen sogar zwingend erforderlich ist.
Aber ihrem eigentlichen Wesen nach ist die Liebe von Mann und Frau, das ist meine innerste Überzeugung, auf Dauer hin angelegt. Dieses Wesen der Partnerliebe kann zwar nicht immer realisiert werden. Umso wichtiger aber ist es, dieses eigentliche Ziel der Liebe nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren.
Die tiefe, der Herzensmitte entspringende Partnerliebe ist etwas Großes. Sie ist etwas wunderbar Schönes, ja Heiliges, das von Gott kommt und zu Gott hinführt. Eine derartige Paarbeziehung ist ein kostbares Gut, viel zu kostbar, als dass es fremden Interessen geopfert werden dürfte. Nein, der Partnerliebe eignet eine unantastbare Würde und sie hat ihren Wert durchaus in sich selbst.
Freilich will ich keiner ›losgelösten‹ Zweierbeziehung das Wort reden, keinem verantwortungslosen, allein auf sich selbst bezogenen ›Egoismus zu zweit‹. Denn Liebe besteht – um ein bekanntes Wort von Antoine de Saint-Exupéry etwas abzuwandeln – nicht nur darin, »dass man einander ansieht«, sondern zugleich auch darin, »dass man in die gleiche Richtung blickt«.7
Was Paare nachhaltig und auf Dauer verbindet, sind vor allem die gemeinsamen Ziele und Aufgaben. Paarbeziehungen dürfen sich also nicht isolieren von der Welt und von der Gesellschaft. Selbstverständlich müssen sie – anders könnten sie gar nicht gelingen – fest eingebunden sein in ihre soziale Umgebung, in Freundeskreise, ja in das Ganze der Schöpfung. Und die Paare müssen im Rahmen ihrer Möglichkeiten Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft und in ihrem besonderen Umfeld.
Was aber zurückgewiesen, was kritisiert und bekämpft werden müsste, sind soziale Rahmenbedingungen, die die Möglichkeit einer personalen Liebesbeziehung von Mann und Frau nicht fördern, sondern eher behindern. Ich denke – um ein extremes Beispiel zu bringen – an autoritäre Strukturen, an totalitäre, inhumane Systeme, die die individuelle Person und ihre Privatsphäre zu entmündigen und zu reglementieren versuchen. Auch die Ehen und die Familien können in solchen Systemen – unter entsprechenden Umständen, wenn die Ideologie es verlangt – dem Kollektiv oder der Staatsräson zum Opfer gebracht werden.
Individuelle Personen und somit auch Partnerbeziehungen dürfen in keinem Fall zum Spielball werden für ›höhere‹ Mächte. Paarbeziehungen sind zwar ein Teil der Gesellschaft, aber die Gesellschaft darf über sie nicht bestimmen. Genau dies aber geschieht in manchen politischen, kulturellen oder religiösen Systemen – wenn z. B. festgelegt wird, wer wen heiraten darf. Oder wenn sogar festgelegt wird, wer wen heiraten muss (zum Beispiel aufgrund einer Schwangerschaft)! Ganz zu schweigen von den Kinder-Ehen, wie sie in europäischen Adelshäusern lange Zeit üblich waren und wie sie teilweise noch heute in manchen Ländern und Kulturen der Brauch sind: eine Praxis, die personale Geschlechterliebe schon im Ansatz erstickt und (innerhalb der Ehe) gar nicht erst aufkommen lässt.
4. Zum kirchlichen Eheverständnis
Bei solchen ›Ehen‹ ging bzw. geht es natürlich in keiner Weise um die wirkliche Liebe von Mann und Frau, sondern einzig um die Interessen der Familienclans. Die Eheschließungen wurden bzw. werden von anderen gesteuert und einem bestimmten Zweck unterworfen. Sie dienen allein dem Willen der Familien, ihre politische Macht oder ihr materielles Vermögen zu festigen und möglichst noch zu vergrößern. Die Liebe, die leiblich-seelische Zuneigung der Partner ist bei solchen ökonomischen oder gesellschaftspolitischen Arrangements allenfalls eine Nebensache. Für Zärtlichkeit, für wahre Partnerbeziehung oder gar für ›romantische‹ Liebe bleibt hier wenig oder keinerlei Raum.
Jahrhundertelang wurde auch im Eheverständnis der katholischen Kirche die Partnerliebe als etwas Unwichtiges oder (wenn es hoch kommt) Sekundäres betrachtet. Denn im Wesentlichen ging es – bis zum Vaticanum II, also bis in die 1960er Jahre hinein – lediglich um die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft sowie um die gesetzliche Regelung des Geschlechtstriebs.8
Freilich erst seit dem Mittelalter wurde in der Kirche die Frage nach den Merkmalen einer christlichen Ehe bzw. nach den Bedingungen für die Gültigkeit einer Ehe intensiver und dringlicher gestellt.9 Es war dann immerhin ein wichtiger Schritt, dass die kirchliche Rechtsauffassung den freien Konsens der erwachsenen Partner zur Voraussetzung für die Gültigkeit einer sakramental geschlossenen Ehe erklärte. Wobei mir die Festlegung des ehemündigen Alters auf die Vollendung des 16. Lebensjahres bei Männern bzw. des 14. Lebensjahres bei Frauen allerdings erschreckend niedrig erscheint. Diese im Prinzip noch immer geltende Rechtsbestimmung10 der Kirche verrät ganz offenkundig ein biologistisches, allein an der Zeugungsfähigkeit orientiertes Eheverständnis. Dass Teenies im fast noch kindlichen Alter grundsätzlich in der Lage sein sollen, eine unwiderrufliche Lebensentscheidung zu treffen und sich gegenseitig auf Lebenszeit die eheliche Liebe und Treue zu versprechen, ist schlichtweg nicht nachzuvollziehen.
Auf der anderen Seite gibt es eine durchaus erfreuliche Weiterentwicklung des katholischen Eheverständnisses. So ist es sehr zu begrüßen, dass im heutigen Kirchenrecht – im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil11 – das beiderseitige »Wohl der Ehegatten« an erster Stelle genannt wird.12 Doch in mehrfacher Hinsicht halte ich das kirchliche Eheverständnis, die jetzige Doktrin über die Partnerbeziehung von Mann und Frau, noch immer für unzureichend, für sehr weltfremd und dringend reformbedürftig.
Mit Recht zwar wird die Ehe in den christlichen Kirchen, einschließlich der Kirchen der Reformation,13 sehr wertgeschätzt. Theologisch zu Recht auch wird der – auf freier Entscheidung basierende – Ehebund in der katholischen Kirche und in der ostkirchlichen Orthodoxie als Sakrament angesehen: als wirksames und erfahrbares Zeichen für die Liebe Gottes zur Welt und zum Menschen. Gleichwohl scheinen mir die kirchliche Sexualmoral und auch das derzeitige kanonische Eherecht (ganz abgesehen von der antiquierten und verrechtlichten Diktion) viel zu einseitig und menschenfern.
›Erlaubte‹ und nicht von vornherein ›sündhafte‹ Partnerbeziehungen kann es nach der herkömmlichen Lehre der katholischen (wie auch der evangelischen) Kirche ja ausschließlich im Rahmen der ehelichen Verbindung geben. Eine echte, von Gott gesegnete und geheiligte Geschlechterliebe auch vor oder außerhalb der kirchenrechtlich ›gültigen‹ Ehe ist nach der traditionellen katholischen Lehre absolut nicht vorgesehen, jedenfalls nicht für getaufte Christen.
Diese rigorose Auffassung, die sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe strengstens verbietet und in jedem Falle als schwere Sünde verurteilt, korreliert zugleich mit einem sehr verengten Eheverständnis. Sie entspringt einem überholten Konzept, das die Ehe auf eine biologische Zweckgemeinschaft reduziert und den Eheleuten das exklusive, mit dem Willen zur Fortpflanzung verknüpfte »Recht auf den Körper« (ius in corpus) des anderen gewährt. Das Ehesakrament wird in diesem Verständnis primär als juristischer Vertrag angesehen, in welchem sich die Partner – wie der katholische Moraltheologe Eberhard Schockenhoff kritisch bemerkt – »gegenseitig das Recht zum Geschlechtsverkehr übertragen. Unter dieser Voraussetzung ist es allerdings konsequent, allen unverheirateten Paaren (…) das Recht zur sexuellen Gemeinschaft abzusprechen.«14
Die sehr mangelhafte und ungenügende Konzeption der Ehe als einem vertraglichen Rechtsverhältnis wurde durch das Zweite Vatikanische Konzil zwar überwunden: zugunsten eines personalen Verständnisses, das in der Ehe eine partnerschaftliche, von wechselseitiger Liebe getragene Lebensgemeinschaft sieht. Doch diese weiterführende Sichtweise des Konzils wurde im neuen kirchlichen Gesetzbuch (1983) nicht konsequent übernommen. Denn der § 2 des Kanon 1055 fällt wieder ganz in das vertragsrechtliche Schema zurück, »als sei auf dem Konzil nichts geschehen«.15
Auch in anderen Punkten empfinde ich das Eheverständnis der katholischen Kirche als nach wie vor zu eng, als zu weit entfernt von den vielfältigen Wirklichkeiten des Lebens. So hätte z. B. die kirchliche Position zur Empfängnisverhütung schon längst korrigiert werden müssen. Außerdem wäre es aus mehreren – später noch zu erörternden16 – theologischen Gründen überfällig, wiederverheiratet Geschiedenen die Sakramente nicht generell zu verweigern, d. h. sie nicht auf Dauer als Christen ›zweiter Klasse‹ zu behandeln.
5. Zum kirchlichen Sexualkomplex
In der praktischen Seelsorge findet sich in Konfliktfällen zwar meist eine vernünftige Lösung, ein gangbarer Weg. Aber es bleibt ein Zwiespalt, ein Unbehagen, ein schaler Geschmack. Wenn Theorie und Praxis zu weit auseinanderklaffen, liegt ja der Vorwurf der Doppelmoral und der fehlenden Glaubwürdigkeit auf der Hand.
Das von Walter Kardinal Kasper vermutete bzw. befürchtete »vertikale Schisma«,17 d. h. die Kluft zwischen feudal-hierarchischen Strukturen der Kirche und dem modernen Lebensgefühl in den Industrienationen Europas und Amerikas, die Differenz auch zwischen ›amtskirchlicher‹ Lehre und dem tatsächlichen Verhalten des Gottesvolks scheint immer größer zu werden. Gerade was die Bereiche Ehe, Familie und Sexualität betrifft, weicht das Glaubens- und Moralbewusstsein der meisten – auch der kirchlich engagierten – Katholiken sehr deutlich ab von manchen Rundschreiben der Päpste oder anderen Lehrdokumenten der römischen Glaubensbehörden. Allein schon diese Tatsache ist theologisch relevant und sollte uns zu denken geben.
Das Thema ›Kirche und Sexualität‹ ist überhaupt ein sehr heikles Kapitel. Wie die russisch-orthodoxe Journalistin Anna Galperina – mit Bezug auf die christlichen Ostkirchen – bemerkt,18 ist die Distanz vieler Jugendlicher und Erwachsener zum kirchlichen Leben wesentlich mitbedingt durch das Unverständnis vieler Kleriker und vieler Kirchenführer im Blick auf Liebe und Sexualität. Anna Galperina warnt vor einer despektierlichen Sichtweise, die die menschliche Sexualität von Haus aus verdächtigt, sie kurzschlüssig auf Sünde und Unzucht reduziert. Eine kirchliche Sexuallehre, in der die Perspektive des Verbotenen und Beargwöhnten vorherrscht, fördert – so die russische Journalistin – die Entfremdung zwischen der Kirche und den Menschen.
Für die katholische Kirche trifft Galperinas Kritik gewiss nicht weniger zu. In ihrem Bestseller ›Eunuchen für das Himmelreich‹ (1988)19 hat die katholische Theologin Uta Ranke-Heinemann aus bibelexegetischer, aus kirchenhistorischer und ethischer Sicht die römisch-katholische Sexualmoral, zum Beispiel das Kondomverbot, sehr scharf attackiert – im Ton leider oft zu polemisch und überspitzt, in der Sache aber weitgehend zu Recht.
Ohne hinreichende Begründungen und ohne das Gewissen des einzelnen Christen genügend ernst zu nehmen, wird in der katholischen Kirche eine sehr enge Sexualmoral offiziell noch immer vertreten. Es kann aber nicht genügen, wenn die kirchliche Obrigkeit eine rigide Morallehre nur immerfort wiederholt und autoritär verordnet. Das unermüdliche Einschärfen von fragwürdigen und längst überholten Lehrmeinungen (etwa im Blick auf die Empfängnisverhütung) könnte außerdem die Autorität untergraben, die die Kirche in ethisch wesentlich wichtigeren Bereichen, z. B. in der Soziallehre oder in der Friedenspolitik, so dringend brauchen würde.
Nur nebenbei gesagt: Dass der kirchliche Einfluss in Politik und Gesellschaft immer geringer wird, liegt zum Teil an der Kirche selbst. »Ein schwerwiegendes Problem insbesondere der katholischen Kirche ist«, so der katholische Publizist Johannes Röser, »dass sie in der Art, wie sie sich in Ämtern, Strukturen, Kult, Frömmigkeit und dogmatischen wie moralischen Aussagen präsentiert, von sehr vielen Menschen nur noch als exotisch wahrgenommen wird.«20
Nicht der einzige, aber ein wesentlicher Grund für den Autoritätsverlust der katholischen Kirche in unserer heutigen – zunehmend aufgeklärten, auf plausible Argumente setzenden – Gesellschaft ist zweifellos die Sexuallehre. Noch weitaus gravierender jedoch als der kirchliche Autoritätsverlust ist das katastrophale (aber hoffentlich rückläufige) Phänomen: Es gab und es gibt noch immer Frauen und Männer, die durch eine verengte, ja skrupulöse Sexualerziehung erheblich geschädigt wurden! Sie verstehen zum Beispiel die Onanie als Todsünde und leben in ständiger Angst vor der Hölle. Oder sie betrachten allein schon die sexuelle Phantasie als Teufelswerk und kommen sich als schwere, von Gott in alle Ewigkeit verdammte Sünder vor.
Der katholische Theologe und Psychotherapeut Wunibald Müller, der sich in zahlreichen Publikationen intensiv mit dem Themenfeld ›Kirche und Sexualität‹ auseinandersetzt, bringt seine vielfältigen Eindrücke von Gesprächskreisen und einschlägigen Vorträgen auf den kritischen Punkt:
Es ist oft erschreckend, dabei zu erfahren, wie tief verletzt sich Menschen fühlen von dem, was ihnen durch ihre Kirche oder ihre Vertreter anscheinend im Namen Gottes über Sexualität und den persönlichen Umgang mit ihrer Sexualität gesagt worden ist. Nicht wenige (…) klagen über negativ geprägte Erfahrungen ihrer Kindheit, die (…) es ihnen nahezu unmöglich machen, ein normales und freies Verhältnis zu ihrer Sexualität zu entfalten. (…) Diese Menschen haben den Eindruck, dass ihnen die Kirche eine Wunde zugefügt hat, indem sie ihnen ein Bild von Sexualität vermittelte, das Sexualität als etwas Schmutziges, Unkeusches darstellte. Das führte dazu, dass sie, wenn sie ihre Sexualität überhaupt leben, diese nicht wirklich genießen können.21
6. Zur sinnlichen Lust in protestantischer Sicht
Nicht nur in der römisch-katholischen Kirche und nicht nur in der ostkirchlichen Orthodoxie, auch in den reformatorischen Kirchen können wir noch heute auf sehr negative Einstellungen zur Sexualität treffen. Dies hat natürlich geschichtliche Hintergründe, die weit zurückreichen.
Nicht grundsätzlich anders als im traditionellen Katholizismus sah auch Martin Luther im Ehestand einen doppelten Sinn: Kinder zu zeugen und in Keuschheit, d. h. frei von Unzucht, zu leben. Diese Auffassung der Ehe ist nun zwar – so der dänische Lutheraner Knud Løgstrup – »nicht so zu verstehen«, dass nicht »auch herzliche Hingabe und gegenseitige Rücksichtnahme« für Luther bedeutsam waren.22 Aber die einseitig funktionale, an der Zeugung von Nachkommenschaft und an der Zähmung des Geschlechtstriebs orientierte Deutung von Ehe und Partnerliebe bleibt bei Martin Luther doch unverkennbar.
Mit den asketischen Vorstellungen der frühchristlichen und mittelalterlichen Mönche hat der Wittenberger Reformator nie vollständig gebrochen. Luther, der öffentlich zugab, dass er »weder Holz noch Stein« sei,23 baute zur Sexualität eine ambivalente Beziehung auf. Einerseits sah er im Sexualtrieb eine in der Schöpfungsordnung begründete, also gottgewollte Energie. Andererseits aber erklärte er die sinnliche Lust als solche für sündhaft! Diesen Widerspruch glaubte er dadurch zu lösen, dass er zwischen Fortpflanzungstrieb (instinctus procreandi) und sexueller Lust (libido) unterschied. Aber diese theoretisch zwar richtige Unterscheidung bringt wenig. Sie führt eher zu kuriosen Konstrukten, aber wohl kaum zu einer positiven Wertung der sinnlich-erotischen Liebe und der spielerischen, zweckfreien Zärtlichkeit.
Fatalerweise bezeichnete Luther die Ehe als »Spital der Siechen«!24 Womit er wohl sagen wollte, dass Gott mit der Sündhaftigkeit des Geschlechtstriebes insofern Erbarmen und Nachsicht übe, als ja die Ehe vor der noch größeren Sünde der Unzucht und der Hurerei bewahren werde – sofern nur die Geschlechtslust gemäßigt und einigermaßen beherrscht wird.
Die Abwertung von Sexualität und erotischer Leidenschaft wurde in der evangelischen Christenheit nur partiell überwunden Gewiss nicht im gesamten Protestantismus, aber in sehr konservativen und evangelikalen Zirkeln, zum Teil auch in pietistischen Kreisen, ganz besonders auch in manchen evangelischen Freikirchen wird die gelebte Sexualität – in domestizierter und lustloser Form – allein in der Ehe zugelassen. Jeder »Sex vor der Ehe« und jede Intimbeziehung nicht verheirateter Paare werden verteufelt.
7. Zur Sexualität als Quelle der Spiritualität
Viele Menschen, innerhalb wie außerhalb der Kirchen, haben zur Sexualität ein gestörtes Verhältnis. Negativ besetzten Vorstellungen von Sexualität ist aber strikt entgegenzuhalten: Die Geschlechtlichkeit des Menschen ist zwar im Höchstmaße anspruchsvoll, sie ist ein hoch sensibler Bereich und sie kann auch zur Falle werden. Das sexuelle Leben ist immer schon gefährdet und anfällig für den Missbrauch. Die sexuelle Intimität kann aber auch bestens gelingen und zum Segen für beide Partner werden. Grundsätzlich ist die Geschlechtlichkeit eine höchst wertvolle Gabe Gottes. Sie ist eine der wichtigsten Energiequellen, sie gehört wesentlich zur Schöpfung und sie gehört essentiell zum Menschen in seinem Mann- oder Frausein.
Auch durch das geistliche Leben, durch die persönliche Gottesbeziehung kann die menschliche Sexualität nicht einfach verdrängt oder ersetzt werden. Im Gegenteil: Das sexuelle Erleben ist, mit Wunibald Müller gesprochen, geradezu eine »Quelle der Spiritualität«.25 Ja das Dasein mit allen Sinnen, also auch den sexuellen Gefühlen, ist der normale, der natürliche Weg zur Gotteserfahrung!
Die Fähigkeit, Gott und die Menschen aus ganzer Seele und mit ganzem Herzen zu lieben, beruht – wie die amerikanische Theologin und Ordensfrau Sandra M. Schneiders unterstreicht – auf der Fähigkeit zur »menschlichen Intimität«. Sr. Sandra Schneiders wagt sogar die Bemerkung: Wer niemals die erotische Liebe erlebt hat, »wer nie mit den echten, wahren, menschlichen, sexuell lebendigen und lebendig machenden Gefühlen einen realen, konkreten, einzigartigen Menschen geliebt hat und von ihm geliebt worden ist, kann zwar endlos über die Schönheit und Freude göttlicher Liebe reden, wird jedoch auf jemanden, der Agonie und Ekstase der Liebe in der Realität erlebt hat, nicht sehr überzeugend wirken«.26
Viele erfahrene Seelsorgerinnen und Seelsorger werden hier zustimmen: Wer sich nie einem anderen Menschen in personaler Liebe geöffnet hat und wer nie ein positives, ein beglückendes, ein unvergessliches sexuelles Erlebnis (oder eine tiefe Erfahrung von seelischer Intimität und zärtlicher Körpernähe) hatte, kann natürlich trotzdem ein sehr guter Mensch sein. Aber als Verkünder der göttlichen Liebe, als ›mystagogischer‹ Wegbegleiter, als Zeuge für die Geheimnisse Gottes wird er den Großteil der Menschen nicht erreichen.
Auch wenn wir das sexuelle Leben verdrängen oder sublimieren, wirklich ausblenden und ›wegstecken‹ lässt sich die Sexualität niemals. Sie würde sich auf Umwegen zurückmelden, vielleicht in problematischen Formen, in unreifer Manier. In schlimmeren Fällen könnte die unterdrückte, die nicht ins Leben integrierte Sexualität auch zu infantilen, zu krankhaften, zu sozial nicht verträglichen Verhaltensweisen mutieren. Was aber andererseits noch lange nicht heißen soll, dass es geglückte Formen der ›sublimierten‹ Sexualität überhaupt nicht geben könne. Zweifellos gibt es kulturelle Hochleistungen, vorbildliches soziales Engagement, echte Hingabe und spirituelle Glaubwürdigkeit in Verbindung mit einem zölibatären Charisma (das nicht zu verwechseln ist mit dem umstrittenen Zölibats-Gesetz in der heutigen katholischen Kirche).27
Immer aber bleibt die Sexualität eine wichtige Kraft von elementarer Bedeutung. Da auch in den folgenden Buchkapiteln das Thema ›Sexualität‹ zumindest indirekt präsent ist, sei schon im vorhinein klargestellt: Ob ich verheiratet bin oder nicht, ob ich in einer Paarbeziehung lebe oder nicht, in jedem Fall erlebe ich mich als sexuelles, nach leiblicher Nähe und intimer Berührung verlangendes Wesen. Und ob ich es mir eingestehe oder nicht, immer ist die Sexualität eine spirituelle Herausforderung, eine machtvolle Wirklichkeit, die verantwortlich gestaltet sein will – nicht bloß im ›Gehorsam‹ gegenüber den kirchlichen Institutionen, sondern in freier Entscheidung aufgrund des personalen Gewissens.
8. Zu den Maßstäben und Werten
Ganz auf der Linie des reformwilligen – von vielen kirchlichen Amtsträgern inzwischen vergessenen oder im restaurativen Sinne ›uminterpretierten‹ – Zweiten Vatikanischen Konzils28 bekräftigt die katholische Theologin Lydia Bendel-Maidl die Mündigkeit der individuellen Person. Aufgrund seines Gewissens nämlich und aufgrund seiner unmittelbaren Beziehung zu Gott hat jeder Einzelne »teil an einer letzten Verbindlichkeit und Würde«, die von der Kirche unbedingt »zu achten ist (…), selbst im Fall des Irrtums«.29
Das eigene Gewissen also ist die höchste Instanz, der Maßstab meines Verhaltens. Allerdings ist das Gewissen nicht bloß ein vages Gefühl. Vielmehr bedarf das Gewissen der ›Schulung‹, der stetigen Justierung mit Herz und Verstand. Anders gesagt: Die subjektive Gewissensbildung muss sich an bestimmten, überprüfbaren, Kriterien orientieren.
Sinnvoll und absolut angebracht ist somit die Frage: Welche Voraussetzungen müssen in einer guten, in einer ethisch verantworteten Partnerbeziehung erfüllt sein? Ein mit mir befreundeter Jesuitentheologe und Priesterseelsorger gab mir vor Jahrzehnten die folgenden Beurteilungshilfen: Eine intime Beziehung ist gut, wenn sie auf wechselseitiger Liebe beruht, wenn sie für beide Partner eine Glücksquelle ist, wenn sie keinem anderen schadet und wenn die Gottesbeziehung darunter nicht leidet, sondern eher gestärkt wird.
Diese vier Kriterien, die stets neu zu überdenken sind, nehme ich als Seelsorger und geistlicher Begleiter sehr ernst. Ich habe sie mir verinnerlicht und um einen weiteren Punkt noch ergänzt: Eine Paarbeziehung – oder auch eine Seelenfreundschaft30 – finde ich besonders gut, wenn die Hoffnung auf das ewige Leben, wenn die Vorfreude auf den Himmel durch die liebevolle Beziehung der Partner noch vergrößert und neu beflügelt wird.