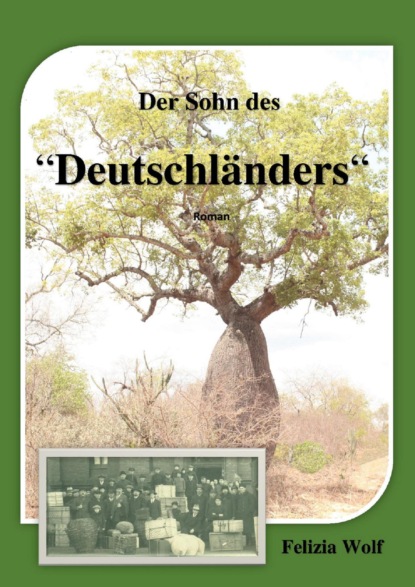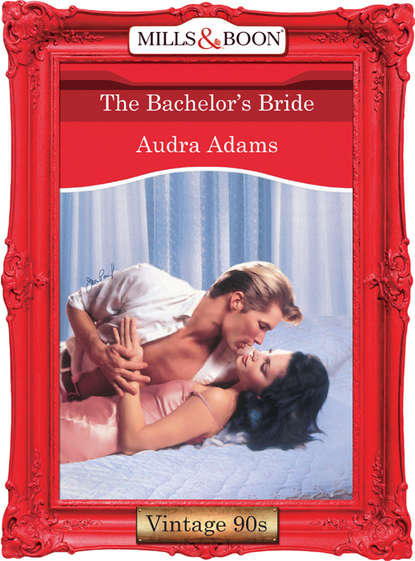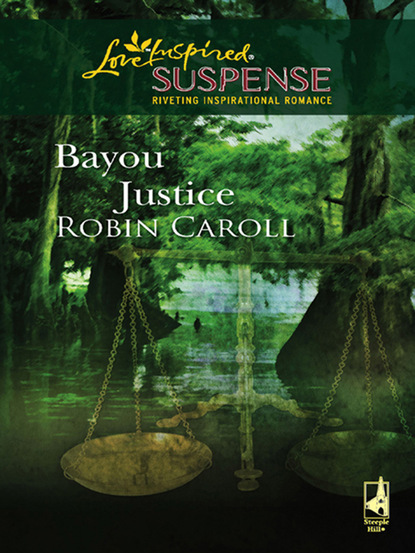- -
- 100%
- +
Es kam ihr nicht in den Sinn, dass es Männer geben könnte, die sich von einer Frau etwas anderes wünschen, als ein wenig Koketterie, Erotik und blanken Sex.
Hiermit gelange ich an den Punkt, wo ich versuchen will, Luisas Einstellung zu Männern begreifbar zu machen.
Vorweg sei erwähnt, dass das Leben in der ländlichen Gegend, der „Campaña“, wo Luisa ihre Kindheit und Jugend verbracht hatte, kaum etwas mit der Lebensweise in der Hauptstadt gemeinsam hatte. Dort im Landesinneren schien die Zeit still zu stehen. Was heute nicht erledigt werden konnte, wurde mit einem Achselzucken auf morgen verschoben. „Mañana“, morgen, ist wohl deshalb noch heute eine äuβerst wichtige Vokabel im Wortschatz der Leute vom Land. Es ist aber, meiner Meinung nach, falsch, diese Einstellung bei allen mit Trägheit gleichzusetzen. Schicksalsergebene Gelassenheit trifft wohl eher den Sinn des Wortes.
Auch hatten sich die Lebensgewohnheiten über Jahrzehnte hinweg kaum verändert. Die Schulbildung der Landbevölkerung war, wenn sie denn überhaupt stattfand, meist abgeschlossen, sobald ein Kind leidlich lesen und schreiben, Zahlen zu addieren und subtrahieren verstand und sämtliche Helden der paraguayischen Geschichte aufzählen konnte.
Ebenso erstarrt schienen die Familienstrukturen, insbesondere das Verhalten der Männer. In der Welt, in der Luisa aufgewachsen war, gab es Frauen, Kinder und Machos. Der Ausdruck Macho ist hier in all seiner Härte und Klischeehaftigkeit zu verstehen.
Für die Frauen in ihrem Umfeld hatte stets gegolten: setzte deine weiblichen Reize ein, dann schaffst du es vielleicht, wenigstens zeitweise von einem Mann versorgt zu werden! Danach sollten genügend Kinder da sein, die für dich sorgen können. Die eheliche, lebenslange Bindung zweier Menschen wurde zwar als hehres Ziel angestrebt und manchmal vorgetäuscht, jedoch sei jede Frau, die darauf baue, ihr Leben lang für ein und denselben Mann an erster Stelle zu stehen, letzten Endes eine arme Verliererin. Natürlich war Luisas Vater bis zu seinem Tod immer wieder bei seiner Frau und Familie gewesen, jedoch war sich Luisas Mutter durchaus bewusst, dass sie zwar seine rechtmäβige Gattin, keineswegs aber seine einzige Frau war. Genauso wenig wie ihre Kinder seine einzigen Nachkommen waren.
Wie jedes Kind von einfachen Landarbeitern hatte Luisa es für eine Selbstverständlichkeit gehalten, dass die Familie sich um die Mutter anordnet. Sie führte den Haushalt an. Der Vater war manchmal da, galt zu diesen Zeiten auch unangefochten als „Hahn im Korb“, von der Frau hofiert, von den Kindern bedient, jedoch machte er, solange er jung und kräftig war, keinen Hehl daraus, dass ihm auch andere Körbe offen standen. Eine Frau wie Luisa hatte sich schon als Kind damit abzufinden, dass sie eben „nur“ als Frau auf die Welt gekommen war. Jedoch konnte sie sich glücklich schätzen, dass sie sehr hübsch war. Eine Tatsache, die als „himmlische Mitgift“ gesehen wurde und im Idealfall ihre Zukunft sichern konnte.
Diese sozialen Strukturen hatte Luisa als Kind natürlich nicht durchschaut. Sie war ein fröhliches Kind gewesen, ging am Morgen fast immer gut gelaunt in die Schule und kehrte am Mittag meist singend oder im Rudel gleichaltriger Kinder herumalbernd wieder nach Hause in das windschiefe Häuschen, das Ranchito zurück. Dieses Ranchito war nicht mehr als eine Hütte aus dicht nebeneinander gesetzten Palmenstämmen. Das Dach bestand aus Stroh und bei Regen tropfte es fast immer irgendwo herein. Bei trockenem, warmem Wetter spielte sich das gesamte Leben drauβen ab: Über einer Feuerstelle hing ein schwerer Kochtopf aus Gusseisen, unter den Bäumen stand der Esstisch mit einigen Stühlen und am nicht weit entfernten Bach wurde die Wäsche gewaschen sowie das Geschirr gespült. Nachdem die Familie immer weiter angewachsen war, wurde eine zweite, recht kleine Hütte für Luisa und ihre Schwester gebaut.
Hausaufgaben für die Schule musste Luisa eigentlich nie machen, denn die Lehrer wussten, dass es in den meisten Familien keinen Platz dafür gab. Sie hütete am Nachmittag fast immer die kleinen Geschwister, während die Mutter beim Wäschewaschen war oder das Abendessen kochte. Manchmal musste sie auch bei der Arbeit auf dem Maniok-Feld mithelfen.
Ihre Welt war in heiler Ordnung. Selbst die immer wiederkehrenden, lautstarken Streitereien der Eltern hatten irgendwann ihre Bedrohlichkeit für das Mädchen verloren, auch wenn der Vater nach solchen Kämpfen oft für eine Zeitlang verschwand. Früher oder später kehrte er ja doch immer zu ihnen zurück. Manchmal war er nach seiner Heimkehr ins heimische Nest überaus freundlich und brachte Geschenke für Luisa und ihre Geschwister mit, manchmal kam er aber auch abgemagert, schlecht gelaunt und wortkarg nach Hause.
Luisa war gerade zwölf Jahre alt und ihre sprieβende Weiblichkeit lieβ schon erahnen, dass sie versprach, eine Schönheit zu werden. Noch vor ihrer ersten Menstruation wurde sie zum ersten Mal vergewaltigt. Was ich über diese Geschichte weiβ, hatte Luisa ihrer Tochter Maria Celeste erzählt, dabei aber nie das Wort Vergewaltigung in den Mund genommen. Und Maria Celeste hat viele Jahre später mit Arthur über das gesprochen, was sie von ihrer Mutter gehört hatte.
Arthur und ich haben oft über die eigentümliche Gesellschaftsform des Landes diskutiert. Einerseits erkennt man deutlich matriarchalische Strukturen in den Familien, andererseits ist die machohafte Haltung der meisten Männer nicht von der Hand zu weisen. Ein scheinbarer Widerspruch, der wohl auf die Folgen des verheerenden Krieges im vorigen Jahrhundert zurückgeführt werden muss.
Im Jahr 1870 war die paraguayische Bevölkerung durch den Krieg gegen Brasilien, Argentinien und Uruguay beinahe vollständig ausgelöscht worden. Der paraguayische Machthaber Franzisco Solano Lopez wollte die Grenzen seines Landes neu festlegen. Von den eine Million dreihunderttausend Einwohnern waren nach diesem wahnsinnigen Gemetzel noch ganze Zweihunderttausend Menschen am Leben. Lächerliche zehn Prozent davon waren Männer. Das heißt zwanzigtausend Männer! Knaben, Greise und Krüppel eingeschlossen! Das muss man sich einmal vorstellen: ein Land praktisch ohne Männer.
Da verwundert es kaum noch, dass sich die Männer Paraguays daran gewöhnten, allseits begehrte Erzeuger zu sein. Die Frauen hatten den häuslichen Alltag sowie die Nahrungsmittelbeschaffung allein zu bewältigen und sich auch um das möglichst schnelle Anwachsen der Familie zu kümmern. Glücklich die, die viele männliche Nachkommen in die Welt setzte. Wer wollte da einem Mann noch verbieten, diese oder jene Frau zu schwängern! Welchem Mann wollte man da die freie Auswahl nicht gestatten! Freie Fahrt zu jeder Zeit! Frauen, rollt eure roten Teppiche aus, sobald sich ein potentieller und potenter Kindererzeuger nähert! Und bitteschön, verbietet ihnen auch eure Töchter nicht!
Diese Einstellung hatte sich in den Köpfen der Männer – aber leider oft auch der Frauen – verfestigt. Zu der Zeit, als Arthur und sein Vater ins Land kamen, regierte der deutschstämmige General Alfredo Stroessner das Land. Und auch er, als allseits respektiertes Vorbild für die kleinen Leute war es gewohnt, unter den Frauen seines Landes willkürlich auszuwählen, was ihm gerade gefiel. Es heiβt, er habe eine seiner Geliebten rein zufällig zum ersten Mal gesehen, als das knapp fünfzehnjährige Mädchen gerade aus der Schule kam. Vom Fenster seiner Staatskarosse aus hatte der nicht mehr ganz junge Mann das fröhliche Mädchen beobachtet. Die hübsche Señorita hatte dem General und Diktator gefallen, also lieβ er ihrer Familie die Botschaft zukommen, dass er bereit sei, sich um sie zu „kümmern“. Angeblich erhoben weder das Mädchen selbst, noch ihre Familie Einwände dagegen. So wurde ihm die Zweitfrau gewissermaβen, mit dem Einverständnis aller ihrer Familienmitglieder, auf einem Silbertablett serviert. Was konnte einem Mädchen ihres Standes schon Besseres passieren!
In Luisas Familie hingegen hatte niemand mitbekommen, was dem Mädchen geschehen war. Und Luisa hatte ihren „Onkel“ nie für sein Verbrechen verantwortlich gemacht.
Während der traditionellen Feier zum ersten Geburtstag ihres kleinen Bruders war es nicht weiter aufgefallen, dass der Compadre Luís, bester Freund ihres Vaters (und ihr Taufpate!), immer wieder versucht hatte, in der Nähe der damals Zwölfjährigen zu bleiben. Während man gemeinsam in groβer Runde um das Lagerfeuer herum saβ, aβ und trank, fröhliche Volkslieder zu Gitarrenmusik sang, gelegentlich auch tanzte, achtete niemand auf Luís, der sein Patenkind immer wieder seine bildschöne Königin nannte, sie ungefragt packte und auf sein Knie setzte und dabei lüstern ansah und betatschte. Niemanden hatten seine pausenlosen, schlüpfrigen Komplimente für „die bezaubernde Tochter des Hauses“ gestört und niemandem war aufgefallen, wie peinlich Luisa sein Gehabe war. Allerdings hatte sie sich eingestehen müssen, dass sie sich auch ein ganz kleines Bisschen geschmeichelt fühlte.
Die Schwester, die sonst mit Luisa zusammen in der kleineren Palmenhütte schlief, war während des Festes auf einem weichen Schaffell unter dem Vordach der groβen Hütte eingeschlafen. Luisa hatte sich kurz vor Mitternacht müde zurückgezogen, die Erwachsenen feierten noch bis spät in die Nacht bei Gitarrenmusik und johlendem Gesang. Klarer Schnaps sorgte für Stimmung und zum Teil auch für Übelkeit. Natürlich hatte Luisas Mutter für alle Gäste, die einen weiten Heimweg hatten, ein Nachtlager hergerichtet. Auch für den Freund der Familie, Compadre Luís. Dieser hatte jedoch darauf bestanden, in seiner mitgebrachten Hängematte zu schlafen, die er, nachdem sich die letzten Gäste verabschiedet hatten, direkt vor Luisas Palmenhütte aufspannte. Eine ältere Freundin der Mutter hatte sich, fast bis zur Besinnungslosigkeit betrunken, direkt neben Luisas Bett auf den Fuβboden gelegt. Lediglich eine Decke aus Schafwolle diente ihr als Unterlage.
Luisa wurde wach, als von drauβen kein Festlärm mehr zu ihr ins Zimmer drang. Nur das Schnarchen der Frau neben ihrem Bett war zu hören, da bemerkte sie, dass sich die leise quietschende Tür ihrer Kammer öffnete. Onkel Luís stand einen Moment leicht schwankend im Raum und blickte sich suchend um. Nachdem sich seine Augen an die Dunkelheit in der Hütte gewöhnt hatten, machte er einen weiten Schritt über die Gestalt am Boden und kroch zu Luisa ins Bett. Das Mädchen hielt erschrocken den Atem an, unfähig etwas zu sagen oder gar zu schreien. Das mit Lederriemen bespannte Holzgestell ihres Bettes knarrte laut, als er sich neben sie legte. Augenblicklich drehte sich Luisa zur Wand, ihr Herz klopfte immer schneller, und, wie es ihr schien, immer lauter und lauter. Luís umfasste sie von hinten mit einem gedämpften und langgezogenen Seufzer. Der Körper der schmächtigen Luisa wurde ganz steif, aber er zog sie näher zu sich heran und flüsterte ihr ins Ohr, dass sie die Schönste auf dem Fest gewesen sei, dass sie schon wie eine richtige Señorita aussehe, dass er den ganzen Abend nur darauf gewartet habe, bis er endlich eine Gelegenheit dazu haben würde, diese Schönheit zu fragen, ob sie nicht die Seine werden wolle, schlieβlich sei er ihr Taufpate und Namensgeber und seit ewigen Zeiten Freund der Familie.
Während er leise auf Luisa einredete, hatte er mit seinen schweiβnassen Händen ihr Nachthemdchen nach oben geschoben und streichelte ihr mit sanften Berührungen den Bauch und den Rücken. Sie wollte seinen Händen ausweichen, indem sie sich weiter in die Ecke verkroch, da küsste er ihr, ständig weiter auf sie einredend, den Hals und den Nacken. Obwohl alles in ihr „nein“ schrie, war sie vor Angst wie versteinert, unfähig etwas zu tun oder um Hilfe zu rufen, zumal ihr seine überaus zarten Liebkosungen und sein heiβer Atem in ihrem Nacken eine unbekannte, trotz aller ablehnenden Gefühle, wohlige Gänsehaut über den Rücken rieseln lieβen. Für einen Moment wünschte sie sich, dass er nie aufhören würde, sie zu streicheln. Wenn nur dieses gierige Küssen nicht gewesen wäre! Er redete heiser flüsternd weiter, verglich sie mit einer Knospe, die in Begriff sei, ihre prächtige Schönheit zu entfalten, bat sie mit salbungsvoller, scheinbarer Hingabe darum, der Gärtner sein zu dürfen, der dieser Knospe zur Blüte verhelfen dürfte.
Natürlich hatte Luisa längst eine verschwommene Ahnung von dem Geheimnis, das Frauen und Männer miteinander erleben. Ihr war es ebenfalls längst bekannt, dass es das Gefühl von Verliebtheit gab, aber dieser Mann war etwa dreiβig Jahre älter als sie selbst, hatte Frau und Kinder in ihrem Alter, mit denen er viele Kilometer weit von hier als Peón auf einer groβen Estancia lebte und arbeitete. Auβerdem hatte sie bei Tieren gesehen und von Freundinnen gehört, dass sich die geschlechtliche Liebe in jenem verborgenen Winkel des Körpers abspielte. Sie wusste nicht genau wie, und was dabei geschah. Aber sie wollte es auch gar nicht näher wissen! Sie wollte es noch nicht wissen!
Anfangs hatte sie sich nicht dagegen wehren können, seine Zärtlichkeiten trotz ihrer Angst und der Ablehnung auch als angenehm zu empfinden. Aber dieses Streicheln war jetzt kein Streicheln mehr, wie sie es sich wünschte. Sein Atem wurde flach und stoβartig und seine Liebkosungen gingen unaufhaltsam weiter, ebenso seine erhebenden Reden, die ihr das Gefühl geben sollten, ein Geschöpf von überirdischer Schönheit zu sein. Und er lieβ sich Zeit, streichelte sanft ihren Nacken, ihre Schultern, ihren schmalen Rücken. „Du liebst doch deinen Tío Luís, meine kleine Blume, nicht wahr?“, fragte er sie flüsternd. Alles in ihr schrie: Ja, ich liebe meinen Onkel. Aber nicht so! Die Angst und ahnungsvolles Grauen schnürten diese Antwort jedoch ab. Für einen kurzen Moment gaben ihre Glieder scheinbar willenlos nach, als er sie an den Schultern packte und langsam auf den Rücken rollte und ihren Bauch mit seinen gierigen Küssen bedeckte. Panik und abgrundtiefer Widerwillen durchzogen ihren zierlichen Körper jetzt bei jeder Berührung. Ekel und stummes, grenzenloses Entsetzen schnürten ihr förmlich die Luft ab, als seine Hand fest zwischen ihre Beine glitt und diese brutal auseinanderdrückte.
Panische Angst, Angst, Angst!
Unendliche Scham und Hilflosigkeit unter seinen hart gewordenen Griffen veranlassten sie, nicht zu rufen, sondern die nächsten schmerzhaften, zutiefst demütigenden Minuten still auszuhalten.
Aushalten. Aushalten. Aushalten.
Nur Aushalten...
Vorbei.
Die Frau am Boden soll im Schlaf geseufzt und sich schwerfällig umgedreht haben, als das Stöhnen des Mannes immer lauter wurde. Sie war aber nicht aufgewacht.
Onkel Luís hatte sich danach schnell wieder in seine Hängematte zurückgezogen. Luisa lag bis zum Morgen weinend im Bett. Sie hatte am Morgen nicht den Mut, ihrer Mutter gleich alles zu erzählen und als es Luís im Laufe des Vormittags gelang, unbeobachtet an sie heranzutreten, sagte er ihr grinsend, sie solle lieber den Eltern nichts verraten, denn ihr Vater wäre vielleicht enttäuscht, weil er ja seine Tochter nun nicht mehr als Jungfrau verheiraten könnte. Abgesehen davon, fügte er mit raunender Stimme und wiederum gierigen Blicken hinzu, würde er keine Minute zögern, eine wunderschöne Frau wie sie zu heiraten, wenn er nur könnte. Und er sei ganz sicher, dass auch sie die Nacht genossen habe. Denn ansonsten hätte sie ihn ja weggeschickt, nicht? Dass es am Ende mit Schmerzen verbunden gewesen war, sei schlieβlich beim ersten Mal völlig normal.
So blieb Luisa nur das Gefühl, an dieser demütigenden Erfahrung auch noch selbst schuld zu sein.
Arthur hat mir all das, was er von Luisa und dieser Geschichte weiβ, mit wütendem Schweiβ auf der Stirn erzählt und dabei immer wieder über Männer geflucht, ohne eine Verallgemeinerung zu vermeiden.
„Und es gibt immer wieder solche Schweine, die sich über hilflose kleine Mädchen hermachen!“
„Und es hat sie immer gegeben“, antworte ich.
„Oh nein!“, ruft Arthur auβer sich. „Jetzt komm mir bloβ nicht mit solchem Geschwätz: hat es immer gegeben und wird es immer geben! Verdammt! Das ist eine krankhafte, niederträchtige...“
„Ja, ja, ich weiβ! Und ich will auch nicht sagen, dass es verzeihlich ist, ein Kind zu missbrauchen. Du sagst krankhaft, genau! Eine krankhafte Erscheinung, die es in fast jeder Zivilisation gibt und schon immer gegeben hat. Was mich nur wundert, ist, dass auch Völker wie die Mestizen in Südamerika, die man doch so gern als naturnah und naturverbunden hinstellt, von dieser Krankheit genauso betroffen sind wie die ‚hochzivilisierten’ Volksgruppen, beispielsweise in Europa.“
„Naturverbunden! Was heiβt das schon! Sie haben hier...“
„Eben! Sie haben hier wie überall solche unnormalen, psychisch kranken Mannsbilder, die ihre Machtgelüste an Kindern auslassen. Egal, ob Weiβe, Mestizen oder Indianer. Es gibt eben keine von Natur aus ‚edlen Wilden’!“
„Edle Wilde! Idiotische und romantische Schönmalerei der wilden Unzivilisation!“, meint Arthur.
Angesichts dieser längst vergangenen Ereignisse mag es vielleicht nicht mehr verwundern, dass sich Luisa jetzt, nach Abfahrt der Deisenhofers, nur fragte, warum sie wohl für Arthurs Vater nicht attraktiv genug gewesen war. Irgendetwas an ihr musste ihn abgestoβen haben, denn der Mann hatte nichts unternommen, sie zu „nehmen“. Sie holte einen Besen und fing an, die kleinen Sanddünen, die der Wind auf dem Gehweg vor dem Tor zusammengeweht hatte, auf die Straβe zu kehren.
Kapitel VI.
Kapitel 6
Über seine Erlebnisse in und um Independencia muss Arthurs Vater seinem Sohn viel erzählt haben. Er war hingerissen von der wilden Natur, die er dort kennen lernen sollte. Zwar war er auch in der Umgebung der Hauptstadt des Öfteren über die Pflanzenwelt ins Staunen geraten, jedoch hatte er auf seinen Erkundungsgängen nie wirklich Augen für die Umgebung, und schon gar nicht für landschaftliche Besonderheiten gehabt. Bisher war irgendwie alles von der Ungewissheit über die Zukunft überschattet gewesen.
Ganz anders konnte er sich jetzt, auf der Fahrt nach Independencia, dem Gefühl von fast ehrfürchtiger Bewunderung hingeben. Die wilde Schönheit der Natur übertraf selbst die Erinnerungen an die Flussfahrt vor drei Wochen. Fast auf der gesamten Strecke säumten tropische Bäume und Palmen die schwarzen oder ziegelroten Erdstraβen. Ein fast undurchdringliches, blütendurchsetztes Gewirr von Schlingpflanzen lag über dem ganzen Wald wie ein von riesigen Spinnen gewebtes Netz. Zwischendurch gab die hügelige Landschaft immer wieder den Blick frei auf kilometerweite Täler, wo man zwischen mannshohen Termitenhügeln groβe Herden grasender Zebu-Rinder erkennen konnte. Der Ausblick auf die scheinbar unendlichen Weiten ließ ihn tief Luft holen und endlich so etwas wie Zuversicht und sogar Freude auf alles Bevorstehende aufkommen.
In Independencia ging meist ein leiser, erfrischender Wind über die offenen Flächen an den Weinbergen, die sich Arthurs Vater bei seinem ersten Besuch in der deutschen Kolonie mit wachsender Begeisterung anschaute. Diese geordnet angelegten Pflanzungen hoben sich krass von dem wilden Landschaftsbild der Umgebung ab. Deisenhofer fuhr seinen Gast nicht ohne Stolz durch die Siedlung, redete dabei immer wieder von den verschiedenen Möglichkeiten sich in der Gegend selbstständig zu machen. Er zeigte Arthurs Vater zahlreiche Alternativen zu seinem ursprünglichen Vorhaben auf, die, seiner Meinung nach, bei Weitem lukrativer wären als der Verkauf von Tierhäuten. Arthurs Vater hörte Deisenhofer aufmerksam zu und die Vorstellung, sich hier in Independencia so bald wie möglich endgültig niederzulassen, setzte sich immer tiefer in seinem Kopf fest. Den klangvollen Namen des Ortes, Independencia, wertete er dabei als gutes Omen.
Die Häuser in dieser Siedlung waren nach deutschem Vorbild konstruiert, jedoch waren die Fenster deutlich gröβer, um den erfrischenden Wind hereinzulassen. Und die Dächer hörten nicht abrupt an den Auβenmauern auf, sondern reichten etwa einen bis anderthalb Meter weit hinaus, um die heiβen Sonnenstrahlen von der Hauswand abzuhalten.
Arthurs Vater musste das Bild, das er sich von Independencia gemacht hatte, vollkommen korrigieren. In seiner Vorstellung war der Ort so etwas wie ein Dorf oder eine Kleinstadt gewesen. Jetzt stellte er jedoch fest, dass so etwas wie ein Ortskern gar nicht zu erkennen war. Es gab lediglich einen kleinen Laden in Form eines schlichten, rechteckigen Gebäudes aus Holz mit einer Veranda, zu der drei ausgetretene, knarrende Treppenstufen hinaufführten. Etwas weiter auf derselben Straβe fand man die Dorfschenke, ein ebenfalls schmuckloser, rechteckiger Kasten aus Holz, wo man sich am Abend oder sonntags nach dem Gottesdienst zum Frühschoppen traf. Die einzelnen Wohnhäuser lagen weit verstreut im Umkreis mehrerer Kilometer, fast immer mitten im Wald.
Die sonntäglichen Gottesdienste in Independencia waren ein unausgesprochenes Muss für jeden Anwohner. Zwar ging es dabei nicht so sehr um die religiösen Inhalte der Predigten, sondern in erster Linie darum, Gemeinschaft zu pflegen. Dazu gehörten Klatsch und Tratsch ebenso wie geselliges Beisammensein in fröhlicher Runde beim Frühschoppen, woran sich „Evangelische“ genauso beteiligten wie „Katholische“.
Die Deisenhofers waren evangelisch und gehörten somit zur Minderheit von Independencia. Es gab wohl Leute, die meinten, die Katholiken der Siedlung seien durchweg besser betucht und von höherem Status, jedoch hat Julius Deisenhofer darüber nur den Kopf geschüttelt.
Während der nächsten Tage, die Arthurs Vater in Independencia verbrachte und auch bei dem feierlichen Frühschoppen nach deutscher Tradition erkannte er, dass es eine wichtige Gemeinsamkeit gab, die die Leute miteinander verband: Die deutsche Denkart. Was diese Denkart wirklich ausmachte, hätte er nicht ohne lange zu überlegen sagen können, aber irgendetwas schien alle hier in der Fremde zu verbinden, was nicht allein in der Sprache liegen konnte. Und obwohl die wenigsten je Sehnsucht nach der Heimat äuβerten, schienen genau die typisch deutschen Eigenarten das Band zu sein, das verhinderte, dass sich die Gruppe auflöste. Und schon kurze Zeit nachdem Arthurs Vater zum ersten Mal mit Christa und Julius Deisenhofer in der Dorfschenke gewesen war, hatte er das Gefühl, von allen wie ein alter Bekannter behandelt zu werden. Gastfreundschaft war hier wie in Asunción eine Selbstverständlichkeit.
Wenn sie zu dritt von ihren Ausflügen in der Umgebung zu den Deisenhofers nach Hause zurückkehrten und sich am Abend bei einer Flasche Wein auf die Veranda setzten, erzählte Deisenhofer meist von der Geschichte der Kolonie, von den Anfängen seiner Eltern als Pioniere in dieser Wildnis und den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, die das Land bot.
„Man kann hier so viel auf die Beine stellen, mein lieber Freund“, sagte er immer wieder. Auf vorsichtiges Drängen von Arthurs Vater, die Möglichkeiten der Pelztierjagd etwas konkreter in Betracht zu ziehen, reagierte er zwar durchaus erfreut, allerdings nie mit handfesten Vorschlägen. Für Deisenhofer schien es gemachte Sache zu sein, dass Arthurs Vater mit Begeisterung in seine eigenen Geschäfte miteinsteigen würde.
Von geschäftlichen Fragen abgesehen war es Arthurs Vater irgendwann am Abend gelungen, das Gespräch auf Luisa und Justina im Deisenhofer’schen Stadthaus in Asunción zu lenken. Zu oft kreisten seine Gedanken um die beiden Frauen im Hinterhaus. Es musste eine Erklärung dafür geben, dass eine Frau wie Luisa mit gleich drei Kindern in Deisenhofers Stadtwohnung praktisch schalten und walten konnte wie es ihr behagte.
Was er von Deisenhofer über Luisas Geschichte erfuhr, verschlug ihm die Sprache. Dabei hatte Deisenhofer noch nicht einmal von ihren grausamen Kindheitserlebnissen gesprochen.
„Das schöne Kind ist schon als Siebzehnjährige zu uns in mein Elternhaus gekommen“, fing Deisenhofer zu erzählen an. „Franzisco, ihr Vater, hatte schon viele Jahre vorher bei meinen Eltern als Feldarbeiter mitgeholfen. Verstehst du, mein Freund, er kam immer dann, wenn sein Geldbeutel leer war und hat die Felder sauber gehalten, bei der Weinlese mitgeholfen und so weiter. Mein alter Herr hat Franzisco immer wieder Arbeit gegeben, weil ein zäher Bursche war und eine angefangene Arbeit nie abgebrochen hat.“
„Und seine Familie? Haben sie hier gewohnt?“, wollte Arthurs Vater wissen.