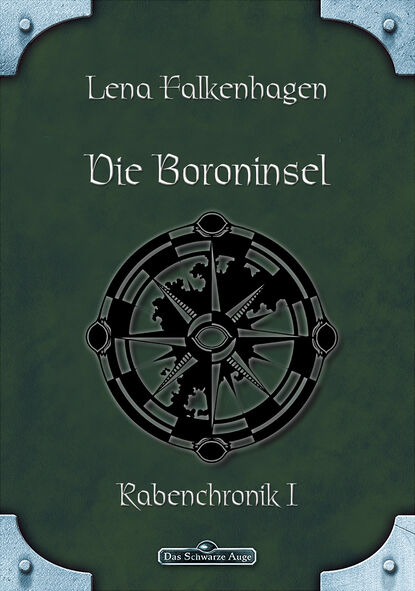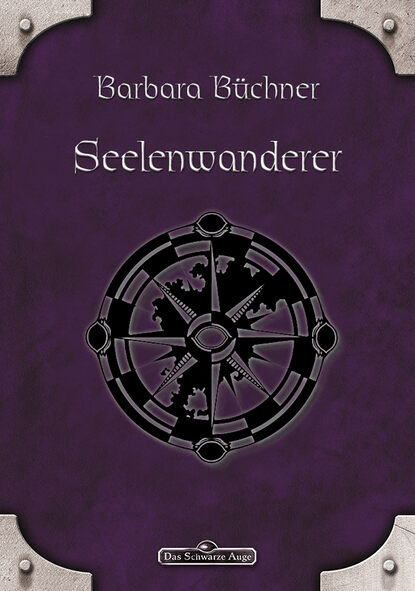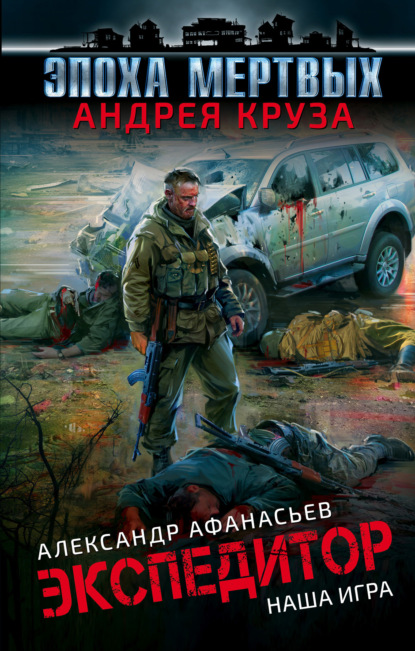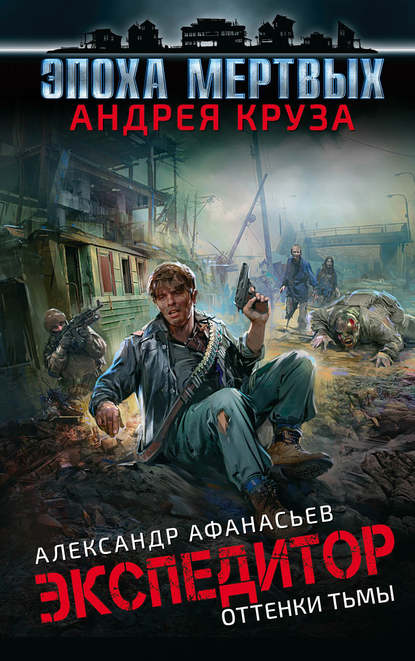DSA: Rabenbund

- -
- 100%
- +
Shantalla haschte nach einem Ast mit weißen Blüten, der tief genug hing, dass sie ihn erreichen konnte. »Den habe ich«, bestätigte sie lächelnd. »Sind Arangen nicht außergewöhnliche Pflanzen?«, fragte sie und schloss die Augen, während sie den Duft der Blüten in sich aufsog. »Ich habe bereits darüber nachgedacht, ob es nicht passend wäre, einen Hain auf dem Silberberg anlegen zu lassen. Es wäre entzückend, morgens mit ihrem Duft in der Nase zu erwachen. Ganz abgesehen davon, dass sie eine wunderbare Symbolkraft haben. Wusstet Ihr, dass sie wohl die einzigen Bäume sind, die Blüten und Früchte zugleich tragen?«
»Interessant.« Gilia war neben ihr stehen geblieben. »Eure Verwandtschaft wäre sicher begeistert, wenn Heerscharen von Erntesklaven über Eure Terrasse marschierten. Aber Ihr habt mich sicher nicht hergebeten, um über die Gestaltung Eures Anwesens zu sprechen.«
»Wie Ihr wisst, schätze ich Euren Rat, liebste Gilia. Doch Ihr habt recht, vertun wir keine Zeit. Schließlich naht ein Krieg.« Shantalla entließ den Ast, der sacht nach oben fuhr und dabei eine Handvoll Blütenblätter niederregnen ließ. »Wisst Ihr, es ist falsch zu glauben, dass wir immer nur diese eine, ausschließliche Entscheidung treffen müssen und Fronten verteidigen, die wir für unumstößlich halten. Manchmal eröffnen uns die Götter verschiedene Wege, und erlauben es uns, großmütig zu sein, anstatt den Gegner zu zerquetschen, nur weil Phex uns gerade ein gutes Blatt in die Hand gespielt hat.«
»Ihr versteht es, für alles schöne Worte zu finden. Was Ihr großzügig nennt, würden andere als Abhängigkeit bezeichnen. Was vermutlich ein sehr viel ehrlicherer Ausdruck wäre.«
»Ach was.« Shantalla winkte ab und setzte an, dem Weg weiter zu folgen. Die Pfade zwischen den Arangenbäumen waren sorgsam geharkt und von Unrat befreit, sodass der schattige Hain tatsächlich mehr einem wohlgestalteten Garten glich als einer Plantage, die dazu diente, Handelsgüter zu erwirtschaften. Hier und da schimmerte die Feuchtigkeit des mittäglichen Regens auf dem Laub, sodass trotz der hochstehenden Sonne eine angenehme Frische zwischen den Bäumen lag. »Abhängigkeit würde bedeuten, dass man einen Gegengefallen einforderte, der von der anderen Seite nur widerwillig gewährt würde. Das wäre kein Großmut, sondern Berechnung. Die ist auf Dauer schrecklich langweilig und zudem vorhersehbar – und gebiert obendrein neue Feindschaften.«
»Worauf wollt Ihr hinaus, Shantalla?« Gilia war stehengeblieben. »Wenn Ihr mir etwas zu sagen habt, dann sagt es. Lasst mich raten: Es geht um diesen unseligen Vorfall bei Hochwürden Brotos Paligan?«
Shantalla versicherte sich mit einem kurzen Blick, dass die Sklaven weiterhin außer Hörweite geblieben waren. Die Schönheit des Arangenhains war ein Grund gewesen, warum sie Gilia hierherbestellt hatte. Der zweite war, dass sie hier reden konnten, ohne dass sie anschließend ihren Hausmagus bemühen musste, die Erinnerung ihrer Dienstboten zu tilgen. Abgesehen von den Kosten war sie sich nicht sicher, wie viel der alte Zausel selbst dabei erfuhr, und sie würde es hassen, eines Tages vor die Entscheidung gestellt zu sein, wie sie mit einem käuflichen Zauberer umgehen sollte, der so viele ihrer großen und kleinen Geheimnisse kannte.
»Ihr habt recht«, sagte sie, ohne sich umzudrehen. Gilia würde ihr folgen, schließlich war sie es, für die seit besagtem Treffen viel auf dem Spiel stand. »Es war ein unerfreulicher Abend mit ebenso unerfreulichen Überraschungen. Habt Ihr bereits etwas unternommen, um Euren verschwundenen Beschützer zu finden?«
»Natürlich. Er wird verschwinden, sobald man seiner habhaft geworden ist.«
»Wie unschön.« Shantalla verzog das Gesicht. »Und unnötig. Der arme Tropf hat wahrscheinlich nichts weiter getan als seine Pflicht. Glücklicherweise besteht kein Grund, ihm ein Leid zuzufügen. Er befindet sich in meiner Obhut.«
Gilia, die sich gerade wieder in Bewegung gesetzt hatte, hielt abrupt inne. »In Eurer Obhut?«, fragte sie scharf. »Der Spitzel war Euer Werk?«
»Boron behüte!« Shantalla drehte sich um und lächelte unschuldig. »Wo denkt Ihr hin, liebste Base? Ich glaube an die Ideen unseres hoffnungsvollen zukünftigen Patriarchen, und es läge mir fern, ihm und damit auch uns zu schaden. Ich habe den Mann suchen lassen, und ich war erfolgreich. In dem Zusammenhang ist mir noch eine weitere Sache in die Hände gefallen, die Ihr sicher bereits vermisst. Ein Schreiben aus der Stadt des Schweigens, eine äußerlich belanglose Botschaft bezüglich einer Frage um irgendwelche Lotuspflanzungen. Der Inhalt wird jedoch ungleich brisanter, wenn man sie zu lesen weiß. Ihr seid unvorsichtig, Gilia. Man vernichtet solche Schreiben, wenn man sie gelesen hat.« Ihr Lächeln vertiefte sich ein wenig, als sie den Kopf zur Seite legte und Gilias Miene studierte. »Ihr seid Euch sicher darüber im Klaren, dass die Aussage Eures Beschützers zusammen mit diesem Schreiben den Schwarzen General dazu veranlassen könnte, Euren Kopf noch heute auf die Zinnen des Silberbergs zu spießen?«
Gilia war blass geworden. Erschrecken, Unglaube und Zorn wechselte auf ihrem Gesicht einander ab, während sie Shantalla anstarrte.
»Ich weiß nicht, ob Euch bewusst ist, was Ihr da gerade sagt?«, stieß sie hervor. »Euer Kopf wird dem meinen Gesellschaft leisten, wenn Ihr das tut. Ihr seid ebenso verstrickt wie ich und all die anderen, und ich bezweifle, dass sich der Schwarze General von Euren schönen Worten einlullen lassen wird.«
»Ach Gilia. Ich sagte Euch bereits, dass ich an die Ideen eines Brotos Paligan glaube. Allerdings, und das ist der entscheidende Punkt, haben diese Ideen für mich nur eine Zukunft, wenn Ihr und Eure Tochter aufhört, mir einen Dolch an die Kehle zu halten. Ich will unserer gemeinsamen Sache nicht schaden und noch weniger will ich Euch wehtun, Gilia. Aber ich verlange, dass Ihr auf Eure Tochter einwirkt, von ihren albernen Machtkämpfen abzulassen. Wir sind keine Feinde, Gilia, aber wenn Ihr mich weiter bedrängt, sehe ich mich gezwungen, einen Schritt zu tun, der weder Euch noch mir gefällt.«
»Ihr glaubt tatsächlich, Euch herauswinden zu können! Das Schlimme ist, dass ich Euch sogar glaube, dass Ihr es könnt.« Gilias Unterlippe zuckte. »War das von vornherein Euer Plan? Habt Ihr Euch deshalb dem Rabenbund angeschlossen, um etwas gegen mich in der Hand zu haben? Ich hätte nicht gedacht, dass Ihr dafür bereit seid, einen göttlichen Eid zu brechen. Sonst hätte ich niemals zugelassen, Euch ins Vertrauen zu ziehen.«
»Ich will es nicht tun, Gilia.« Shantalla versuchte, ihren Blick zu fassen. »Boron sei mein Zeuge, dass mir nichts fernerläge, als einen Eid zu brechen, den ich in seinem Namen geschworen habe. Andernfalls würde ich nicht mit Euch sprechen, sondern hätte du Metuant an Eurer Stelle hierherbestellt.«
»Dann lasst meinen Beschützer gehen!«
»Das werde ich tun, sobald es möglich ist.« Shantalla lachte und machte einen Schritt auf sie zu. Das war der gefährlichste Teil ihres Plans, denn wenn Gilia sich störrisch zeigte, blieb ihr tatsächlich nichts anderes übrig, als die Verschwörung auffliegen zu lassen. Das wäre äußerst unschön, weil sie dann auf den Schwarzen General festgelegt war und womöglich Esmeraldo Paligan verlor, dessen Vorzüge sie gerade erst richtig kennenzulernen begann. »Wir müssen keine Feindinnen sein, Gilia«, sagte sie sanft. »Wir waren es nie. Im Gegenteil, gerade in diesen Zeiten sollten wir zusammenstehen, anstatt uns über Nichtigkeiten zu entzweien. Ihr wisst sicher, wer der Spitzel war, der uns in die Krypta gefolgt ist?«
Gilia runzelte die Stirn. Noch immer stand Misstrauen in ihren Augen, aber weniger eisig als zuvor. »Woher sollte ich das wissen? Die Beschützer sahen nur jemanden davonlaufen.«
»Alle bis auf die bedauernswerte Leibwächterin Don Esmeraldos. Die im Übrigen überlebt hat, wie ich mir habe sagen lassen. Und Euer Beschützer. Die Dreistigkeit des Eindringlings reicht zwar nicht an das heran, was er bei der Feier zum Tsatag Eurer Tochter getan hat, aber es offenbart seine Ziele, Euch zu vernichten.«
»Es war dieser elende Bastard?«
Shantalla nickte. »Die Brut unseres guten Aurelian lässt uns in der Tat keine Ruhe. Meine Leute konnten ihm zwar die Beute abjagen, aber bedauerlicherweise ist er entkommen. Es wäre jedoch wünschenswert, seiner habhaft zu werden, ehe er Gelegenheit findet, an ungünstiger Stelle weiterzugeben, was er gesehen und gehört hat. Lasst es uns gemeinsam tun, Gilia.« Sie streckte die Hand aus und ergriff die Finger der Bonareth. »Er bedroht nicht nur Euch, sondern auch mich. Und ich bin sicher, dass er erneut lästig wird, wenn wir es nicht verhindern.«
Einen kurzen Moment schien es, als wollte Gilia die Hand zurückziehen. Aber sie ließ die Berührung zu.
»Ich verstehe, was Ihr beabsichtigt«, sagte sie langsam, als denke sie noch über ihre Worte nach, während sie sie aussprach. »Ihr habt Angst vor diesem Bastard und braucht mich. Weil wir einen gemeinsamen Feind haben.«
»Der Bastard ist der Anlass, nicht der Grund.« Shantalla lachte leise, auf diese Art, die sie so perfektioniert hatte, dass es nicht einmal aufgesetzt klang. »Ein ärgerliches Übel, nicht mehr. Tatsächlich ist mir vor allem an einem guten Einvernehmen mit Euch gelegen. Wir leben in gefährlichen Zeiten, Gilia. Lasst mich Eure Freundin sein. Wie früher.«
Die Bonareth verzog die Lippen zu einem bemühten Schmunzeln. »Schöne Worte und ein Dolch, den Ihr mir an die Brust setzt. Ihr seid eine Harpyie, Shantalla. Wir waren nie Freundinnen und werden es sicher nie werden. Aber ihr habt recht, wir sollten diesen Bastard gemeinsam zur Strecke bringen. Eure Leute sind ihm auf der Spur?«
»Es ist schwer, seiner habhaft zu werden. Al’Anfa ist groß, und dass er in der Lage ist unterzutauchen, wissen wir ja nun aus leidvoller Erfahrung.«
»Ich werde sehen, was ich erreichen kann«, sagte Gilia steif. Sie wand ihre Hand aus Shantallas Griff und machte einen Schritt zurück. »Ihr entschuldigt mich sicher, aber ich werde nun aufbrechen, um das Notwendige zu veranlassen. Eine Bedingung habe ich jedoch.«
»Bedingung ist so ein hartes Wort.«
»Ihr werdet keine Schwierigkeiten haben, sie zu erfüllen«, sagte Gilia knapp. »Ich will, dass Ihr mir den Bastard überlasst, sollte er Euch ins Netz gehen. Diese Angelegenheit ist eine Sache des Hauses Bonareth.«
»Natürlich.« Shantalla lächelte sacht. »Was immer Ihr wollt.«
Emilia
Wenigstens war er hübsch. Emilia Bonareth drehte das Weinglas zwischen den Fingern, während sie den Tulamiden musterte, der vergeblich versuchte, nach einem der erschrocken fiependen Vögel zu haschen. Emilias Mutter hatte den Käfig bauen lassen, weil sie es liebte, dem Zirpen und Pfeifen zu lauschen und die buntschillernden Viecher dabei zu beobachten, wie sie von Ast zu Ast hüpften. Ganze Heerscharen von Questadores hatte sie ausgesandt, um ihr die schönsten und seltensten Exemplare aus den Tiefen des Dschungels zu bringen. Sie kannte sogar all die Namen, die so ähnlich klangen, dass Emilia sie bereits vergaß, noch ehe sie ganz ausgesprochen waren. Vögel waren langweilige und anstrengende Geschöpfe, die sie mit ihrem ewigen Gezwitscher ermüdeten. Umso interessanter war die Frage, ob Vögel auch andere Laute von sich geben konnten.
Sie hatte mit Cherim darüber gesprochen, als sie nach genossener Rahjaslust noch dämmernd im Bett lagen. Ein Vogel hatte unter dem Fenstersims gezirpt, und sie hatte angekündigt, ihn in Stücke zu reißen, bis er schrie, wenn er nicht bald aufhörte. Halb gefangen von der Schwüle und der Ermattung hatte Cherim angemerkt, dass Vögel gar nicht schreien könnten wie andere Lebewesen. Das war in doppelter Hinsicht bemerkenswert gewesen. Zum einen hatte sein Einwand ihr Interesse geweckt, der Frage auf den Grund zu gehen. Zum anderen hatte er es gewagt, ihr zu widersprechen. Das war nicht mehr geschehen, seitdem sie ihn gezwungen hatte, sich diese Bastarddirne vorzunehmen. Er hatte es getan, mit versteinerter Miene und mechanisch wie ein Golem, aber es hatte etwas in ihm gebrochen.
Emilia führte den Weinkelch an die Lippen und nahm einen kleinen Schluck von dem schweren Almadaner, während sie seine Bemühungen aufmerksam verfolgte. Sie mochte gebrochene Menschen. Sie widersprachen nicht, wurden nicht aufsässig und hatten diesen leeren Ausdruck in den Augen, der Emilia tiefe Genugtuung verschaffte. Wer gebrochen war, ergab sich ihrem Willen. Letztendlich hatte sie auch Cherim nur aus diesem Grund bei sich behalten. Außerdem war er schön, und Emilia liebte schöne Männer, und wenn sie ihr bedingungslos zu Willen waren, umso mehr.
Sie nahm einen weiteren Schluck, dann stellte sie den Kelch ab. Der Wein schmeckte schwer und unpassend für diese Gelegenheit, die eher nach etwas Leichtem verlangt hätte. Vögel brauchten Weißwein, am besten gekühlt, und dazu ein wenig Wind, der die beklemmende Schwüle vertrieb. Dass es an beidem mangelte, störte sie nunmehr und legte sich wie ein unangenehmes Kratzen unter die satte Zufriedenheit, die dem erfüllenden Liebesspiel gefolgt war.
»Verschwinde damit«, fuhr sie die Sklavin an, die regungslos hinter dem Korbstuhl stand. »Und teile deinem Aufseher mit, dass ich dich nicht mehr sehen will. Sonst lasse ich dir die Flügel ausreißen. Und du«, wandte sie sich an Cherim, der immer noch versuchte, einen der Vögel zu erhaschen. »Bist du endlich soweit? Das kann doch nicht so schwer sein!«
»Was kann nicht so schwer sein?«, erklang hinter ihr die scharfe Stimme ihrer Mutter.
Emilia drehte gereizt den Kopf. Aus den Augenwinkeln sah sie die Sklavin, die kreidebleich geworden war und eilig die Kristallkelche und die Schale mit dem Dattelkonfekt zusammenräumte.
»Du kommst gerade richtig«, ließ sie Gilia wissen. »Cherim soll mir einen Vogel holen. Selbst das scheint ihn zu überfordern.«
»Nun, er hat sicher andere Qualitäten. Sonst wärst du seiner längst überdrüssig.« Gilias Stimme klang neutral, aber ihr Blick ging an Emilia vorbei und blieb an der offenstehenden Käfigtür hängen. »Umsicht zählt jedoch nicht dazu. Oder beabsichtigt er, meine Vögel entkommen zu lassen?«
»Nein, er will herausfinden, ob Vögel schreien können.« Emilia lehnte sich wieder zurück und sah zum Käfig. »Wenn es diesem Dummkopf denn gelingt, einen zu fassen zu bekommen.«
»Es freut mich, dass du dich für meine Vögel interessierst. Aber ruf Cherim zurück.«
»Warum?« Emilia sah sie verwundert an. »Die Vögel werden ihm doch schon nichts tun?«
»Nein.« Ihre Mutter klang ungewohnt kurz angebunden.
»Ich habe jedoch Wichtigeres mit dir zu besprechen. Außerdem habe ich gerade nicht die Muße, jemanden zu finden, der Ersatz besorgt.«
»Ist ein Vogel nicht ebenso gut wie der andere?« Emilia verzog den Mund, aber sie gab Cherim mit einer Geste zu verstehen, zu ihr zurückzukehren. Erleichterung stand dem Tulamiden ins Gesicht geschrieben, als er heraustrat und die Tür sorgsam hinter sich verschloss. Der Käfig war groß genug, dass ein Mensch aufrecht darin stehen konnte, und geräumig, um den Vögeln die Möglichkeit zu geben, umherzuflattern und ihr prachtvolles Gefieder zu zeigen. Dennoch war es durch die Sitzstangen eng, sodass er ein oder zwei Mal gestürzt war und seine Hände und Knie mit Vogeldreck besudelt waren.
»Was ist denn so wichtig?«, erkundigte sich Emilia, nachdem sie dem Tulamiden mit einer ungeduldigen Geste bedeutet hatte, einen zweiten Stuhl für ihre Mutter herbeizuschaffen. »Gibt es Neuigkeiten wegen der Sache?« Ihre Mutter und sie hatten sich darauf verständigt, den Rabenbund nicht offen zu erwähnen. Emilia hatte ohnehin wenig Interesse an den geheimen Treffen. Ob der Patriarch nun Amir Honak oder Brotos Paligan hieß, ob der Schwarze General herrschte oder ein Rat aus Granden, das spielte für sie keine Rolle. Im Gegenteil, sie war du Metuant irgendwie sogar dankbar, dass er damals den Tod ihres Bruders gerächt und die Duumvirn niedergeworfen hatte. Aber ihre Mutter hielt es für wichtig, die Zukunft der Stadt und des Imperiums nicht anderen zu überlassen. Das Haus Bonareth habe zu sehr geblutet, um sich darauf beschränken zu können, Wunden zu lecken. Emilia fühlte sich jedoch schnell gelangweilt, wenn es um Macht und Politik ging, sodass sie diese Dinge gerne an ihre Mutter abtrat. Gelegentlich sprachen sie darüber, aber meist setzte Gilia sie erst in Kenntnis, wenn etwas Wichtiges geschehen war. Dass sie sie hier im Garten aufsuchte, war ungewöhnlich.
»In der Tat.« Gilia verschränkte die Arme, während sie kurz Cherim nachsah, der zum Haus hinübereilte. Ihre Miene war ernst, als sie sich wieder Emilia zuwandte. »Wo ist die Bastardtochter von Aurelian?«
»Dieses weinerliche Ding mit dem komischen Namen?« Emilia grinste und lehnte sich zurück. »Sie ist in Sicherheit. Ich habe sie in die Arena bringen lassen. Als Gladiatorenhure. Das macht sie wohl ganz gut. Kürzlich war Don Amato bei mir und hat mir ein Angebot für sie gemacht. Einer seiner Gladiatoren hat an ihr Gefallen gefunden. Ich habe natürlich abgelehnt.«
»Das ist gut.« Gilia holte tief Luft. »Hör zu. Wir brauchen das Mädchen, um diesen elenden Said in die Finger zu bekommen.«
»Deshalb habe ich sie in die Arena eingesperrt.«
»Und zugelassen, dass jeder wildfremde Gladiator sie bespringt, anstatt dafür zu sorgen, dass der Bastard von ihrem Aufenthaltsort erfährt! Nein, wir müssen ihn anlocken und dazu zwingen, übereilt zu handeln.«
Emilia runzelte fragend die Stirn. »Wie genau sollen wir das anstellen?«
»Erst einmal musst du unterbinden, dass sie von Gladiatorenpferch zu Gladiatorenpferch gereicht wird. Kette sie an und lass niemanden zu ihr. Dann lass verbreiten, dass sie bei den nächsten Spielen in der Arena steht. Mach ein Spektakel daraus oder lass sie von wilden Tieren zerfleischen. Das ist mir gleichgültig, solange es ihren Bruder zum Handeln zwingt.«
»Danach ist sie aber tot«, protestierte Emilia.
»Es reicht, wenn sie ihren Zweck erfüllt.«
Emilia nickte verstehend. Sie hatte keine Ahnung, warum es ihrer Mutter nun so eilig war, aber ihr war es recht. Auch wenn sie ein klein wenig Wehmut dabei verspürte, ihren Plan dann nicht mehr umsetzen zu können. In den Tagen nach der Orgie hatte sie sich in bunten Farben ausgemalt, was sie tun würde, wenn sie beide Bastarde in ihrer Gewalt hatte. Doch ihre Mutter hatte recht, am Ende mussten sie ohnehin sterben, und wenn ein Arenaspektakel half, Said zu fassen, musste sie eben auf das Mädchen verzichten. Aus den Augenwinkeln sah sie Cherim, der einen Stuhl herangeschleppt hatte und nun abwartend verharrte. Mit einer ungeduldigen Handbewegung winkte sie ihn heran. Er schien noch bleicher als zuvor, aber sein Blick ging stumpf ins Leere.
»Ich kümmere mich darum«, versprach sie und schenkte ihrer Mutter ein Lächeln. »Unter einer Bedingung. Ich will einen Vogel.« Sie deutete auf den Käfig. »Den goldenen dort am liebsten. Mir gefallen seine Federn.«
Sie sah, wie ihre Mutter zögerte, aber sie wusste, dass sie ihr den Wunsch nicht abschlagen würde. Dafür waren ihr die Bastarde zu wichtig, und außerdem hatte sie ihr noch nie einen Wunsch abgeschlagen.
Tatsächlich nickte Gilia langsam. »Ich lasse meinen Sklaven kommen«, sagte sie. »Er weiß, wie man ihn einfängt.«
Amato
Die Schwüle lag über der Villa wie ein erstickendes Tuch. Vom Übungsplatz her drang Waffengeklirr zu seinem Fenster hinauf, sodass Amato kurz erwogen hatte, die Holzläden zu schließen, um den Lärm und die Hitze auszusperren. Es hätte jedoch nichts genutzt. Er konnte sich ohnehin nicht auf die Korrespondenz konzentrieren, und noch weniger auf die Listen, die Samana Cortez ihm vorgelegt hatte. Es ging um Verpflegung und Gerät für den Ludus, Papiere, wie er sie jeden Mond gegenzeichnete. Heute fiel es ihm jedoch schwer, seine Gedanken zusammenzuhalten und zu verstehen, was die Lanista vermerkt hatte. Dabei hatte er sich bewusst dazu entschlossen, sich den Unterlagen zu widmen, um Ablenkung zu finden. Doch seine Gedanken schweiften immer wieder ab.
Amato wusste, dass es ein Fehler war, Said zu helfen. Es war nicht richtig, sich in die Belange der Bonareth und der Karinor einzumischen, die ihn nichts angingen. Aber er hätte nicht anders handeln können. Seit Said fort war, kreisten seine Gedanken immerfort um ihn und die Frage, wo er wohl war und ob es ihm gelang, den Häschern zu entkommen. Und ob er ihn wiedersehen würde.
Amato atmete aus und versuchte, die Gedanken von sich zu drängen. Er sollte sich von ihm fernhalten. Er war drauf und dran, sein Herz an einen Mann zu verlieren, den er kaum kannte. Der ihm fremd war, in seinem Wesen, seinem Denken, seinem Handeln, in allem. Dennoch beherrschte er seine Gedanken, und das, obwohl er seinen Verstand gerade jetzt aufmerksam und wach brauchte. Die Zeit verrann, und mit jedem Tag mochte die Verschwörung sich entschließen zuzuschlagen – wenn es denn tatsächlich eine gab. Manchmal fragte sich Amato, ob er sich dieses gewisperte Gespräch im Tempel nicht nur eingebildet hatte, ob es vielleicht nur ein Traumbild war, das ihm sein übermüdeter Geist vorgegaukelt hatte. Aber das würde er nicht herausfinden, wenn er hier herumsaß und seine Gedanken sehnsuchtsvoll hinab in die Stadt glitten.
Mit einem leisen Seufzen nahm er die Liste noch einmal auf und überflog die Einträge. Er stutzte, als sein Blick auf den letzten Punkt fiel, eine Anmerkung, die Cortez wohl nachträglich hinzugefügt hatte und in der die Lanista darum bat, den Wilden zurück in den Ludus zu holen.
Amato runzelte verwundert die Stirn. Bislang war er davon ausgegangen, dass der Nordländer unter der Arena gut aufgehoben war, wo man ihn in Eisen schlagen und sicher bewachen konnte. In seinem Ludus genossen die Gladiatoren sehr viel mehr Freiheiten, und er war nicht sicher, ob der Wilde schon dafür bereit war. Die Tulamidin, die er getötet hatte, war ein schwerer Verlust gewesen, und auf weitere Opfer konnte Amato gut verzichten. Vielleicht hätte diese Sklavin mäßigend auf ihn eingewirkt, die sich in der Arena so entschlossen vor den Nordländer gestellt hatte. Es war augenscheinlich gewesen, dass der Wilde etwas für das Mädchen empfand. Allerdings hatte sich Emilia Bonareth geweigert, sie ihm zu verkaufen, sodass es womöglich besser war, ihn hierherzuholen, um ihn auf andere Gedanken zu bringen. Amato seufzte. Es war einfacher gewesen, als der Nordländer noch ein namenloser Sklave gewesen war. Jetzt war er ein Held, den er nicht mehr leichtfertig aufs Spiel setzen konnte. Ihn zu hassen, brachte Reto nicht zurück.
Amato nahm einen Schluck Wein, und griff dann nach Feder und Tintenfass, um seinen Namenszug unter Cortez’ Auflistung zu setzen. Die Lanista war ein Glücksgriff, denn anders als ihr Vorgänger wusste sie nicht nur Kämpfer auszubilden, sondern ebenso den Ludus zu führen, ohne dass Amato ständig eingreifen musste. Und sie hatte eine gute Hand für Gladiatoren. Wenn sie der Meinung war, dass der Nordländer hier besser aufgehoben war als in dem Pferch unter der Arena, dann wollte er ihr glauben.
Etwas zufriedener legte Amato das Papier beiseite und warf einen Blick auf das letzte Schreiben, das sein Sekretär bereitgelegt hatte. Er hob irritiert eine Augenbraue, als er das Siegel erkannte, das eine prachtvolle Krone zeigte: das Zeichen Goldo Paligans.
Ein ungutes Gefühl machte sich in seinem Magen breit, während er auf das Schreiben starrte und mit sich rang, ob er es wirklich öffnen sollte. Dass Goldo ihm sein Wohlwollen entzogen hatte, war spätestens mit Esmeraldos Ankunft offenkundig, und das Oberhaupt des Hauses Paligan tat nichts ohne Grund. Wenn er ihm nun schrieb, dann sicher nicht, um ihm zum bevorstehenden Tsatag zu gratulieren.
Amato wog den Brief einen Moment lang unschlüssig in der Hand, ehe er sich ein Herz fasste und das Siegel brach. Es waren nur wenige Zeilen, die sein Großonkel ihm geschrieben hatte. Der Tonfall, in dem Goldo sein Missfallen über den Tod des Schwarzen Schreckens mitteilte, war gewohnt jovial, die unterschwellige Drohung jedoch kaum zu überlesen. Amato solle sich auf Gran Paligana einfinden, und auch, wenn das Wort ›unverzüglich‹ nicht ausdrücklich erwähnt wurde, schwang es doch in jedem Satz unüberhörbar mit.
Amato ließ das Schreiben sinken. Von draußen klang immer noch das Scheppern der Waffen und Rüstungen und zerriss die träge Stille des späten Nachmittags. Wenn er heute aufbrach, konnte er vor Mitternacht die Plantage erreichen, mit einem Pferd vielleicht sogar noch eher. Er musste nur Ismene rufen, um das Notwendige zu veranlassen. Die Cortez hatte die Unterschrift auf ihrer Liste, sie würde ihn die nächsten Tage nicht brauchen. Wenn er zurückkehrte, musste er sich womöglich keine Gedanken mehr um eine mögliche Verschwörung machen, weil Goldo ihn zurückstoßen würde in die Bedeutungslosigkeit, aus der er ihn damals erhoben hatte, als Amato seine Wahl in den Rat der Zwölf mit nemekathäischen Tempelfriesen erkauft hatte. Der Tod des Gladiators bot seinem Großonkel die Gelegenheit, das Spiel vor der Zeit zu beenden. Seine Figuren hatte Goldo bereits in Stellung gebracht, es bedurfte nur dieses einen, letzten Zuges, den Amato in den letzten Wochen und Monden so oft ersehnt hatte. Und doch, in seinem tiefsten Innern wusste er, dass dieser Ausweg falsch war.