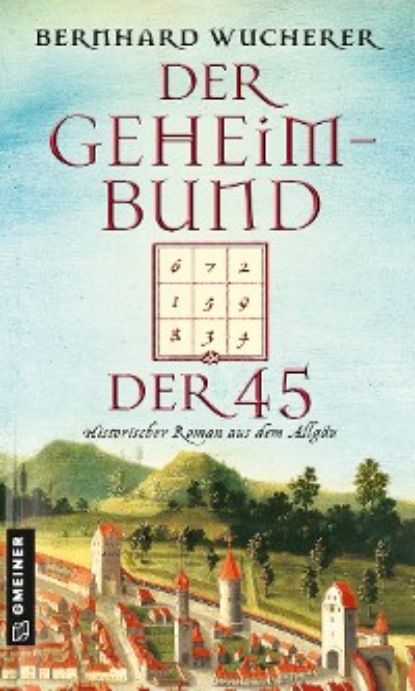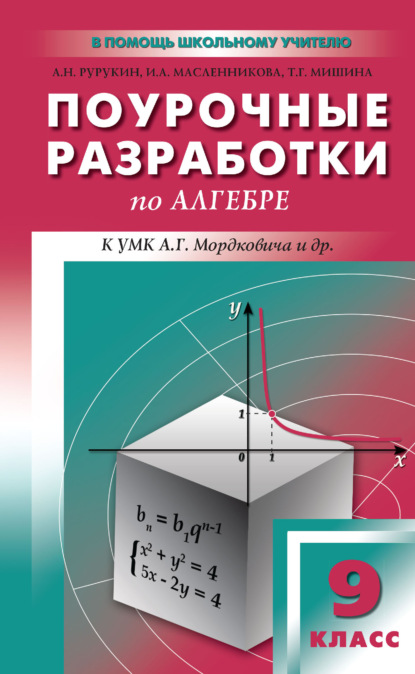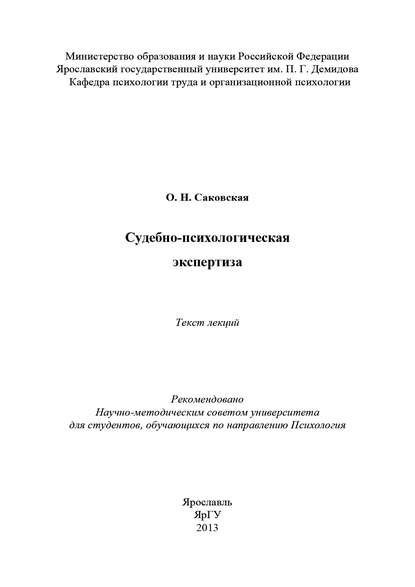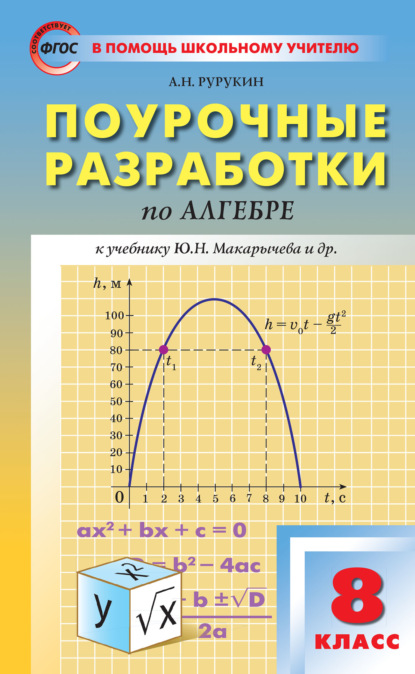- -
- 100%
- +
*
Weil der allseits beliebte Grundherr von Ysinensi glaubte, dass sich ihm der Inhalt der Ziffern auf dem Amulett erschlossen hatte, bangte er seit dem Tod des Abtes vor vier Jahren um sein eigenes Leben, das er allein schon deswegen gottesfürchtig führte, um das ersehnte Seelenheil zu erlangen. Obwohl er dem Kloster immer wieder Geld für Anbauten oder nötige Reparaturarbeiten stiftete, mochte das klösterliche Leben irgendwie nicht so richtig in Gang kommen, wie dies in anderen Klöstern der Fall war.
»Dies mag möglicherweise damit zu tun haben, dass sich die Lage im Süden meines Herrschaftsgebietes vielleicht doch nicht für einen kleinen Konvent eignet! Außerdem haben es die Klöster innerhalb oder im Umfeld größerer Städte in jeder Hinsicht leichter!«, hatte er anderen gegenüber nicht nur einmal bemerkt.
Dafür konnte Graf Manegold mit dem Dorf, in dem sich das Kloster befand, umso zufriedener sein. Hannes Eberz war es gelungen, das berufliche Erbe seines Großvaters weiter auszubauen und aus der ehemaligen Bauernsiedlung ein Handwerkerdorf zu formen, dessen Bewohner Abgaben entrichten konnten, ohne deswegen allzu sehr darben zu müssen. Zudem war es ihm gelungen, zu beiden Seiten der von ihm angelegten Hauptstraße die ersten Kaufleute anzusiedeln, die so betucht waren, dass sie es sich leisten konnten, ihre Häuser aus Stein zu bauen. Den beiden jüdischen Familien gelang dies ebenfalls.
Zudem hatte Hannes mit Agathe Burgerin ein braves Weib gefunden, das ihm im Laufe der Jahre drei Mädchen und fünf männliche Nachkommen geschenkt hatte, von denen allerdings zwei dem Kindstod erlegen waren. Trotz dieses von Gott gewollten Unglücks waren Hannes und Agathe ein im Grunde genommen glückliches Paar, das sich liebevoll um die Kinder und um die Kaninchenzucht kümmerte, für die bereits Hannes’ Vater in jungen Jahren den Grundstein gelegt hatte. Die Kinder mussten sich nicht nur um die Aufzucht junger Kaninchen kümmern, sondern auch sonst mit anpacken, wo es nötig war. Dennoch konnten sie ein solch schönes Leben führen, wie es sich der Nachwuchs der meisten hart arbeitenden Eltern nur wünschen konnte. Weil dies Agathes und Hannes’ wohlerzogenen Kindern bewusst war, dankten sie es durch unverrückbare Gottesfurcht, sowie durch Respekt ihren Eltern und allen anderen Menschen gegenüber. Gerade der kleine Peter bereitete seinen Eltern stets große Freude. »Aus dir wird dereinst etwas ganz Großes!«, hatte der Vater immer zu ihm gesagt, wenn »Peterle« unter Aufsicht die Einnahmen der Eltern zählen durfte und sich von Mal zu Mal immer weniger verrechnete. Während die anderen Buben handwerkliches Geschick vorweisen konnten, tat sich Peter im Umgang mit der Schrift, vor allen Dingen aber mit der Handhabung von Ziffern und Zahlen hervor.
»Ja!«, bestätigte auch die Mutter das unverkennbare Talent ihres jüngsten Sohnes. »Mit Peterle bekommen wir den ersten richtigen Kaufmann in die Familie!«
Nach einem rechtschaffenen Tagewerk fand Hannes Eberz stets einen liebevoll gedeckten Tisch vor. Wenn es auch nicht zur Prasserei reichte, konnte er seine Familie doch so ernähren, dass keiner von ihnen vom Fleisch zu fallen drohte. Anstatt sich Tag für Tag mit Kaninchenfleisch vollzufressen und dadurch faul und träge zu werden, hielten sie ihren eigenen Verzehr bewusst in Grenzen und verkauften ihre Zuchttiere ebenso wie die von Hannes abgezogenen und von Agathe gegerbten Felle der Tiere. Und damit ihre lieben Mitmenschen nicht auf dumme Gedanken kamen und selbst mit der Züchterei anfingen, verkauften sie die Kaninchen nur geschlachtet und zu bezahlbaren Preisen. Den ärmsten Familien des Dorfes schenkten sie zu Weihnachten und zu anderen kirchlichen Festtagen ein oder sogar zwei ihrer Tiere. »Gott wird es uns danken!«, pflegte Hannes dann immer zu Agathe zu sagen, die sich stolz auf ihren Mann an ihn schmiegte und ihm zuflüsterte, dass sie ihn über alle Maßen liebe.
Zusammen mit seinen Einkünften als Handwerker und seinem Salär als Mair gelang es Hannes, trotz der stetig zunehmenden Abgaben an den Grundherrn Monat für Monat etwas auf die hohe Kante zu legen. Da seine Frau Agathe einer Färberfamilie entstammte, hatten sie zu allem hin damit begonnen, Saat-Lein zur Gewinnung von Leinöl anzubauen. Weil die meisten anderen Ackerbauern von Ysinensi dieses Leingewächs nur wegen dessen Fasern züchteten, um daraus Stoffe zu weben oder weben zu lassen, verfolgten die geschäftstüchtigen Eberz auch diesbezüglich gleich mehrere Ziele: Während die beiden ältesten Söhne Johannes und Elias sich um den Anbau kümmerten, verarbeiteten die beiden ältesten Töchter Maria und Lisa den Flachs gekonnt zu Stoffen, die dann von der Mutter mit Hilfe der kleineren Geschwister gewalkt, gebleicht und kunstvoll gefärbt wurden. Das Familienoberhaupt presste das Öl, füllte es in quartgroße Behälter ab und sorgte für den Vertrieb der gesamten Produktion, die sich – ebenso wie die Kaninchenzucht – weiß Gott sehen lassen konnte. So war es kein Wunder, dass die Interessenten auch aus den umliegenden Siedlungen und Dörfern nach Ysinensi kamen, um bei den Eberz einzukaufen.
Also konnte Hannes zufrieden sein, … sollte man meinen. Aber wie dem Grafen ging ihm die Prophezeiung, dass wegen des Amuletts ein weiterer Mensch sterben musste, nicht aus dem Kopf.
Vier Jahre nach dem Tod des Abts wurde seine Furcht schwächer. Was sollte noch passieren?, dachte er sich inzwischen. Da erfuhr der Familienvater, dass der Graf tot war. Nachdem er gehört hatte, dass das Amulett verschwunden sei, bekreuzigte er sich ein zweites Mal. Dann zog er sich zum Gebet zurück – er musste nachdenken. In der Stille des Gotteshauses kam der umsichtige Dorfvorsteher zu dem Entschluss, nichts über die Umstände, die zum Tod seines geliebten Herrn geführt hatten, wissen zu wollen. Um auch keine neuerliche Unruhe unter die Bevölkerung von Ysinensi zu bringen, ritt er noch am selben Tag auf seinem eigenen Pferd nach Altshausen, um die Hinterbliebenen des Grafen zu bitten, niemandem etwas darüber zu erzählen. Bei dieser Gelegenheit konnte er sein persönliches Bedauern, das Beileid seiner Familie und das der gesamten Bevölkerung von Ysinensi übermitteln. Zwei gute Gründe, um dorthin zu reiten, dachte er sich, als er seinem Rappen die Hacken gab.
Wenngleich Hannes Eberz von nun an zwar kein völlig sorgenfreies, dafür aber ein angstfreies Leben führen konnte, verging kein Tag, an dem er nicht an die verhängnisvolle Zahl Drei dachte.
Marktrecht bringt Aufschwung … und das geheimnisvolle Amulett …
Bis Anno Domini 1171
Die magische Zahl IV
Kapitel 7
Seit dem Tod des ersten Großmeisters des vor einhundertsiebzig Jahren in Konstanz gegründeten Geheimbundes »Gladius Dei« waren es die Mitglieder gewohnt, von Zeit zu Zeit hinter dem Amulett herjagen zu müssen, das – als wenn es der Teufel wollte – immer wieder verschwand, um dann doch wieder irgendwo aufzutauchen. Und jedes Mal, wenn es gefunden worden war, hatte es Tote gegeben. Bisher hatte die Prophezeiung des ersten Großmeisters sechs Opfer gefordert: zum einen Gerold Eberz, den Mair von villa Ysinensi, der das Amulett bei seiner Ermordung aber nicht bei sich getragen hatte, weil er es dem neuen Pfarrer von villa Ysinensi in die Tasche gesteckt hatte. Aber dies hatte der Mörder nicht mitbekommen, obwohl er vor Ort gewesen war. Eberz waren Wolfrad II. Graf von Altshausen und dessen treu ergebener Leibdiener gefolgt. Dann hatte es den Baumeister des Klosters getroffen, weil einer der fünfundvierzig Geheimbündler gehört hatte, dass er das Amulett um den Hals tragen würde, … was aber zumindest zum Zeitpunkt seiner Ermordung nicht der Fall gewesen war.
Weil der Geheimbund erfahren hatte, dass das Amulett vom Grafen Manegold I. zumindest zeitweise an den ersten Abt des Klosters, der ebenfalls Manegold geheißen hatte, weitergereicht worden war, hatte einer der Verschwörer den Klosterleiter sinnlos aus dem obersten Fenster des linken Kirchturms gestoßen. Schließlich war der betreffende Geheimbündler doch noch fündig geworden und hatte dem adeligen Träger das Amulett abgenommen.
Die Verwandten des Grafen hatten die Umstände, die zu Manegolds Tod geführt hatten, nach außen hin geheim gehalten. Dies hätten sie auch ohne den ausdrücklichen Wunsch des Dorfvorstehers von villa Ysinensi getan. Denn wie hätten sie der Öffentlichkeit einigermaßen plausibel erklären sollen, dass man ihrem als gottesfürchtig bekannten Herrn während eines Spaziergangs in seinem eigenen Park mit einem Schwert so fest durchs Herz gestoßen hatte, dass die offensichtlich zweischneidige schmale und lange Klinge hinten ausgetreten war? Aber dies war noch längst nicht alles gewesen; zu allem Übel hin hatte der Mörder – wie zuvor schon den anderen Ermordeten – eine von einem Quadrat umschlossene Zahl in die Stirn des Toten geritzt. Dieses Mal war es die Drei gewesen.
Für die fünfundvierzig »Auserwählten« war es nach siebenundsechzig Jahren des Verschwindens ein unbeschreibliches Glücksgefühl gewesen, das Amulett wieder im Besitz ihres Großmeisters zu wissen. Daraufhin hatte das Amulett über zwei Generationen hinweg den Großmeistern als äußeres Zeichen ihres Bundes gedient und war bei den geheimen Zusammenkünften von jedem einzelnen Mitglied ehrfurchtsvoll geküsst worden – eine Neuerung des vorangegangenen Großmeisters. Immer, wenn es verschwunden und wieder aufgefunden worden war, hatten diejenigen Menschen, die mit ihm zu tun gehabt hatten, dem Tod ins Auge sehen müssen. Das Verschwinden, das Wiederfinden, die Toten und die damit einhergehenden Rituale hatten den ideellen Wert dieses materiell völlig wertlosen Amuletts im Laufe von siebzehn Jahrzehnten immens gesteigert. Jedes Mal hatte sich der aktuelle Großmeister einen neuen Ritus einfallen lassen, um sich hervorzutun und seinen Status als uneingeschränkter Führer dieses radikalen Zirkels zu sichern. Denn der Verlust des Amuletts – und war er auch nur vorübergehend gewesen – hatte stets an der Reputation des jeweiligen Großmeisters genagt. Und weil innerhalb ihres Geheimbundes längst ein versteckter, aber immer wiederkehrender Machtkampf um die Position des Großmeisters begonnen hatte, waren die vierundvierzig gemeinen Mitglieder noch gefährlicher geworden, als sie dies am Tag ihrer ersten Zusammenkunft vor einhundertsiebzig Jahren schon gewesen waren.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Identität eines Großmeisters oder eines seiner vierundvierzig Handlanger bekannt würde. Dies würde gleichzeitig heißen, dass auf einen Schlag neununddreißig weitere unschuldige Männer ihr Leben lassen müssten, damit der Geheimbund korrekt nach den Statuten des ersten Großmeisters aufgelöst werden konnte. Denn erst – so die Prophezeiung des Großmeisters bei der Gründungsversammlung im Konstanzer Dom – wenn so viele Menschen getötet wurden, wie die Addition der neun Zahlen auf dem Amulett ergab, konnte sich der geheime Zirkel ins Nichts auflösen … oder sich ganz neu formieren. Ob dies – wenn es tatsächlich so weit kommen würde – ohne weiteres Aufsehen und möglicherweise sogar ohne das Aufdecken der Identität seiner Mitglieder vonstattengehen würde, stand allerdings in den Sternen.
Kapitel 8
Hannes Eberz war stolz auf seinen jüngsten Sohn Peter gewesen, obwohl der ihm nicht ins Amt des Mairs gefolgt war. Dafür war aus Peter genau das geworden, was seine Eltern schon immer geahnt hatten; ein erfolgreicher Kaufmann!
Hannes hatte den Aufstieg seines Sohnes nicht mehr ganz miterleben dürfen, weil er einem Geschwür im Kopf erlegen war. Bis zu seinem langwierigen und schmerzhaften Tod hatte der alt gewordene Mann tagtäglich die magisch auf ihn wirkende Zahl Drei im Kopf gehabt und nicht mehr herausbekommen, sosehr er dies auch versucht hatte. Dies war sogar so weit gegangen, dass ihn immer stärkere Kopfschmerzen geplagt hatten, die am Schluss überhaupt nicht mehr gewichen waren. Deswegen hatte er den als Schwätzer bekannten Dorfmedicus aufgesucht, den er ansonsten gemieden hatte. Nachdem er dem Arzt auf Nachfrage erzählt hatte, was ihn dermaßen plagte, dass er sich endlich einmal zu ihm getraut hatte, war anstatt eines hilfreichen Rates nur die neunmalkluge Antwort zurückgekommen: »Omne trinum perfectum!«, was nichts anderes geheißen hatte als »Aller guten Dinge sind drei!«
Von diesem Tag an hatte Hannes nur noch schlaflose Nächte und eine solche Heidenangst vor dem Tod gehabt, dass er irgendwann gänzlich der Narretei verfallen war. Ein unrühmliches Ende für einen einst schneidigen und von allen respektierten Mann, der für seine Familie, für das Kloster und für sein Heimatdorf Ysinensi so viel getan hatte wie keiner zuvor. Seine Frau Agathe war zwei Jahre zuvor eines natürlichen Todes gestorben und hatte den Verfall ihres Mannes nicht mehr miterleben müssen. Was aber beide noch mitbekommen und Hannes zumindest in früheren Jahren aktiv vorangetrieben und mitgestaltet hatte, war das systematische Anlegen einer breiten Durchgangsstraße, die sich vom höher gelegenen südlichen Teil in Richtung Norden durch das ganze Dorf hinunterzog und selbst für Ochsenkarren und Kutschen breit genug war. Davon ausgehend – so Hannes’ damalige Gedanken – konnten bei zunehmendem Bedarf an beiden Seiten Gassen angelegt werden, die zwischen den Behausungen zu mehreren Stellen führten, die als Fest- und Versammlungsplätze genutzt werden konnten. Gleichzeitig sollte dort Handel getrieben werden. Die Vision des weitsichtigen Dorfvorstehers war es gewesen, in Ysinensi verschiedene Märkte fest anzusiedeln und das Dorf künftig nicht immer wieder neu einzuteilen.
»Vielleicht wäre eine breite Querstraße in der Mitte des Dorfes gar nicht schlecht?«, hatte Hannes den anderen Männern von Ysinensi gegenüber verlauten lassen, wegen der damit verbundenen zusätzlichen Arbeit aber eine Abfuhr erhalten. Dann in Gottes Namen zu einem späteren Zeitpunkt, hatte er sich gedacht und das Projekt so lange vor sich hergeschoben, bis er es nicht mehr hatte realisieren können.
Dennoch hatte er bis zum Ausbruch seiner schrecklichen Krankheit Nacht für Nacht daran gedacht und davon geträumt, wie schön es doch wäre, wenn es einen eigenen Vieh- und Rossmarkt gäbe, dessen Gestank sich nicht mit dem herbalen Geruch von Gemüse und dem süßen Duft von Obst vermischen musste, während Schmalz, Stoffe, Hausrat und Tand an anderen Stellen feilgeboten wurden.
Unter seiner Ägide war auch die innerdörfliche Wasserversorgung verbessert worden. Hannes’ Visionen waren sogar so weit gegangen, mit dem Bau einer Stadtmauer aus Stein zu beginnen. »Wenn dies vermutlich auch ein Bauwerk über Generationen werden wird, muss einmal damit angefangen werden. Ravensburg, Wangen und andere Dörfer verfügen schon längst über einen steinernen Schutzwall, der ihnen Sicherheit gibt!«, hatte er vor vielen Jahren bei einer Zusammenkunft aller Männer des Dorfes gesagt, sich wegen der bevorstehenden Arbeit aber ebenfalls nur Häme, Pfiffe und sogar persönliche Beleidigungen eingehandelt. Mit dem Bau der ersten Mauer um Ysinensi herum hatte er gegen alle Widerstände hinweg trotzdem beginnen lassen und sich neben seiner eigentlichen Arbeit auch selbst den Rücken für die Allgemeinheit krumm geschuftet. Dennoch waren zu seinem Begräbnis nur wenige Bürger erschienen. Die Menschen hatten Angst vor Geisteskrankheiten und fürchteten sich davor, sich damit anzustecken. Dies hatte ihnen der selbst närrische Dorfmedicus eingeredet, weil er mit dem Mair zeitlebens zu wenig Geschäfte hatte machen können. Hannes Eberz war einfach zu robust gewesen, um wegen jeder Kleinigkeit den Medicus zu bemühen. Dementsprechend hatte er ihn im Laufe seines Lebens nur dreimal aufgesucht.
*
Obwohl im Herzogtum Schwaben ein jahrelanger Krieg zwischen den mächtigen Welfen und den Staufern getobt hatte, entwickelte sich Ysinensi weiterhin prächtig. Dass vor vier Jahren der einzige Sohn des sechsten Welfen beim Machtkampf mit dem Papst in den italienischen Landen an einer Seuche verstorben war, weswegen Welf VI. sein Erbe an seinen Neffen und ehemaligen Gegner Friedrich Barbarossa I. übergeben hatte, war dank der guten Handelsbeziehungen sogar bis ins Allgäu gedrungen. Dass das Welfenerbe als Reichsgut an den Kaiser gegangen war, veränderte so nach und nach das Leben im Herzogtum und im angrenzenden Bayern sowie in Schwaben. So war auch in Ysinensi die Zeit nicht stehen geblieben.
Weil den Verantwortlichen längst klar geworden war, was die Stunde geschlagen hatte, setzten sie sich im Refektorium des Klosters an einen Tisch und beschlossen eine Art Stadtgründung, indem sie den Gepflogenheiten ihrer Zeit folgend nach einem geometrischen Plan vorgehen wollten. Um das bisher Erreichte, im Grunde genommen aber immer nur von Laienhand Gefertigte auf fachkundigere Beine zu stellen, hatte Graf Wolfrad seine besten Baumeister aus Altshausen und Trauchburg sowie einen Mathematiker aus Tettnang zu dieser Besprechung mitgebracht. Um die Wichtigkeit seines Anliegens zu dokumentieren, hatte er sogar einen Astronomen aus Tübingen dazugebeten.
»Seit dreizehn Jahren verfolgt Heinrich der Löwe den Plan, das bayerische Salz aus Reichenhall nach Westen zu exportieren. Er plant eine Salzstraße über Wasserburg, München, Landsberg, Memmingen, Lindau, Schaffhausen und weiter nach Baden, Zürich und vielleicht sogar nach Basel! Und dabei müssen die Salzroder auch an Ysinensi vorbei …«
»Oder besser noch«, begann Marquard, der derzeit amtierende Abt von St. Georg, das, was Graf Wolfrad gesagt hatte, zu ergänzen. Bevor er seinen Satz vervollständigte, lachte er triumphierend auf. »… mitten durch Ysinensi hindurch!«
»Ja!«, bestätigte einer von Hannes Eberz’ Nachfolgern und setzte forsch drauf: »Wir müssen in jeder Hinsicht wachsam sein, um das Stapelrecht zu bekommen!« Der neue Mair von Ysinensi schien wie die meisten seiner Vorgänger ebenfalls ein vernünftiger Mann zu sein.
»Ihr wollt das Stapelrecht für Ysinensi?«, freute sich der Graf und sagte den anderen zu, alles dafür zu tun, um die Salzfuhrwerker zu verpflichten, in Ysinensi Station zu machen. »Weil wir noch kein offizielles Stadtrecht besitzen, kann ich nichts versprechen«, gab er zu bedenken, strahlte aber gleichzeitig die Hoffnung aus, es noch in diesem Jahr irgendwie hinzubekommen, dass Ysinensi von durchziehenden Kaufleuten verlangen dürfe, ihre Waren für einen noch zu bestimmenden Zeitraum auf dem Stapelplatz abzuladen und hier in Ysinensi den Kaufinteressierten anzubieten. »Sie könnten dann durch das Wassertor und das Viehtor zum Marktplatz gelangen!«
Weil seine Zuhörer zwar skeptisch waren, das begehrte »Stapelrecht« tatsächlich zu bekommen, aber dennoch zufrieden mit den Planungen ihres Grundherren, herrschte im Refektorium Aufbruchsstimmung.
*
Wie erfreut wären die Vorgänger des amtierenden Mairs gewesen, wenn sie es hätten miterleben dürfen, dass Ysinensi das begehrte Stapelrecht tatsächlich noch im selben Jahr erhalten hatte. Und wie stolz wären sie erst gewesen, wenn sie mitbekommen hätten, wie die mächtigen Welfen und der bayerische Herzog Heinrich der Löwe Ysinensi auch noch das Marktrecht verliehen hatten. Denn lange bevor Ysinensi diese Privilegien offiziell erhalten hatte, war von ihnen der Grundstein für den weiteren Ausbau zu einem bedeutenden Handelsstützpunkt gelegt worden. Ysinensi, das aufstrebende Allgäuer Dorf am Rande des westlichen Schwabens, hatte nicht nur das Stapelrecht, sondern durfte sich zudem auch noch als Markt bezeichnen. Und damit gingen einige gewinnversprechende Rechte einher, aber auch Verpflichtungen. Eine davon war, bei Wochen- und Jahrmärkten den sogenannten »Königsfrieden« zu wahren. Dabei standen sowohl die Händler als auch die Besucher unter dem Schutz der marktführenden Stadt, also des jeweiligen Mairs. Streitigkeiten wurden stets vor Ort ohne den Formalismus des Landesrechts entschieden. Denn der Marktherr musste die uneingeschränkte Freiheit des Handelsverkehrs sowie die Sicherheit der Straßen und Wege garantieren. Außerdem hatte er dafür zu sorgen, den Handel durch den Umlauf von Münzen zu erleichtern. Dafür durfte er von den Verkäufern einen Marktzoll einfordern. Außerdem hatte der Marktleiter dafür zu sorgen, dass die örtliche Kaufmannschaft vor Konkurrenz geschützt wurde – eine nicht immer leichte Aufgabe, die den künftigen Dorfvorstehern und Bürgermeistern von Ysinensi zunehmend Sorgen bereite würde.
Hannes Eberz hatte auch nicht mehr miterleben dürfen, wie die Dorfkasse durch den zunehmenden Wohlstand der Kaufleute und somit auch der Handwerker und Bauern ebenso gefüllt wurde wie durch Steuern, Ungelder und Zölle, die nun auch von reisenden Händlern entrichtet werden mussten. Wenn auch das meiste davon an den Grundherrn und von dort aus noch weiter geleitet werden musste, blieb für Ysinensi immer noch so viel übrig, dass die Dorfentwicklung weiter vorangetrieben werden konnte. Dennoch ärgerte es die Menschen, dass die Abgaben »nach oben hin« immer höher stiegen.
»Früher hat es geheißen ›Der Graf nimmt’s, der Graf gibt’s‹. Heute nimmt er nur noch!«, schimpften die Leute und hofften inbrünstig, dass sich dies irgendwann ändern würde.
*
Seit dem Tod des Dorfvorstehers Hannes Eberz hatte sich innerhalb der Familie viel verändert. Nicht nur aus seinem Sohn Peter war ein erfolgreicher Kaufmann geworden, auch all dessen Geschwister waren aufgestiegen. Und deren Kinder und Kindeskinder befanden sich ebenfalls schon auf bestem Weg, es zu etwas zu bringen. Insbesondere Peters zweitältester Enkel Godehard bereitete der Familie viel Freude, weil er wie sein Großvater hervorragend mit Zahlen umzugehen wusste. Aber auch Peters ältester Enkel Paul schien ein kluger Knabe zu sein. Allerdings hatte die Art und Weise, wie Paul in seiner Kindheit mit seiner Begabung umgegangen war, die Eltern zutiefst verunsichert. Denn Paul hatte schon als sechsjähriger Knabe Fröschen Strohhalme in den Hintern gesteckt, um sie aufzublasen – damit hatte er sie beileibe nicht quälen, sondern lediglich in Erfahrung bringen wollen, ob mit Luft gefüllte Frösche tauchen konnten. Als er später Ratten gefangen und bereits tote Katzen oder andere Tiere aufgeschnitten hatte, um zu sehen, was sich im Inneren von deren Bäuchen befand, war Pauls Eltern nicht nur einmal übel geworden. Sie hatten sich große Sorgen darüber gemacht, dass ihr Sohn der Narretei verfallen sein könnte, und ihn nach jeder Verfehlung so lange eingesperrt, bis Paul hoch und heilig Besserung gelobt hatte. Aber Pauls Schwüre hatten nie lange gehalten. Beim letzten Mal hatte ihn die Mutter erwischt, wie er den vom Fell befreiten Schädel eines toten Hundes an einen Strick gebunden hatte, um ihn im Stadtbach zu versenken, damit die Fische den Rest erledigen würden. »Ich wollte doch nur sehen, wie Hundekiefer funktionieren, weil die so fest zubeißen können!«, hatte der zu einem beachtlichen Burschen herangereifte Paul zu seiner neuerlichen Entschuldigung gesagt … und war wieder eingesperrt worden.
*
Von alledem hatte Peters Berufskollege und Freund Melchior Habisreitinger nichts gewusst. Er hatte nur mitbekommen, dass Paul ein überaus kluger Knabe war, aus dem unbedingt ein Studiosus werden musste. »… Arithmetik vielleicht?«, hatte Melchior vorgeschlagen und ergänzt, dass Rechnen schließlich die Grundlage für den Erfolg eines guten Kaufmannes sei. »Was würdest du davon halten, wenn ich deinen von Gott gewollt klugen Enkel bei meiner nächsten Handelsreise in die italienischen Lande mitnehme, damit er dort ein Studiosus werden kann?«, hatte Melchior seinen verdutzt dreinschauenden Freund gefragt, weil er dessen Leid nicht mehr hatte mit ansehen können. Peters Frau Elsebeth war vor einem Jahr den Folgen eines Arbeitsunfalles erlegen. Zu allem hin waren kurz darauf auch noch sein Sohn und seine Schwiegertochter an der Roten Ruhr verstorben, einer der vielen unerklärlichen Epidemien, die über das Land hinweggefegt waren wie ein Totenheer und auch in Ysinensi etliche Opfer gefordert hatten.
Um den Kraftakt zu schaffen, die alleinige Erziehung seiner Kinder und seiner Enkelkinder mit dem Geschäft unter einen Hut zu bekommen, hatte der gutmütige und gottesfürchtige Peter eine Haushälterin nehmen müssen, die viel Geld gekostet hatte – von der Amme für seine kleinste Enkeltochter ganz zu schweigen. Er hatte das zweifelhafte Glück gehabt, dass das neugeborene Kind einer Nachbarin dem Kindstod zum Opfer gefallen war, weswegen sie Milch gehabt hatte, die sie Peters kleiner Enkelin gegen gutes Geld hatte zur Verfügung stellen können.
Trotz des schweren Herzens bei dem Gedanken, seinen Enkel Paul vielleicht nie mehr wiederzusehen, hatte der fürsorgliche Großvater erwogen, um des Kindeswohls willen auf Melchiors Vorschlag einzugehen.