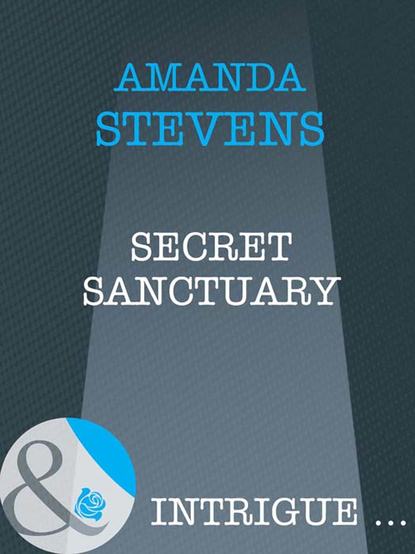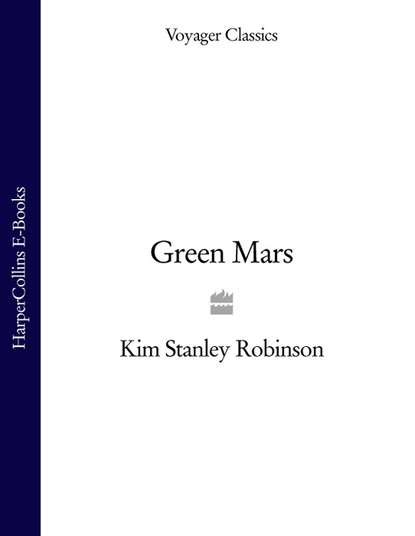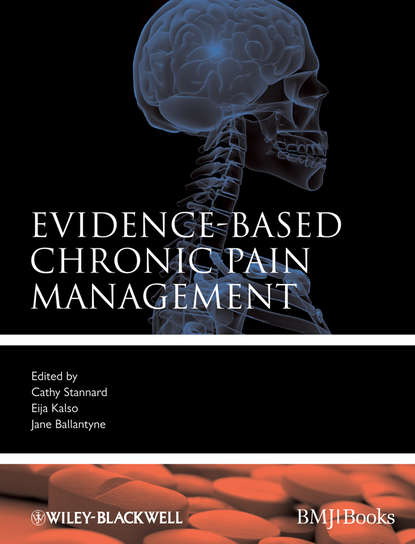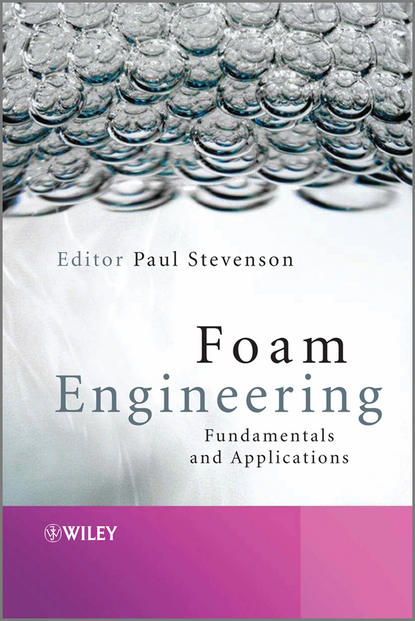- -
- 100%
- +
»Sie«, das sind ihre Schülerinnen.
Zwanzig Minuten später. Die Direktorin hat sich dann doch erweichen lassen. Wir bitten die 20 Mädchen, die vor uns sitzen, ihren Berufswunsch aufzuschreiben. Das Ergebnis: dreimal Ärztin, dreimal Journalistin, zweimal Juristin, einmal Zahnärztin, einmal Psychologin. Mindestens zehn der Schülerinnen haben also »Flausen im Kopf«. Wollen sie sich ihren Traum erfüllen, müssen sie studieren.
Vanessa berichtet von ihrem Jura-Studium, sie promoviert gerade und arbeitet für eine internationale Wirtschaftskanzlei. Wolfgang sagt, er habe nur seinen Eltern zuliebe eine Malerlehre gemacht. Jetzt studiert er Agrarwissenschaften und hat ein kleines Unternehmen gegründet. Ich erzähle von Herrn Proksch und schließe mit den Worten: »Hört nicht immer auf eure Lehrer, die irren auch manchmal.«
Nach dem Vortrag kommt eine Schülerin auf mich zu: eine der drei, die Journalistin werden wollen. Sie erzählt, ihre Eltern – eine Kassiererin und ein Facharbeiter – sagten ihr immer, im Journalismus arbeiteten einfach andere Menschen, das sei nichts für sie. Ich ermutige sie, mit ihren Eltern zu sprechen. Wenig später schreibt sie mir eine E-Mail. Sie habe sich ein Herz gefasst und ihre Eltern tatsächlich überzeugt: Sie darf nun nach der Realschule versuchen, noch das Abitur zu machen.
Das ist der Gedanke hinter der Arbeiterkind-Initiative: einander helfen, sich gegenseitig unterstützen. Wenn die Realschülerin ihren Wunsch, Journalistin zu werden, tatsächlich weiterverfolgt, werde ich ihr noch viele Tipps geben können. Manchmal sind es solche Verbindungen, solche Netzwerke, die über den Erfolg beim Berufseinstieg entscheiden.
Auch im Rotonda Business-Club in Köln wird der Netzwerk-Gedanke wichtig genommen. Der Verein sagt von sich, er sei »einer der führenden Wirtschaftsclubs im deutschsprachigen Raum, der Treffpunkt für die Gestalter der Region Köln«.
Wie im Café Telos gibt es auch hier ein Hinterzimmer. Allerdings ist es riesengroß, lichtdurchflutet, Häppchen werden aufgetragen. Hier trifft sich die Gegenbewegung zum Münchner Arbeiterkind-Stammtisch. Die Kölner FDP hat zum »Bildungsbrunch« eingeladen, das Thema lautet: »Für eine moderne Schulpolitik mit starken Gymnasien«. Es spricht Walter Scheuerl, der vor zweieinhalb Jahren in Hamburg als Vorsitzender der Initiative »Wir wollen lernen« die sechsjährige Primarschule – also das gemeinsame Lernen aller Kinder bis zum Ende der sechsten Klasse – verhindert hat. Heute sitzt er für die CDU in der Hamburger Bürgerschaft.
Scheuerl möchte die Schüler möglichst früh voneinander trennen, die starken von den schwachen, die einen sollen aufs Gymnasium, die anderen auf Haupt- und Realschulen, Gemeinschafts- und Stadtteilschulen – je nach Bundesland heißen sie anders –, und dann sollen die Schüler bleiben, wo sie sind. Vor allem geht es Scheuerl darum, das bedrohte Gymnasium zu schützen. »Die Entwicklung hin zu den Gesamtschulen führt zu einem Verlust von Qualität und der Wirtschaftskraft Deutschlands«, sagt er.
In Köln verteilt Scheuerl ein Infoblatt, auf dem steht, dass Schüler, die nach der zehnten Klasse aufs Gymnasium wechseln möchten, einen Lernrückstand von einem Jahr haben und deshalb »ihr blaues Wunder erleben« und »schlicht scheitern« werden.
Für mich klingt das so, als hätten privilegierte Menschen Angst, ihre Kinder müssten mit Arbeiter- und Migrantenkindern um Studienplätze konkurrieren. Innerlich höre ich wieder den Satz: »Das ist doch nichts für dich.« Und ich muss an Jutta Allmendinger denken und ihr Buch Schulaufgaben, das ich kürzlich gelesen habe. Allmendinger ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und Professorin für Bildungssoziologie. Sie prangert an, wie fatal es ist, wenn schon junge Schüler nach Leistungsstärke selektiert werden. Unter Berufung auf eine Studie aus dem Jahr 2009 schreibt sie: »Werden die Kinder früh nach Schulformen getrennt, ordnen sie sich selbst in diese Schulform ein. Sie leiten daraus ab, wie viel oder wie wenig sie sich zutrauen.« Die frühe Selektion hat also einen sich selbst verstärkenden Effekt: Deklariert man Kinder aus bildungsfernen Haushalten früh zu schwachen Schülern, werden sie auch gar nicht das Selbstbewusstsein und die Kapazitäten entwickeln, um mit besser situierten Kindern mitzuhalten. Forscher haben herausgefunden, dass der Einfluss des Elternhauses auf die Intelligenz nur in den ersten zehn Jahren messbar ist. Später wirken andere Einflüsse – etwa die Schule – viel stärker. Das heißt: Intelligenz ist beeinflussbar. Aber man muss die Gelegenheit auch nutzen.
Ein paar Tage nach dem Bildungsbrunch mit Walter Scheuerl erzählt mir beim Treffen im Café Telos eine Teilnehmerin, wie ein Professor zu ihr sagte: »Ihr seid also der Verein, der jetzt diese Leute auf die Uni bringt. Lasst das mal!«
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf wegen seiner Herkunft benachteiligt werden. So steht es im Grundgesetz. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ein Teil der Ständegesellschaft immer noch fortlebt.
Auf der Deutschen Journalistenschule in München, wo ich nach meinem Germanistik-Studium eine Ausbildung zum Redakteur absolvierte, hätte es einen wie mich gar nicht geben dürfen. Nicht weil die Journalistenschule etwas gegen Bewerber aus Arbeiterfamilien hätte, im Gegenteil, sondern weil diese in der Regel gar nicht so weit kommen. »Kinder von Facharbeitern oder ungelernten Arbeitern [...] existieren an den Journalistenschulen nicht«, heißt es in einer Dissertation der Technischen Hochschule Darmstadt. 85 Prozent der Journalistenschüler stammen aus einem »hohen oder gehobenen Herkunftsmilieu«, 15 Prozent stellt die »mittlere Herkunftsgruppe«.
Diesen Artikel dürfte es also gar nicht geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in einer großen, angesehenen Zeitung einen Text von einem Arbeiterkind lesen, geht gegen null. Was bedeutet: Bestimmte Erfahrungen und Sichtweisen existieren nicht in den Medien, jedenfalls nicht in bestimmten Medien.
In einem Artikel im SZ-Magazin heißt es: »Ich weiß noch, wie ich erschrocken bin, als ich zum ersten Mal einen Schulfreund besuchte, der mit seinen Eltern in einer 75-Quadratmeter-Mietwohnung lebte.« Der Autor schreibt darüber, wie es ist, ein Jahr lang Mitglied der Linken zu sein. Er ist erstaunt über das unbekannte Milieu, in dem er sich auf einmal bewegt: »In meiner Familie ist keiner arbeitslos, keiner in einer Gewerkschaft, die meisten sind selbstständig, gut situiert, viele Ärzte, ein paar Anwälte.«
Derartige Artikel sind seit einigen Jahren in Mode. Mal wird ein halbes Jahr lang das Internet boykottiert, mal ein ganzes Jahr lang jeden Tag dasselbe Kleid getragen. Eine Freundin, in der DDR aufgewachsen, vermutet, hier versuchten Leute, die nie vor existenziellen Problemen standen, ein wenig Aufregung in ihr Leben zu holen. Sie nennt sie »Vertreter der Milchbrötchen-Generation«.
Meine Mama grübelt derweil darüber nach, wie sie nach bald 50 Jahren Haareschneiden im Alter über die Runden kommt. Noch zwei, drei Jahre will sie in ihrem Salon arbeiten. Zurzeit hat sie einen Rentenanspruch von 734,58 Euro im Monat.
Die Milchbrötchen-Abenteurer gehören zur Oberschicht. Meine Mama steht sozial einige Etagen unter ihnen. Und ich? Ich stehe irgendwo zwischen ihnen und ihr.
Manchmal male ich mir aus, wie es wäre, die beiden Welten zusammenzubringen. Ich stelle mir vor, ich würde eine große Party veranstalten, auf der sich Michael, Textchef der deutschen Ausgabe des Magazins Wired und heute einer meiner besten Freunde, und Rudi, ein Elektromeister aus meinem alten Sportverein, begegneten. Eine Party, auf der meine erste Freundin, die Molkereifachfrau, sich mit den Feuilletonistinnen und Psychologinnen unterhielte, mit denen ich später zusammen war. Eine Party, auf der meine Eltern mit den Herzchirurgen, Journalisten, Professorinnen ins Gespräch kämen, mit deren Kindern ich jetzt befreundet bin. Sie würden miteinander reden, anstatt sich zu ignorieren oder aufeinander herabzuschauen. So stelle ich mir das vor. Und dann schiebe ich den Gedanken wieder weg. Wahrscheinlich wären alle überfordert von so viel Nähe.
Vielleicht wäre auch ich überfordert. Wenn ich ehrlich bin – sind mir die Menschen aus meinem früheren Leben nicht manchmal peinlich? Ist mir meine eigene Familie nicht manchmal fremd? Mein Hund damals hieß Wastl, meine langjährige WG-Katze heute heißt Gretchen. Meine Familie kauft bei Aldi, ich erlaube mir, soweit es geht, Bioprodukte. Es ist nicht so, dass die soziale Kluft sich aufgelöst hätte, bloß weil sie inzwischen mitten durch meine Familie geht. Ich spüre an mir selbst, wie stark das Magnetfeld sozialer Kreise ist. Ich muss zugeben, dass auch ich in Schichten denke. Ich orientiere mich an denen, die mir ähnlich sind. Oder an denen, die ich für ähnlich halte. Vielleicht ist diese Erkenntnis der wichtigste Grund, warum ich glaube, dass die Schule die sozialen Grenzen durchbrechen muss.
Herr Proksch wohnt noch immer in Lauterbach, dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, wo er unterrichtete.
Die Tür öffnet sich, er steht vor mir, ich erkenne ihn sofort wieder.
Erster Satz: »Marco, schön, dass du da bist.«
Zweiter Satz: »Sag mal, die ZEIT, wie hast du es denn dorthin geschafft?«
Diese Worte schnüren mir den Hals zu. Wir gehen zu einer Sitzecke, ich sehe Zinnpokale, gestickte Bilder in dunklen Holzrahmen, setze mich auf ein Sofa und sinke so tief ein, dass ich meine, ich säße wieder zusammengesunken auf der Schulbank. Dazu passt, dass Herr Proksch – heute 66 Jahre alt und in Pension – noch immer Du zu mir sagt.
»Wissen Sie, was Sie mir damals empfohlen haben, Herr Proksch?«
»Nein. Ich kann mich nicht erinnern.«
Ich erzähle es ihm. Er sagt: »Da muss ich mich bei dir und deiner Mutter entschuldigen. Ich bin sprachlos, das ist eine schlimme Sache.«
Nach einer kleinen Pause fügt er an: »Eigentlich finde ich es sogar unanständig.«
Diese Worte fühlen sich gut an. Sie erinnern mich an die Reaktion von Frau Bäumler, der Realschuldirektorin, die uns zunächst hinauskomplimentieren wollte. Sie sagte nach unserem Vortrag, man müsse »letztlich« für unsere Arbeit dankbar sein. Sie lächelte sogar, als sie das sagte, obwohl man ihre Zähne dabei fast knirschen hören konnte.
In Herrn Prokschs Wohnzimmer ist es still geworden. Die Wanduhr tickt vor sich hin, und ich frage meinen alten Lehrer, was er davon hält, dass in diesen Wochen überall in Deutschland wieder Variationen des Wortes »Hauptschulempfehlung« auf Zeugnisse gedruckt werden. Welchen Wert haben solche Begriffe, wenn sie manche Schüler auf Jahre hin entmutigen und Begabungen vernichten?
»Marco, das frage ich mich jetzt auch«, sagt Herr Proksch.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.