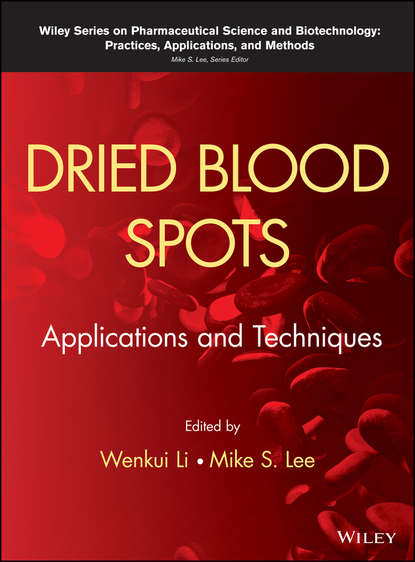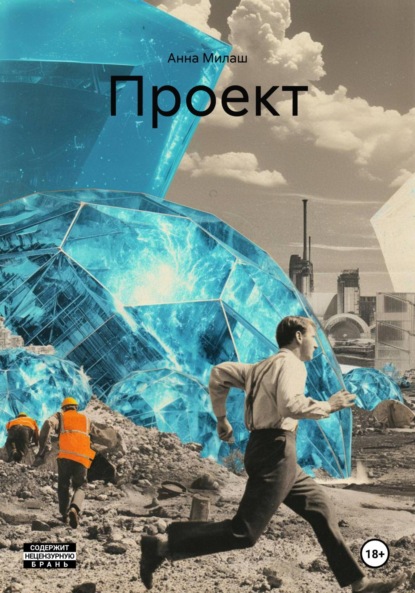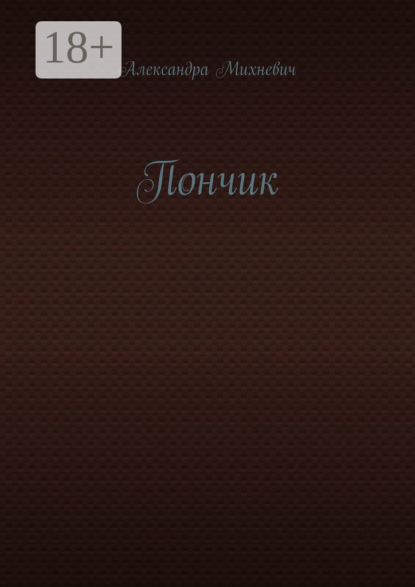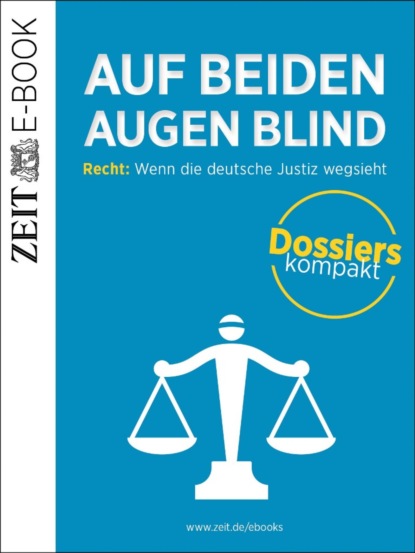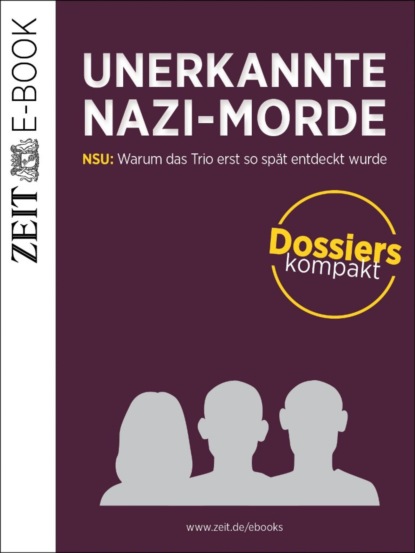Atmungsaktive Schuhe, Gratis-Geschenke oder umweltfreundliche Produkte. Klingt alles wunderbar, oder? Denkt man aber intensiver über Werbesprüche und Verkäuferfloskeln nach, merkt man häufig, wie nichtssagend oder irreführend diese sind.
In seiner Kolumne «Quengelzone» entlarvt ZEIT-Redakteur Marcus Rohwetter jede Woche die schlimmsten Worthülsen der Werbeindustrie mit tatkräftiger Unterstützung der ZEIT-Leser. Eine Sammlung mit den unterhaltsamsten Artikeln aus einem Jahr «Quengelzone».
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация