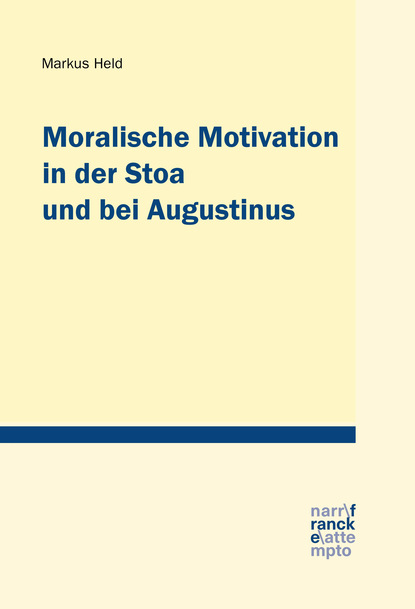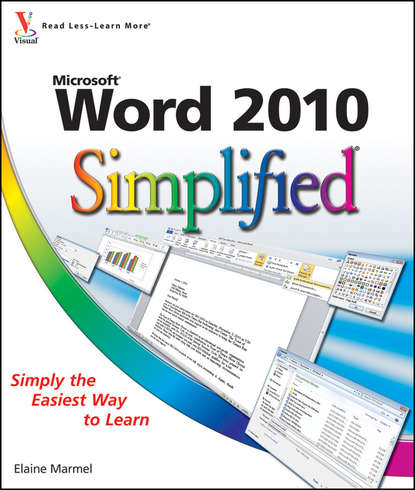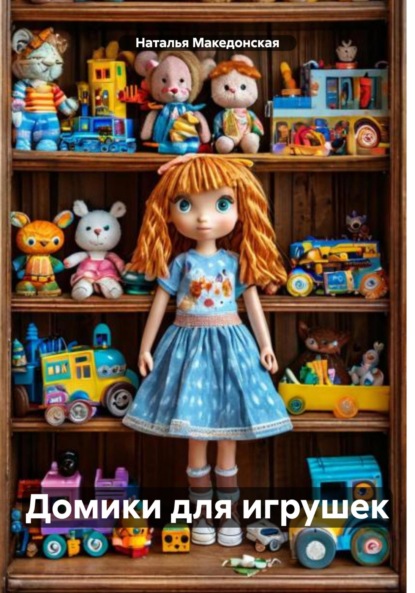Religionsbegründung ohne Erkenntnis Gottes
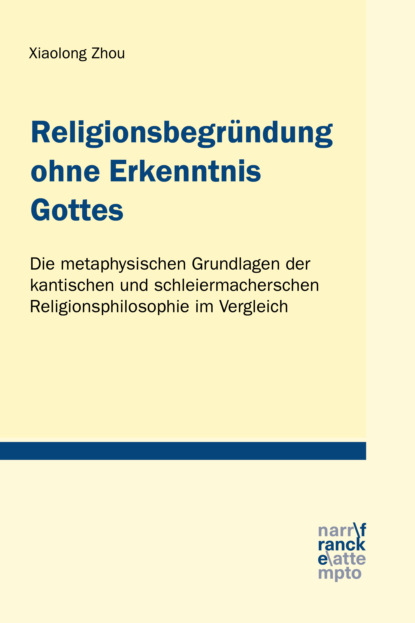
- -
- 100%
- +

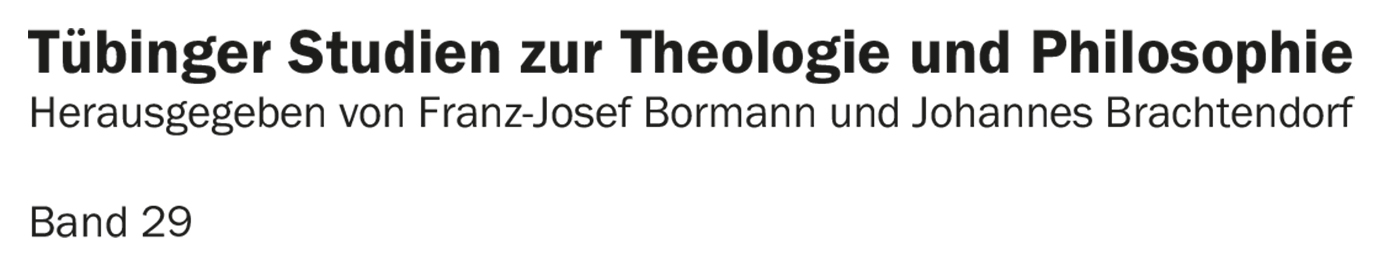
Xiaolong Zhou
Religionsbegründung ohne Erkenntnis Gottes
Die metaphysischen Grundlagen der kantischen und schleiermacherschen Religionsphilosophie im Vergleich
[bad img format]
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Philosophie in der Philosophischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen 2021
DOI: https://doi.org/10.24053/9783772057670
© 2022 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de eMail: info@narr.de
ISSN 1432-4709
ISBN 978-3-7720-8767-7 (Print)
ISBN 978-3-7720-0181-9 (ePub)
Das Schreiben dieser Dissertation begann im September 2018 und der erste Entwurf wurde im August 2020 fertiggestellt, als die Covid-19-Epidemie in vollem Gang war. Während dieser schwierigen Zeit in den späten Phasen dieser Arbeit verbrachte ich die überwiegende Mehrzahl meiner Tage zu Hause, um nicht mit einer Maske schreiben zu müssen, und auch wegen der eingeschränkten Öffnungszeiten der Bibliothek, was einerseits die Sammlung von Materialien beeinträchtigte und andererseits den Prozess des Schreibens meiner Doktorarbeit objektiv beschleunigte, weil ich nicht ausgehen konnte. Das Verfassen dieser Dissertation ist meiner Frau Yuting Liu zu verdanken. Ich bedanke mich bei ihr für ihre Toleranz und für ihr Verständnis und dafür, dass sie mein langweiliges Leben mit dem täglichen Lesen und Tippen vor dem Computer ertragen hat. Sie war mir eine große Unterstützung und hat mein Leben reich und nahrhaft gemacht.
Mein Doktorvater, Prof. Dr. Johannes Brachtendorf, war seit dem Tag meiner Ankunft in Deutschland für mich da und hat mir in jeder Hinsicht geholfen. Er ist immer sehr freundlich, sehr geduldig und hat meinen deutschen Ausdruck und das Schreiben meiner Doktorarbeit immer gefördert. Er hat mich immer zu seinen Kursen und zum Kolloquium eingeladen und mich dazu ermutigt Vorträge zu halten. Obwohl ich wusste, dass mein Deutsch gebrochen war, hat er mich nach jedem Vortrag mit seinem „sehr gut“ und seinem Markenzeichen, dem Lächeln, von der Verlegenheit befreit. Es gab sogar Zeiten, in denen er den deutschen Studenten in der Klasse erklärt hat, wie schwierig es ist, einen Vortrag in einer Fremdsprache zu halten. Besonders nachdem wir Sprachpartner wurden, verbesserte sich mein deutscher Ausdruck sprunghaft. Dafür kann ich ihm nicht dankbar genug sein.
Außerdem möchte ich mich bei PD Dr. Stefan Gerlach für die Erstellung des Zweitgutachtens zu meiner Dissertation bedanken. Ich muss leider sagen, dass ich seine Vorlesungen noch nie gehört und nur seine Arbeit über Schelling gelesen habe. Ich danke meinem Zweitbetreuer Prof. Dr. Friedrich Hermanni, der zu Beginn dieser Dissertation die ersten Vorschläge gegeben hat und aus dessen Seminaren zur Theodizee, zur Hegelschen Religionsphilosophie und zur Spätphilosophie Schellings ich immer wieder Ideen bekommen und schließlich in meiner Dissertation umgesetzt habe. Ich hoffe, dass seine Gesundheit bald wieder hergestellt ist. Darüber hinaus danke ich Prof. Dr. Friedrike Schick, Prof. Dr. Ulrich Schlösser, Prof. Dr. Klaus Corcilius und Prof. Dr. Volker Leppin dafür, dass sie mir die intellektuellen Ressourcen wie Platon, Aristoteles, Luther, Kant, Hegel und andere Denker zur Verfügung gestellt haben.
Meine Vermieterin, Frau Anne Röhm, war eine wichtige Person für meine Frau und mich in unserem Leben in Deutschland. Sie führte uns zum Bodensee, zum Affenberg Salem, nach Stuttgart usw., so dass wir Deutschland allmählich kennenlernen und uns in Deutschland integrieren konnten, und sie gab uns auch jede mögliche Annehmlichkeit in unserem Leben. Sie hat uns das Leben in Deutschland so einfach wie möglich gemacht und uns unvergessliche Momente geschenkt. Dafür möchte ich mich bei ihr herzlichst bedanken. Sie ist für uns wie eine Mutter in Deutschland, eine kulturelle Mutter.
Außerdem möchte ich mich besonders bei meinem Master-Berater, Prof. Dr. Wu Fei von der Philosophischen Fakultät der Peking Universität, bedanken. Seine Ermutigung hat mich dazu gebracht diese Dissertation zu schreiben. Ich möchte meinen Freunden danken, insbesondere Yue Shenghao, Zhu Lei, He Teng, Shari Georg, Liu Chang'an, Xu Yifei, Ruan Weicong, A Sihan, Zhong Wei, Fernando Gustavo Wirtz, Lisa Dann und Adrian Razvan Sandru. Sie haben dafür gesorgt, dass ich mich weniger hilflos, weniger einsam und freundlos und weniger unwissend gefühlt habe. Ich hoffe, dass sie alle an einem guten Ort ankommen werden.
Ich bin meinen Eltern dankbar. Sie arbeiten als Bauern und wissen nicht viel von dem, was ich studiert habe. Sie haben sich nie in meine Entscheidungen eingemischt und haben mich immer im Stillen unterstützt. Obwohl sie die meiste Zeit ihres Lebens arm gewesen sind, haben mir ihre harte Arbeit, ihre Einfachheit und ihre Sanftmut den größten Schatz in meinem Leben gegeben.
Aus diesem Grund widme ich ihnen diese Dissertation. Schließlich hoffe ich, dass meine beiden kleinen Nichten glücklich aufwachsen und ich, als der „abstrakte Onkel“, in der Zukunft mehr Zeit mit ihnen verbringen kann.
Meinen Eltern
0 Einleitung
0.1 Fragestellung
In der zweiten Auflage der KrV behauptet Kant in der Vorrede: „Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen.“1 In seinem System der Philosophie wird Gott aus den Gegenständen der Erkenntnis ausgeschlossen, indem Kant alle Erkenntnisse durch die Grenzen der Erfahrung beschränkt. In der transzendentalen Methodenlehre der KrV und auch in der KpV spielt die Gottesidee durch den Vernunftglauben und die Moralreligion wieder eine große Rolle im praktischen philosophischen System Kants. Deswegen ist Gott ein Gegenstand des Glaubens statt der Erkenntnis. Kants Denkweise hatte einen großen Einfluss auf die Philosophie und Theologie späterer Generationen. Im Hinblick auf die Philosophie nennen wir Hegel als Beispiel, dessen Philosophie versucht, dem kantischen Agnostizismus in Bezug auf Gott zu widersprechen und die gewisse Erkenntnis von Gott dialektisch zu erhalten. Theologisch betrachtet folgt Schleiermacher, der „der Kant der Protestantischen Theologie“ ist,2 dem kantischen Agnostizismus zur Gottesfrage. Auf dessen Grundlage verbindet er die Religion mit dem Gefühl. In dieser Arbeit werde ich vor allem die Auswirkung Kants auf Schleiermacher untersuchen und sie gleichzeitig an manchen Stellen auf Hegels System beziehen.
Karl-Heinz Michel hat in seiner Schrift über die Gotteslehre Kants die Auswirkung der oben genannten kantischen Theorie folgendermaßen beschrieben: „Theologische Aussagen wurden dadurch, nach Kants Auffassung, ausschließlich zur Sache des Glaubens (eines Glaubens, der nur subjektiv für wahr halten, aber eben nichts wissen kann), weil Gott in Natur und Geschichte grundsätzlich unerkennbar bleibt. Diese negative Beantwortung der Frage der Erkennbarkeit Gottes warf ganz besonders für die Dogmatik ein schweres Problem auf. Denn wenn man Kant folgen wollte, dann stand angesichts der welt- und geschichtsgebundenen Gottesaussagen der biblisch-christlichen Tradition nur noch der Weg eines agnostizistischen Rückzugs offen.“3 Danach nimmt Karl-Heinz Michel die Glaubenslehre Schleiermachers als Beispiel, um diese Auswirkung zu erklären: Dies sei eine Glaubenslehre, „welche ihre theologischen Aussagen nicht mehr, wie bisher, von einem wahrnehmbaren geschichtlichen Handeln Gottes aus, das dem Glauben vorausgeht und ihn begründet, sondern vom persönlichen, subjektiven Glauben aus entwickelte.“4 Außerdem fügt Karl-Heinz Michel die wichtigen Theologen nach Schleiermacher (wie W. Hermann, R. Bultmann, G. Ebeling) zu dieser Genealogie hinzu. Karl-Heinz Michel zufolge hat, allgemein gesagt, die von Kant und Schleiermacher beeinflusste Theologie eine „Umdeutung des Handelns Gottes extra nos in ein nur noch pro me erfaßbares Handeln“ bewirkt.5
Karl-Heinz Michels Meinung ist typisch bei diesem Thema. Obwohl die scharfsinnige Einsicht Michels sehr lehrreich ist, um die Theologie nach Kant und Schleiermacher zu verstehen, löste seine Auffassung doch einige Missverständnisse aus, die heute in der Forschung zur Religionsphilosophie von Kant und Schleiermacher existieren.
(1) Nach der Formulierung Karl-Heinz Michels sei für Kant „nur noch der Weg eines agnostizistischen Rückzugs offen“. Allerdings müssen wir fragen: Was ist eigentlich der Agnostizismus in Kants und Schleiermachers Gotteslehre? Bezieht er sich auf Gottes Existenz oder auf seine Eigenschaften? Auf den ersten Blick scheint sich der Agnostizismus sowohl auf Gottes Existenz als auch auf seine Eigenschaften zu beziehen, aber wir werden darauf hinweisen, dass das dezidierte Motiv, welches Kant zum pro me erfassbaren Handeln führt, die Unerkennbarkeit der Existenz Gottes ist. Im Vergleich dazu spielen die Eigenschaften Gottes eine große Rolle in Kants System. Dies ist nicht vereinbar mit einem Agnostizismus. Wir möchten auch zeigen, dass die Existenz Gottes niemals ein Problem für Schleiermacher war. Schleiermachers Agnostizismus bezieht sich auf die Eigenschaften Gottes.
(2) Im oben genannten Bild von den kantischen und schleiermacherschen Religionsphilosophien wäre die Idee Gottes nur eine subjektive Wahrheit in dem Sinne, dass der Gottesbegriff nicht auf die Objektivität (nämlich auf Gott selbst) zu beziehen ist. Dieser subjektive Charakter ist dann besonders betont, wenn man vom Gottesbegriff bzw. Religionsverständnis Schleiermachers redet. Die Kritik von Hegel und Emil Brunner ist typisch für die Deutung von Schleiermachers Religionslehre, sie ist nahezu vorherrschend in deren Erklärung. Zum Beispiel schreibt Hegel in der Vorrede zu Hinrichs’ Religionsphilosophie: „Soll das Gefühl die Grundbestimmung des Wesens des Menschen ausmachen, so ist er dem Tiere gleichgesetzt, denn das Eigene des Tieres ist es, das, was seine Bestimmung ist, in dem Gefühle zu haben und dem Gefühle gemäß zu leben. Gründet sich die Religion im Menschen nur auf ein Gefühl, so hat solches richtig keine weitere Bestimmung, als das Gefühl seiner Abhängigkeit zu sein, und so wäre der Hund der beste Christ, denn er trägt dieses am stärksten in sich und lebt vornehmlich in diesem Gefühle. Auch Erlösungsgefühle hat der Hund, wenn seinem Hunger durch einen Knochen Befriedigung wird. Der Geist hat aber in der Religion vielmehr seine Befreiung und das Gefühl seiner göttlichen Freiheit; nur der freie Geist hat Religion und kann Religion haben; was gebunden wird in der Religion, ist das natürliche Gefühl des Herzens, die besondere Subjektivität; was in ihr frei wird und eben damit wird, ist der Geist“.6 Außerdem gibt es noch andere Forscher, die Kants Religionsphilosophie als eine Art von schleiermacherschem Subjektivismus betrachten.7 Deswegen stelle ich hier die Frage: Wenn Kant und Schleiermacher ihre Religionstheorie auf die Subjektivität gründeten, sind die kantischen und schleiermacherschen Religionsphilosophien dann wirklich rein subjektiv, ohne irgendein Objekt zu treffen?
(3) In Hinsicht auf den Agnostizismus gibt es auch Differenzen zwischen Kant und Schleiermacher. Diese werden bei der Beschreibung Karl-Heinz Michels nicht deutlich. In der Tat kritisiert Schleiermacher die kantische Theorie in vielfältiger Hinsicht, deswegen ist es irreführend zu behaupten, Schleiermachers religiöse Theorie sei nur eine Variation der kantischen Philosophie. Vielleicht sind die Unterschiede zwischen beiden Philosophen bedeutender als die Übereinstimmungen. Obwohl Kant und Schleiermacher ihre Religionsphilosophie auf die Subjektivität gründen, basiert Kants Theorie von der Gewissheit der Existenz Gottes auf der praktischen Vernunft, die die Spontaneität des Subjekts beinhalte. Im Gegensatz dazu steht Gott bei Schleiermacher in einer ursprünglichen Relation mit dem Subjekt, die sich auf die extreme Rezeptivität des Ichs richtet.
Trotzdem repräsentieren die kantischen und schleiermacherschen Religionsphilosophien ein neues Paradigma und eine Tendenz, um die Religionsphilosophie zu begründen, indem sie die Gewissheit der Existenz Gottes nicht in der Natur und in der Geschichte suchen, sondern nur in der Subjektivität, bzw. in der Beziehung zwischen Gott und dem Ich. Deswegen ist in diesen Religionsphilosophien der Zusammenhang zwischen Gott und Welt, zwischen Gott und Subjekt gänzlich anders als in Hegels Religionsphilosophie, die keine Anstrengungen unterlässt, die Erkenntnis von Gott zu erhalten. Also hat Karl-Heinz Michels Argumentation ihre Berechtigung.
Zusammenfassend wird deutlich, dass Kant und Schleiermacher einen neuen Trend in der Religionsbegründung gefördert haben, indem sie die Gewissheit der Existenz Gottes in der Beziehung zwischen Gott und dem Subjekt suchten. Allerdings zeigen sich doch viele Unterschiede im Detail, die man nicht vernachlässigen sollte. Unter den Forschern gibt es noch Missverständnisse, die einiger Erklärungen bedürfen.
Folglich behandelt diese Untersuchung die Übereinstimmungen und die Unterschiede beim Thema „Erkenntnis und Gewissheit der Existenz Gottes“ bei Kant und Schleiermacher. In meiner Dissertation werde ich die kantischen und schleiermacherschen Religionsphilosophien aus der Perspektive der Erkenntnis Gottes und der Gewissheit seiner Existenz behandeln. Die Erkenntnis Gottes ist ein wichtiges Problem für Kant und Schleiermacher, ein Agnostizismus gilt jedoch bei Kant nicht für die Eigenschaften Gottes, sondern nur für seine Existenz. „Agnostizismus“ bedeutet nicht, dass Kant und Schleiermacher aufgegeben haben, Gott zu erkennen; es bedeutet auch nicht, dass Gott für Kant und Schleiermacher nur eine menschliche Schöpfung ist. Das grundlegende Motiv der Religionsbegründung durch die Subjektivität liegt (sowohl bei Kant als auch bei Schleiermacher) darin, dass die Gewissheit der Existenz Gottes nur durch die Beziehung zwischen Gott und dem Subjekt garantiert wird.
Mit dem Titel „Religion ohne Erkenntnis Gottes“ (1) möchte ich einige Missverständnisse klären bzw. einigen zu erwartenden Vorwürfen widersprechen. Z. B. werden manche denken, dass Kant einen unerkennbaren Gott behauptet; deswegen seien nach Kant alle die Grenze der Erfahrung überschreitenden Diskussionen über Gott abzulehnen. Allerdings entspricht diese Auffassung den sich überall wiederholenden Diskussionen über Gott in Kants Schriften nicht. Zudem könnte man z. B. kritisieren, dass die Gefühlstheorie Schleiermachers subjektiv sei, jedoch verkennt diese Kritik die Tatsache, dass Gott eine wichtige Rolle in diesem Gefühl (oder im unmittelbaren Selbstbewusstsein, wie Schleiermacher es nennt) spielt. (2) Mit diesem Titel möchte ich auch die Frage stellen, ob es möglich ist, eine Religionstheorie zu begründen, ohne irgendeine Erkenntnis Gottes vorauszusetzen. Kant und Schleiermacher kritisieren dogmatische Behauptungen über Gott in der Vernunfttheologie oder in der natürlichen Theologie. Ich möchte untersuchen, ob sie es wirklich vermieden haben, eine Erkenntnis Gottes vorauszusetzen.
0.2 Forschungsstand und Methoden
„Die Literatur zu Schleiermachers Religionsphilosophie füllt eine halbe Bibliothek.“ Das behauptet Gunter Scholtz.1 Deshalb füllt die Forschungsliteratur zu den jeweiligen Religionsphilosophien von Kant und Schleiermacher eine ganze Bibliothek.2 Viele Autoren äußern sich zum Verhältnis der Religionsphilosophien beider. Trotzdem gibt es leider nur wenige Monografien, die sich als ganze dem Vergleich zwischen der kantischen und schleiermacherschen Religionsphilosophie widmen. Bereits im Jahr 1841 hat Salomon Leviseur das Werk Der Religionsbegriff bei Kant und Schleiermacher geschrieben. Er analysiert die Begriffe beider mit der sogenannten dialektischen Methode und betrachtet sie als unterschiedliche Entwicklungsstufen, das heißt, Schleiermachers Religionsbegriff enthält die Theorie Kants, stellt aber nicht die Vollendung des Religionsbegriffs dar, sondern muss sich selbst weiterentwickeln. Leviseur ist der Auffassung, dass Kants Standpunkt, vereint mit einem Pantheismus, Schleiermachers Religionsphilosophie bilde, nämlich „der Schleiermacher’sche Standpunct als Wahrheit des Kant’schen“.3 Daraus ergibt sich, dass die Untersuchung von Salomon Leviseur auf einem Vorurteil über Schleiermacher, nämlich dem Vorwurf des Pantheismus, beruht und damit den heutigen akademischen Anforderungen nicht mehr genügen kann. Danach gibt es, soviel ich weiß, keine andere Monografie über den Vergleich zwischen Kant und Schleiermacher. Selbst in den letzten drei Jahrzehnten thematisieren nur wenige Aufsätze diesen Vergleich.4 Es besteht die Notwendigkeit, einen umfangreichen und tiefgehenden Vergleich in der Gotteslehre vorzunehmen. Mit dieser Untersuchung hoffe ich, diese Lücke zu schließen.
Obwohl nur wenige Monografien existieren, die die Religionsphilosophien Kants und Schleiermachers unmittelbar vergleichen, gibt es die folgenden Arten von Literatur, die für die Abfassung dieser Untersuchung hilfreich waren: (1) Die Untersuchungen zum Einfluss Kants auf die Entwicklungsgeschichte von Schleiermachers frühen Gedanken – diese Art von Untersuchungen behandelt Schleiermachers Kritik an Kant –, was indirekt dazu beiträgt, die Unterschiede zwischen den Religionsphilosophien beider zu verstehen. In dieser Hinsicht können die Arbeiten von Eilert Herms5 und Günter Meckenstock6 als vorbildlich bezeichnet werden. (2) Die Untersuchungen zur Religionsphilosophie Kants aus der Perspektive des gesamten Konzepts der kantischen Philosophie, etwa die Forschungen von Allen W. Wood,7 Georg Picht,8 Karl-Heinz Michel9 und Burkhard Nonnenmacher,10 helfen zu verstehen, dass Kants Religionsphilosophie eine wichtige Richtung seiner Epistemologie ist. (3) Die Untersuchungen zur Religionstheorie Schleiermachers aus einer philosophischen und dialektischen Perspektive machen die philosophischen Fragen hinter Schleiermachers Religionsphilosophie deutlich und bieten damit eine grundlegende Plattform für den Vergleich zwischen Kant und Schleiermacher. Dazu gehören die Schriften von Emil Schürer,11Andreas Arndt, John E. Thiel,12 Hans-Joachim Birkner13, Christian Albrecht14 u.a.
Es ist notwendig, kurz die hier angewandte Methode der Interpretation zu erklären. Für die Auslegung der Religionsphilosophie Kants gibt es zwei unterschiedliche Richtungen: Entweder man betrachtet Kants Religionsphilosophie als Anhängsel seiner Moralphilosophie und hält sie für unnötig oder man sieht sie als eine Bemühung, die spekulative und praktische Vernunft, die Natur- und Freiheitsordnung miteinander zu verbinden.15 Dann kann man sie sogar als seinen Kerngedanken betrachten.16 Diese Untersuchung betrachtet Kants Religionsphilosophie als sein Bestreben, Tugend und Glück, Freiheit und Natur, praktische und theoretische Vernunft miteinander zu verbinden, was geradewegs zu Schleiermachers Erbschaftsverhältnis zu Kant in verwandten Fragen führt.
Außerdem gibt es noch eine Forschungsmethode in Bezug auf Kant, die hier besonders hervorzuheben ist. Diese Methode geht von den kantischen vorkritischen Schriften aus und fügt die vorkritische Gotteslehre mit der Gotteslehre der kritischen Periode zusammen.17 Der Grund liegt darin, dass sich das transzendentale Ideal, welches eines der zentralen Themen in der Dialektik der KrV ist, aus dem Gottesbeweis in zwei vorkritischen Schriften – nämlich: Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio und Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes – entwickelt. Jedoch bedeutet diese Entwicklung eine Kritik Kants an seinem eigenen sogenannten „ontotheologischen Beweis“ der vorkritischen Zeit. Ausgehend davon ist es deutlicher zu erkennen, warum Kant die Existenz Gottes nicht direkt aus der Idee vom transzendentalen Ideal ableitet. Die vorliegende Untersuchung folgt dieser Methode.
Was die Interpretation der Religionsphilosophie Schleiermachers angeht, lege ich den Schwerpunkt auf die Dialektik bzw. auf seine philosophischen Schriften. Es gibt nur wenige Bücher, die Schleiermacher zu seinen Lebzeiten veröffentlicht hat. Davon sind die Reden und die Glaubenslehre die wichtigsten. Dadurch entsteht der Eindruck, dass Schleiermachers Gedanken auf die christliche Theologie konzentriert waren und sich in seinem Werk kaum metaphysische Schriften wie die Kritik der reinen Vernunft Kants, die Wissenschaftslehre Fichtes und die Logik Hegels finden. Nach dem Tod Schleiermachers (1834) führten Hegels Schüler F. C. Baur und D. F. Strauß in der Tat eine lange Debatte über das Verhältnis zwischen Philosophie und Theologie in Schleiermachers Werk.18 Zu einem gewissen Grad führt diese Debatte auf Schleiermachers eigenes theoretisches Ziel zurück. In der Schrift Kurze Darstellung des theologischen Studiums möchte er die philosophische Theologie aufrichten und „das Wesen der Frömmigkeit und der frommen Gemeinschaften im Zusammenhang mit den übrigen Tätigkeiten des menschlichen Geistes“ (§ 21) verstehen.19 Als Anfang der modernen Schleiermacher-Forschung versucht Diltheys Leben Schleiermachers (der erste Teil wurde im Jahr 1870 veröffentlicht), die Theologie und Philosophie Schleiermachers im Zusammenhang zu erklären. Diltheys Einfluss macht sich Anfang des 20. Jahrhunderts im Werk Troeltschs bemerkbar.20 Obwohl nach den 1920er Jahren die Dialektische Theologie und die Hermeneutik die Interpretation Schleiermachers beherrschten und scharfe Kritik an Schleiermacher formuliert haben, legten beide Denkrichtungen immer großen Wert auf das Verhältnis zwischen der Philosophie und der Theologie Schleiermachers.21 In den 1960er Jahren wurde der zweite Teils von Wilhelm Diltheys Schrift Schleiermachers System als Philosophie und Theologie veröffentlicht. Durch die gemeinsamen Bemühungen von Hans-Joachim Birkner, Eilert Herms,22 Manfred Frank,23 Andreas Arndt,24 Michael Eckert,25 Christian Albrecht usw. wird der Versuch, Schleiermachers Religionsphilosophie und Theologie aus seinem „allgemeinen System der Wissenschaften“ zu verstehen, immer mehr zum Mainstream, und es werden die Dialektik und die Ethik als konzentrierter Ausdruck seines wissenschaftlichen Systems betrachtet.26 Da das Thema dieser Dissertation auf das Problem der Unerkennbarkeit Gottes fokussiert ist, wird hier mehr auf Schleiermachers Dialektik geachtet.
0.3 Ziel und Kapiteleinteilung
Das Ziel dieser Untersuchung besteht darin, die metaphysischen Grundlagen der kantischen und schleiermacherschen Religionsphilosophien zu verdeutlichen und auf dieser Grundlage einen Vergleich durchzuführen. Meines Erachtens müssen diese Grundlagen in der Gotteslehre gesucht werden: Die Möglichkeit, Gott zu erkennen, die Art, wie man ihn erkennt, der Zugang zu Gott, müssen eine zentrale Rolle spielen. Ohne ihre Gotteslehre zu untersuchen und ohne auf diese Grundlage einzugehen, erscheint der Vergleich zwischen Kant und Schleiermacher nur oberflächlich. Damit verbunden ist ein weiteres Ziel dieser Untersuchung, nämlich die Missverständnisse über ihre Gotteslehre zu widerlegen. In den Forschungen über Kants Moraltheologie fehlt es immer an einer Untersuchung über seine transzendentale Theologie. Dadurch entsteht der Eindruck, dass Kant nur den aposteriorischen Beweis thematisiert, ohne eine Verbindung zwischen dem transzendentalen Ideal und der Moraltheologie vorzunehmen. Die Missverständnisse über Schleiermachers Religionstheorie sind vielfältig. Das berühmteste davon ist der Vorwurf, seine Religionstheorie sei nur subjektiv und mystisch. Dieses Missverständnis ist bis heute populär in der Heimat des Verfassers dieser Dissertation, in China. Nach diesem Missverständnis scheint Schleiermachers Religionsphilosophie der Religionstheorie von William James zu ähneln. Diese Untersuchung wird beweisen, dass die Suche nach Gott das wichtigste Ziel von Schleiermachers Religionsphilosophie ist. Außerdem möchte ich die Frage diskutieren, ob es möglich ist, eine Religion zu begründen, ohne Gott zu erkennen.