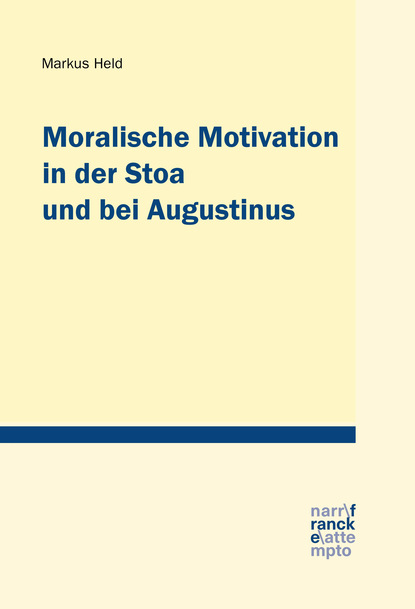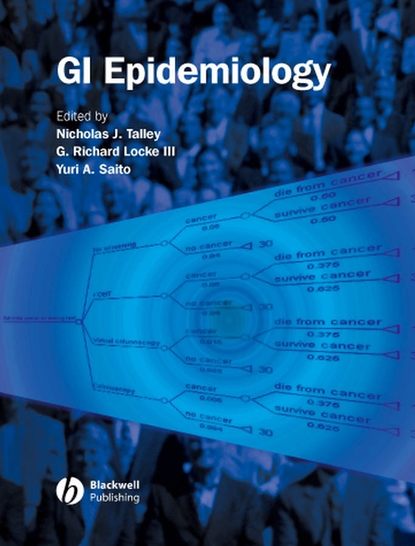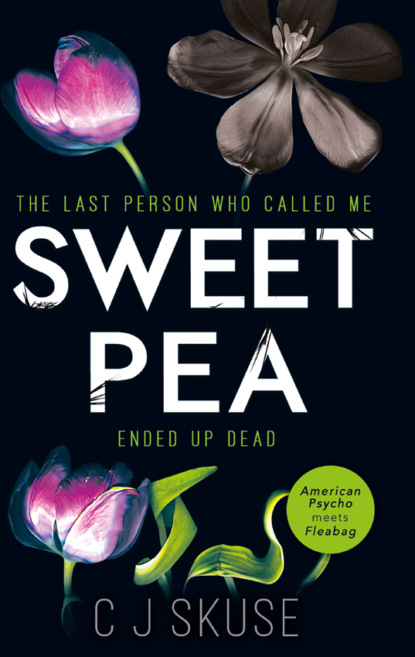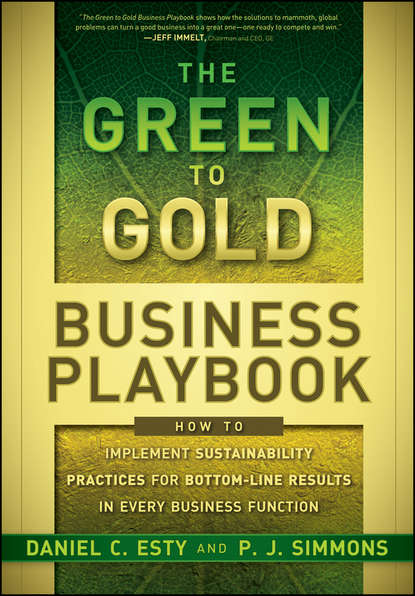Religionsbegründung ohne Erkenntnis Gottes
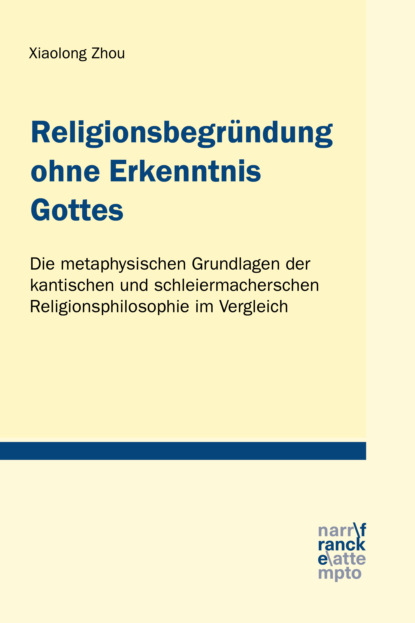
- -
- 100%
- +
(1) Kant weist darauf hin, dass alle Dinge zum Prinzip der durchgängigen Bestimmung gehören: „nach welchem ihm von allen möglichen Prädikaten der Dinge, so fern sie mit ihren Gegentheilen verglichen werden, eines zukommen muß.“3 Für Kant hat jedes reale Prädikat sein negatives Gegenteil, z. B. licht zu finster, gut zu böse usw. Außerdem steht jedes Wesen zwischen absoluter Realität und absoluter Negation (dem Nichts), nämlich, jedes Seiende ist partim realia, partim negativa, genau wie Kant in der Vorlesung über Rationaltheologie sagt:
„Ein jedes Ding muß etwas Positives haben, das ein Seyn in ihm ausdrückt. Ein bloßes Nichtseyn kann kein Ding konstituieren. Der Begriff de ente omni modo negativo ist der Begriff eines non entis. Da folglich ein jedes Ding Realität haben muß; so werden wir unter allen möglichen Dingen uns entweder ein ens realissimum oder ein ens partim reale, partim negativum vorstellen können […] Ein höchstes Ding wird als ein solches seyn müssen, das alle Realität hat; denn in diesem einzigen Falle habe ich ein solches Ding, mit dessen Begriffe zugleich seine durchgängige Bestimmung, weil es in Ansehung aller möglichen praedicatorum oppositorum durchaus vollständig bestimmt ist. Der Begriff eines entis realissimi ist folglich eben der Begriff eines entis summi, denn alle andere Dinge außer ihm sind partim realia, partim negativa, und eben daher ist ihr Begriff nicht durchgängig bestimmt.“4
Daraus können wir dreierlei schließen: das ens realissimum, das alle Realität beinhaltet und durch sich selbst durchgängig bestimmt wird; der Begriff de ente omni modo negativo, was keine Realität hat und ein Nichtsein ist; dazwischen sind andere Dinge, die partim realia, partim negativa sind und durch das ens realissimum durchgängig bestimmt werden. Hier benützt Kant ein Beispiel: vom Begriff eines vollkommensten Menschen können wir das Alter, die Größe und den Ausbildungsstand nicht bestimmen. Das will so viel sagen als: „um ein Ding vollständig zu erkennen, muß man alles Mögliche erkennen und es dadurch, es sei bejahend oder verneinend, bestimmen.“5 Das bedeutet, wir sollen „jedes Ding noch im Verhältniß auf die gesamte Möglichkeit [betrachten], als den Inbegriff aller Prädicate der Dinge überhaupt“,6 um ein Ding vollständig zu erkennen. Danach möchte Kant „den Inbegriff aller Prädicate der Dinge“ genauer bestimmen.
(2) „Der Inbegriff aller möglichen Prädikate“ ist nicht die Summa in Menge. Kants nächste Aufgabe besteht darin, den Inbegriff aller möglichen Prädikate zu verfeinern, das heißt, Prädikate auszuschließen, die nicht geeignet sind, die Prädikate des entis realissimi zu sein. Dazu sagt Kant: „so finden wir doch bei näherer Untersuchung, daß diese Idee als Urbegriff eine Menge von Prädicaten ausstoße, die als abgeleitet durch andere schon gegeben sind, oder neben einander nicht stehen können, und daß sie sich bis zu einem durchgängig a priori bestimmten Begriffe läutere und dadurch der Begriff von einem einzelnen Gegenstande werde.“7 Daraus folgt, dass das ens realissimum nicht direkt mit dem Inbegriff aller möglichen Prädikate identifiziert werden kann, weil jenes zwei Arten von Prädikaten dieses Inbegriffs ausschließt: die abgeleiteten Prädikate und die nicht nebeneinander stehenden Prädikate.8
Die abgeleiteten Prädikate, nämlich negative Prädikate, z. B. finster, arm und unwissend, können nur mit Hilfe der realen Prädikate, z. B. licht, reich und wissend, verstanden werden. Negative Prädikate können nur als Mangel der realen Prädikate betrachtet werden. Daher enthält das ens realissimum keine negativen Prädikate wie finster, arm und unwissend. Die nicht nebeneinander stehenden Prädikate bedeuten die mit den Prädikaten des entis realissimi nicht koexistierenden und in Widerspruch stehenden Prädikate. Dafür gibt Kant keine weitere Erklärung, aber wir können die Bedeutung von „nicht nebeneinander stehenden Prädikaten“ verstehen mit Hilfe der Realrepugnanz im Beweisgrund: „Die Undurchdringlichkeit der Körper, die Ausdehnung u.d.g. können nicht Eigenschaften von demjenigen sein, der da Verstand und Willen hat.“9 Das heißt, die körperlichen Attribute wie Undurchdringlichkeit und Ausdehnung stehen im Widerspruch zu spirituellen Attributen wie Verstand und Willen. Weil das ens realissimum die spirituellen Attribute hat, werden Prädikate wie Undurchdringlichkeit und Ausdehnung definitiv ausgeschlossen. Daher wird der Inbegriff aller möglichen Prädikate gereinigt und schließlich zur omnitudo realitatis. Dies bedeutet, dass die Idee von der omnitudo realitatis und damit auch das ens realissimum nicht die Summa oder das Aggregat aller Prädikate in der Menge ist.
(3) Durch den Beweis, dass der Inbegriff aller möglichen Prädikate dem Prinzip der durchgängigen Bestimmung zugrunde liegt, und durch die Verfeinerung des Inbegriffes kommt Kant zur omnitudo realitatis, dem „Urbegriff“, und daraus wird das ens realissimum geschlossen: „Es ist aber auch durch diesen Allbesitz der Realität der Begriff eines Dinges an sich selbst als durchgängig bestimmt vorgestellt, und der Begriff eines entis realissimi ist der Begriff eines einzelnen Wesens.“10
Jetzt können wir den Prozess mit dem Absatz der Reflexion zusammenfassen: „Das princip der durchgängigen Bestimmung sagt, daß der Begrif eines Dinges überhaupt, um die Vorstellung eines einzelnen auszumachen, mit allen moglichen praedicatis oppositis müsse verglichen werden, so daß, wenn es in ansehung eines bestimmt worden, es in dieser Bestimmung mit andern praedicatis oppositis verglichen werden müsse und es also als Ding überhaupt durch das Verhaltnis zum ente realissimo allein bestimmt gedacht werden könne. Dadurch geschieht, daß ein allgemeiner Begrif sich selbst durchgängig bestimmt und ein Begrif eines einzelnen Wesens wird.“11 Folglich bestimmt Kant durch das Prinzip der durchgängigen Bestimmung und die Verfeinerung des Inbegriffes aller möglichen Prädikate Gott als das ens realissimum, der als Gegenstand der transzendentalen Theologie betrachtet wird.
1.2.2 Die Prädikate des „entis realissimi“
In Abschnitt 1.2.1 haben wir gesehen, dass Kant mit Hilfe seiner transzendentalen Methode Gott als das ens realissimum denkt. Jetzt kann thematisiert werden, wie Kant die Eigenschaften des entis realissimi definiert. Hinsichtlich des Themas dieser Untersuchung sind die Eigenschaften Gottes eben unsere Erkenntnis von Gott.
Zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass im 2. Abschnitt des Theologie-Hauptstückes Kant das ens realissimum auch ens orginarium, ens summum und ens entium nennt: „Daher wird der bloß in der Vernunft befindliche Gegenstand ihres Ideals auch das Urwesen (ens originarium), so fern es keines über sich hat, das höchste Wesen (ens summum), und so fern alles als bedingt unter ihm steht, das Wesen aller Wesen (ens entium) genannt.“1 Was diese Bestimmungen eigentlich bedeuten, ist hier von Kant nicht deutlich erklärt, daher ist es nötig, sich auf den Inhalt der Vorlesung über Rationaltheologie zu beziehen:
„In dieser Erkenntnis von Gott aus reinen Begriffen haben wir drei konstitutive Begriffe von Gott; nämlich:
1) Als das Urwesen (ens originarium). Hier denke ich mir Gott überhaupt als ein Ding, das von keinem anderen abgeleitet ist, als das ursprüngliche Wesen, das einzige, was nicht derivativ ist […] Dieser Begriff eines entis originarii liegt zum Grunde der Kosmotheologie […]
2) Als das höchste Wesen (ens summum). Hier denke ich mir Gott als ein Wesen, das alle Realität hat, und leite eben aus dem Begriffe eines solchen entis realissimi […] Dieser Begriff von Gott, als einem ente maximo, ist Fundament der Ontotheologie.
3) Als Wesen aller Wesen (ens entium). Hier denke ich mir Gott nicht nur als das für sich ursprüngliche Wesen, das von keinem andern abgeleitet ist, sondern auch als den höchsten Grund aller anderen Dinge, als dasjenige Wesen, von dem alles andere abgeleitet ist. Diese können wir seine Allgenugsamkeit nennen.“2
In diesem Absatz werden die drei Bestimmungen weiter festgehalten: das ens originarium (das Urwesen) bezeichnet ein derivatives Verhältnis anderer Dinge aus Gott und liegt der Kosmotheologie zugrunde; das ens summum wird direkt aus dem Begriff des entis realissimi abgeleitet und ist Fundament der Ontotheologie3; und mit dem enti entium denkt Kant Gott als den höchsten Grund aller anderen Dinge. Folglich beschreiben diese drei Bestimmungen jeweils die absolute Notwendigkeit, höchste Vollkommenheit, Ursprünglichkeit und Allgenugsamkeit4 Gottes. Daraus ist zu ersehen, dass der Begriff des entis realissimi das Fundament der Kosmotheologie und Ontotheologie begründet.
Im Folgenden möchte ich einen oben zitierten Absatz nochmals überprüfen: „Wenn wir nun dieser unserer Idee, indem wir sie hypostasieren, so ferner nachgehen, so werden wir das Urwesen durch den bloßen Begriff der höchsten Realität als ein einiges, einfaches, allgenugsames, ewiges etc., mit einem Worte, es in seiner unbedingten Vollständigkeit durch alle Prädicamente bestimmen können.“5 Ich möchte an dieser Stelle zwei Fragen stellen: (1) Was heißt „wir […] es […] durch alle Prädicamente bestimmen können“? (2) Welche Prädikate besitzt diese Idee? In Hinsicht auf (1) habe ich gesagt, dass das ens realissmum schon die abgeleiteten und nicht nebeneinander stehenden Prädikate aus seinen Prädikaten ausschließt, weshalb man es nicht durch alle Prädikate bestimmen kann, z. B. Finsternis, Ausdehnung gehören niemals zu seinen Prädikaten. Dies ist zunächst zu klären. Was (2) anbelangt, sind viele Prädikate erwähnt, etwa Einigkeit, Allgenugsamkeit, Ewigkeit usw. Hier handelt es sich um transzendentale Prädikate, die ein Ding überhaupt bestimmen; diese gehören zu den Eigenschaften Gottes.6 An dieser Stelle können nicht alle Prädikate aufgezählt werden, da dies nicht die Hauptaufgabe dieser Untersuchung darstellt.
In diesem Anschnitt wurden bisher viele Prädikate des entis realissimi benannt. Nun werde ich mich auf drei Tatsachen beziehen, die für die folgende Ausführung bedeutsam sind:
(1) Die Denkweise Kants ist folgendermaßen: Zuerst wird das ens realissimum bewiesen und dann werden seine transzendentalen Prädikate betrachtet. Allerdings ist die Denkweise im Beweisgrund ganz anders: In dieser Schrift wird die Existenz eines entis necessarii zuerst festgehalten, dann kommt ihm die höchste Realität zu. Das ist der Grund, warum Dieter Henrich betont, dass die Denkweise im Beweisgrund von der kosmologischen Frage bestimmt wird, so dass das ens necessarium im Zentrum der kantischen Theorie steht.7 Deswegen ergibt sich eine umstrittene Frage: Gehört die Notwendigkeit auch zu den Prädikaten des entis realissimi? Wenn ja, bedeutet dies dann, dass das ens realissimum notwendig existiert? Diese Frage wird im 2. Kapitel beantwortet.
(2) Unter den oben genannten transzendentalen Prädikaten taucht die Intelligenz nicht auf, weder in der KrV noch in der Vorlesung über Rationaltheologie.8 Im 7. Abschnitt des Theologie-Hauptstückes unterscheidet Kant die transzendentale Theologie von der natürlichen Theologie, die sich ihren Gegenstand „durch einen Begriff, den sie aus der Natur (unserer Seele) entlehnt, als die höchste Intelligenz“9 denkt. D.h. die Intelligenz stammt aus der Erfahrung, daher ist sie nicht transzendental. Danach sagt Kant: „Der zweite [sc. die natürliche Theologie] behauptet, die Vernunft sei im Stande, den Gegenstand nach der Analogie mit der Natur näher zu bestimmen, nämlich als ein Wesen, das durch Verstand und Freiheit den Urgrund aller anderen Dinge in sich enthalte.“10 Daraus folgt, dass die Intelligenz Gottes nicht durch bloße Vernunft bestimmt wird, sondern durch Analogie mit der Erfahrung (Natur). Was dies bedeutet und wie dies sich entwickelt, werde ich in Abschnitt 1.3 genau interpretieren.
(3) Im 7. Abschnitt des Theologie-Hauptstückes weist Kant insbesondere darauf hin, dass „das Dasein außer der Welt (nicht als Weltseele)“ ein transzendentales Prädikat des entis realissimi ist.11 Außerdem können wir beobachten, dass Kant Gott oft als das ens extramundanum definiert.12 In Abschnitt 1.2.1 wurde das ens realissimum als Verfeinerung des Inbegriffes aller möglichen Prädikate bestimmt. In der nova dilucidatio scheint Kant den Inbegriff aller möglichen Prädikate mit Gott direkt zu identifizieren. Dies kann zu einem Pantheismus führen. Danach hält Kant im Beweisgrund deutlich fest, dass die Beziehung zwischen allen Dingen und Gott die zwischen Grund und Folge ist, um das Resultat des Pantheismus zu vermeiden.13 Folglich möchte ich darauf hinweisen, dass die Ursache der Bestimmung Gottes als ens extramundanum darin begründet ist, den Pantheismus zu vermeiden. Wir werden die Bedeutung dieser Überlegung Kants im Vergleich mit Schleiermacher genauer veranschaulichen.
An dieser Stelle möchte ich Abschnitt 1.2 zusammenfassen. Kant gibt in seiner kritischen Periode seine ontotheologische Methode nicht auf und wendet diese transzendentale Methode auf die Versuche an, Gottes Eigenschaften bloß durch die Vernunft zu bestimmen, ohne die Erfahrung zu berücksichtigen. Folglich bestimmt Kant Gott, der als ein Ding überhaupt betrachtet wird, als ens orginarium, ens summum und ens entium. Daneben kommen Gott viele andere transzendentale Prädikate zu, die hier nicht ausführlich genannt werden. Es wurde gezeigt, dass die Frage, ob die Notwendigkeit ein Prädikat des entis realissimi ist, noch offen ist. Außerdem ist es wichtig, hier zu betonen, dass die Intelligenz als das Prädikat Gottes nicht direkt aus dem Begriff des entis realissimi abgeleitet ist.
1.3 Die analogische Methode
Das Problem der Analogie ist eine wichtige, aber doch immer vernachlässigte Frage.1 Allerdings spielt sie in der kantischen Philosophie oft eine wichtige Rolle. Ich nenne dafür einige Beispiele. In der Transzendentalen Analytik der KrV interpretiert Kant Begriffe wie Substanz, Kausalität und Gemeinschaft mit einer „Analogie der Erfahrung“. In der Transzendentalen Dialektik der KrV, in den Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik (im Folgenden als Prolegomena bezeichnet) und in der KU ist die Analogie immer ein wichtiger Weg für die endliche Vernunft, um Gottes Intellekt (Verstand und Willen) zu erkennen, was auch das Thema dieser Dissertation ist. Gleichzeitig ist die Analogie eng mit Kants reflektierendem Urteil verbunden. Der regulative Gebrauch der Vernunftidee, der uns sehr gut bekannt ist, ist untrennbar von der Analogie. Man kann sagen, dass ohne ein Verständnis der Analogie das regulative Prinzip Kants nicht verstanden werden kann.2
Kurz bevor Kant beginnt, Gott als Ideal zu interpretieren, schreibt er am Ende der Schlußanmerkung zur ganzen Antinomie der reinen Vernunft: „Weil aber, wenn wir uns einmal die Erlaubniß genommen haben, außer dem Felde der gesammten Sinnlichkeit eine für sich bestehende Wirklichkeit anzunehmen, Erscheinungen nur als zufällige Vorstellungsarten intelligibeler Gegenstände von solchen Wesen, die selbst Intelligenzen sind, anzusehen sind: so bleibt uns nichts anders übrig als die Analogie, nach der wir die Erfahrungsbegriffe nutzen, um uns von intelligibelen Dingen, von denen wir an sich nicht die mindeste Kenntniß haben, doch irgend einigen Begriff zu machen.“3 Hierin verbirgt sich eine Gesamtkonzeption der Analogie. Wie man aber mit Hilfe der Analogie Gott, bzw. die Intelligenz Gottes, erkennen kann, werde ich in diesem Abschnitt versuchen aufzuzeigen. Dieser Abschnitt wird wie folgt unterteilt: Zuerst werde ich in Abschnitt 1.3.1 mit Hilfe der Auffassungen in den Prolegomena, der KU und der Vorlesung über Rationaltheologie einige grundlegende Punkte der Analogie verdeutlichen, die im Anhang zur transscendentalen Dialektik der KrV diskutiert werden. Wenn geklärt ist, wie die Eigenschaft Gottes (Intelligenz) durch die Analogie erkannt wird, kann in Kapitel 3.2 die weitere Analyse erfolgen.
1.3.1 Die Analogie als eine Methode der Erkenntnis
Der Anhang zur transzendentalen Dialektik der KrV ist in zwei Teile gegliedert, nämlich Von dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen Vernunft und Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft. In diesem Anhang behandelt Kant ausführlich die Theorie der Analogie. Er weist in Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft darauf hin, dass es insgesamt zwei unterschiedliche Gegenstände gibt: „Es ist ein großer Unterschied, ob etwas meiner Vernunft als ein Gegenstand schlechthin, oder nur als ein Gegenstand in der Idee gegeben wird.“1 Deswegen haben wir entsprechend zwei Methoden, den Gegenstand zu bestimmen:
„In dem ersteren Falle gehen meine Begriffe dahin, den Gegenstand zu bestimmen; im zweiten ist es wirklich nur ein Schema, dem direct kein Gegenstand, auch nicht einmal hypothetisch zugegeben wird, sondern welches nur dazu dient, um andere Gegenstände vermittelst der Beziehung auf diese Idee nach ihrer systematischen Einheit, mithin indirect uns vorzustellen.“2
Einen Gegenstand schlechthin, bzw. einen realen Gegenstand, kann man direkt mit den Kategorien des Verstandes bestimmen. Allerdings ist der in der Idee gegebene Gegenstand nur ein Schema, der daher nicht direkt bestimmt wird, sondern nur indirekt „vermittelst der Beziehung auf diese Idee nach ihrer systematischen Einheit“. Es ist bekannt, dass in der Analytik der Grundsätze der KrV das Schema eng mit dem Verstandesbegriff verbunden ist, was also bedeutet „Schema“ an dieser Stelle?
Hier wende ich mich der anderen Deduktion der Vernunftidee zu, von der in Von dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen Vernunft gesprochen worden ist. Genau wie sich Kant in Von der Deduction der reinen Verstandesbegriffe mit der objektiven Gültigkeit der Kategorien beschäftigt hat, möchte er auch hier die objektive Gültigkeit der Idee beweisen. Für eine Deduktion der Verstandesbegriffe oder der Kategorien hat man ein Schema in der Anschauung gefunden, doch für eine Deduktion der Vernunftidee ist der Fall ganz anders:
„Allein obgleich für die durchgängige systematische Einheit aller Verstandesbegriffe kein Schema in der Anschauung ausfindig gemacht werden kann, so kann und muß doch ein Analogon eines solchen Schema gegeben werden, welches die Idee des Maximums der Abtheilung und der Vereinigung der Verstandeserkenntniß in einem Princip ist […] Also ist die Idee der Vernunft ein Analogon von einem Schema der Sinnlichkeit, aber mit dem Unterschiede, daß die Anwendung der Verstandesbegriffe auf das Schema der Vernunft nicht eben so eine Erkenntniß des Gegenstandes selbst ist (wie bei der Anwendung der Kategorien auf ihre sinnliche Schemate), sondern nur eine Regel oder Princip der systematischen Einheit alles Verstandesgebrauchs.“3
In diesem Paragraphen sagt Kant sehr klar, dass „die Idee der Vernunft ein Analogon von einem Schema der Sinnlichkeit“ ist. Daraus folgt, dass der in der Idee gegebene Gegenstand für Kant nur ein Schema ist, doch kein sinnliches Schema, das „in der Anschauung ausfindig gemacht werden kann“, sondern nur ein Analogon des sinnlichen Schemas.4 Kant drückt hier aus, dass der Gegenstand der Idee nicht direkt durch Kategorien vorgestellt werden kann, doch dass dieser Gegenstand ein Analogon zu einem sinnlichen Gegenstand in Hinsicht auf eine systematische Einheit ist, die die Idee bedeutet. Daraus kann abgeleitet werden, dass der Gegenstand der Idee nur durch eine Analogie erklärt werden kann.
In der „Analogie der Erfahrung“ der Analytik der Grundsätze der KrV findet sich ein sehr wichtiger Absatz, der von der Analogie handelt:
„In der Philosophie bedeuten Analogien etwas sehr Verschiedenes von demjenigen, was sie in der Mathematik vorstellen. In dieser sind es Formeln, welche die Gleichheit zweier Größenverhältnisse aussagen, und jederzeit constitutiv, so daß, wenn drei Glieder der Proportion gegeben sind, auch das vierte dadurch gegeben wird, d.i. construirt werden kann. In der Philosophie aber ist die Analogie nicht die Gleichheit zweier quantitativen, sondern qualitativen Verhältnisse, wo ich aus drei gegebenen Gliedern nur das Verhältniß zu einem vierten, nicht aber dieses vierte Glied selbst erkennen und a priori geben kann, wohl aber eine Regel habe, es in der Erfahrung zu suchen, und ein Merkmal, es in derselben aufzufinden.“5
Ich möchte zuerst darauf hinweisen, dass der regulative Gebrauch eine enge Beziehung zur Analogie hat. Diese Tatsache wird eine hilfreiche Perspektive für das Thema dieser Untersuchung sein. Nun kann Kants Meinung wieder in zwei Teile gegliedert und analysiert werden: (1) Die Analogie bezieht sich nicht auf „die Gleichheit zweier quantitativen, sondern qualitativen Verhältnisse“. (2) Aus drei gegebenen Gliedern wird das vierte Glied nicht gegeben, sondern nur das Verhältnis zu diesem vierten Glied. Im Folgenden werde ich diese Punkte weiter veranschaulichen.
(1) Wenn in der Mathematik a : b = c : x gegeben ist, können wir unzweifelhaft schließen, dass x = b ^ c / a ist. Solange a nicht gleich Null ist, erhalten wir definitiv den Wert von x. Die Analogie der Philosophie ist jedoch keineswegs quantitativ gemeint. Diese Auffassung drückt Kant auch in den Prolegomena aus: „Eine solche Erkenntniß ist die nach der Analogie, welche nicht etwa, wie man das Wort gemeiniglich nimmt, eine unvollkommene Ähnlichkeit zweier Dinge, sondern eine vollkommne Ähnlichkeit zweier Verhältnisse zwischen ganz unähnlichen Dingen bedeutet.“6 Denn was hier im Zentrum steht, ist die Ähnlichkeit zweier Verhältnisse, genauer gesagt: Das Verhältnis von a zu b ist dem von c zu x ähnlich. Um dies besser zu verstehen, wird die Anmerkung Kants zu diesem Absatz analysiert. Hier nennt Kant zwei Beispiele: Erstens gibt es eine Analogie zwischen den rechtlichen Verhältnissen menschlicher Handlungen und den mechanischen Verhältnissen der bewegenden Kräfte, weil alle wissen, dass das Recht eines Menschen gegenüber einem anderen dasselbe ist wie die Wirkung und Gegenwirkung. D.h. das Verhältnis hat eine Ähnlichkeit. So behauptet Kant: „Vermittelst einer solchen Analogie kann ich daher einen Verhältnißbegriff von Dingen, die mir absolut unbekannt sind, geben.“7 Zudem wird noch ein anderes Beispiel beschrieben, das direkt mit unserem Thema verbunden ist: „wie sich verhält die Beförderung des Glücks der Kinder = a zu der Liebe der Eltern = b, so die Wohlfahrt des menschlichen Geschlechts = c zu dem Unbekannten in Gott = x, welches wir Liebe nennen.“8 Kant betont hier, dass, obwohl Gott uns unbekannt ist, das Verhältnis seiner Liebe zur Wohlfahrt dem Verhältnis der Liebe der Eltern zur Beförderung des Glückes der Kinder ähnlich ist.
(2) Jetzt kann festgestellt werden, dass es bei a : b = c : x eine Ähnlichkeit des Verhältnisses gibt. Somit werden, wenn auch das unbekannte x nicht direkt bestimmt oder erkannt werden kann, doch seine Eigenschaften durch die Analogie festgehalten. Jetzt stellt sich die Frage, um welch ein Verhältnis es hier geht. In den Prolegomena sagt Kant deutlich: „Der Verhältnißbegriff aber ist hier eine bloße Kategorie, nämlich der Begriff der Ursache.“9 D.h. die Gleichung a : b = c : x wird aufgestellt, weil die Kausalität zwischen a und b und die Kausalität zwischen c und x analog sind. Die Behauptung wird in der KU von Kant noch weiter ausgeführt:
„Analogie (in qualitativer Bedeutung) ist die Identität des Verhältnisses zwischen Gründen und Folgen (Ursachen und Wirkungen) […] So denken wir uns zu den Kunsthandlungen der Thiere in Vergleichung mit denen des Menschen den Grund dieser Wirkungen in den ersteren, den wir nicht kennen, mit dem Grunde ähnlicher Wirkungen des Menschen (der Vernunft), den wir kennen, als Analogon der Vernunft; und wollen damit zugleich anzeigen: daß der Grund des thierischen Kunstvermögens unter der Benennung eines Instincts von der Vernunft in der That specifisch unterschieden, doch auf die Wirkung (der Bau der Biber mit dem der Menschen verglichen) ein ähnliches Verhältniß habe. Deswegen aber kann ich daraus, weil der Mensch zu seinem Bauen Vernunft braucht, nicht schließen, daß der Biber auch dergleichen haben müsse, und es einen Schluß nach der Analogie nennen.“10