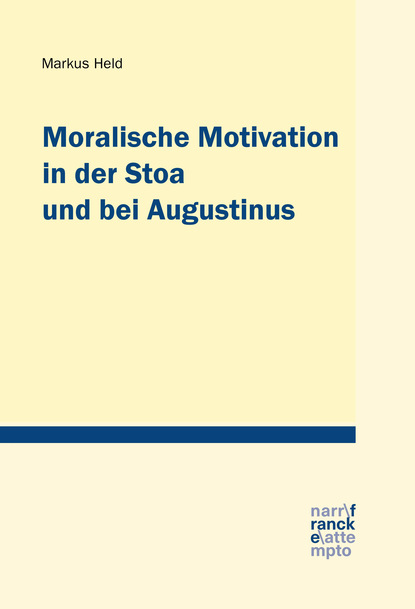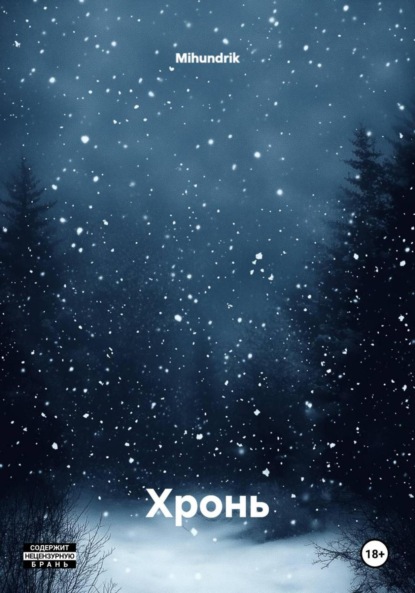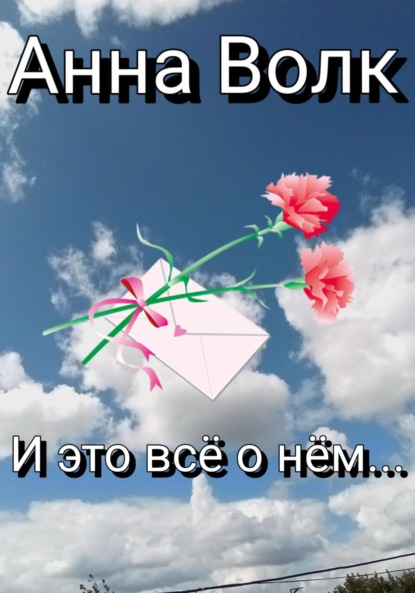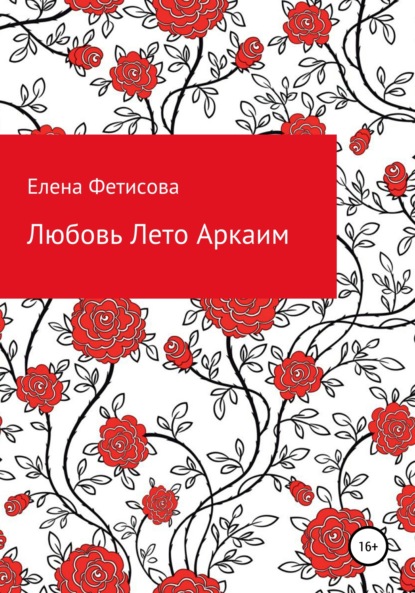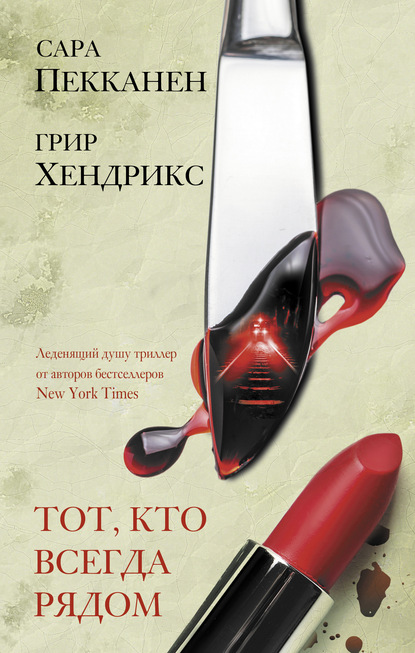Religionsbegründung ohne Erkenntnis Gottes
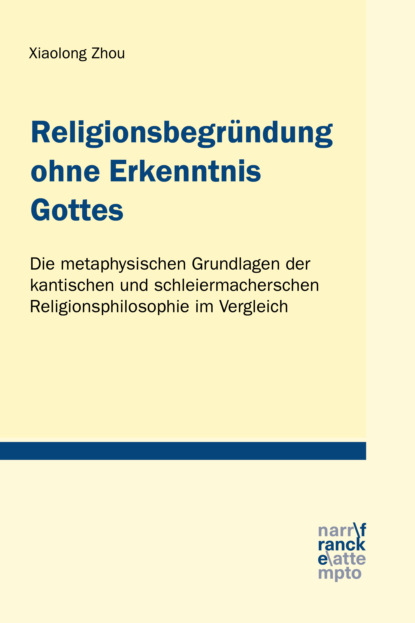
- -
- 100%
- +
Hier weist Kant deutlich darauf hin: „Analogie (in qualitativer Bedeutung) ist die Identität des Verhältnisses zwischen Gründen und Folgen (Ursachen und Wirkungen).“ Dementsprechend änderte Sebastian Maly die obige Formel in U1 : W1 = U2 : W2. Dabei steht „U“ für Ursache, „W“ für Wirkungen, und diese Analogie wird „Proportionalitätsanalogie“ genannt.11 In Abschnitt 1.4 wird deutlich werden, dass Kant dazu neigt, das Verhältnis zwischen Gott und Welt als das zwischen Grund und Folge zu bestimmen. Aus diesem Grund bevorzuge ich hier die Formel G1 : F1 = G2 : F2. Im obigen Beispiel wies Kant darauf hin, dass sich die Kunsthandlungen des Bibers auch auf ein „Analogon der Vernunft“ stützen, da menschliche Kunsthandlungen als Konsequenz auf der menschlichen Vernunft beruhen. Wir können aber nicht daraus schließen, dass der Biber eine solche Vernunft besitzt. In dieser Formel können G1, F1, F2 durch Erfahrung erlernt sein, aber wir haben für G2 keine sinnliche Anschauung und Intuition, so dass wir nicht wissen können, ob es wirklich existiert, und was wir hervorgebracht haben, sind nicht die Eigenschaften der Sache selbst. Aber analog können wir uns G2 als Analogon von G1 vorstellen.
An dieser Stelle fasse ich die Punkte (1) und (2) wie folgt zusammen: Analogie ist für Kant eine wichtige Methode, ein unbekanntes Ding x zu erkennen. Doch kann x nicht direkt bestimmt werden, folglich soll man x in ein Verhältnis setzen. X wird als Grund von c bestimmt, das kausale Verhältnis ist dem zwischen Grund b und Folge a ähnlich. Damit können wir eine indirekte Erkenntnis von x erhalten. Damit kann eine indirekte Erkenntnis von x erzielt werden. Natürlich wird Kant nicht müde zu betonen, dass diese Erkenntnis nicht gewiss und diskursiv ist.
1.3.2 Die Intelligenz Gottes durch die Analogie erkennen
Im Folgenden wird veranschaulicht, wie der analogische Ansatz verwendet wird, um Gott zu verstehen. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Kants Ansatz darin besteht, aus der Erfahrung ein Prädikat zu wählen, das zu Gott passt. So behauptet Kant in den Prolegomena: „denken wir es uns durch Eigenschaften, die von der Sinnenwelt entlehnt sind, so ist es nicht mehr Verstandeswesen, es wird als eines von den Phänomenen gedacht und gehört zur Sinnenwelt.“1 Diese Methode unterscheidet sich grundsätzlich von der transzendentalen Vorgehensweise. An dieser Stelle komme ich auf den Anhang zur transscendentalen Dialektik zurück:
„Ich werde mir also nach der Analogie der Realitäten in der Welt, der Substanzen, der Causalität und der Nothwendigkeit, ein Wesen denken, das alles dieses in der höchsten Vollkommenheit besitzt, und, indem diese Idee bloß auf meiner Vernunft beruht, dieses Wesen als selbstständige Vernunft, was durch Ideen der größten Harmonie und Einheit Ursache vom Weltganzen ist, denken können, so daß ich alle die Idee einschränkende Bedingungen weglasse, lediglich um unter dem Schutze eines solchen Urgrundes systematische Einheit des Mannigfaltigen im Weltganzen und vermittelst derselben den größtmöglichen empirischen Vernunftgebrauch möglich zu machen, indem ich alle Verbindungen so ansehe, als ob sie Anordnungen einer höchsten Vernunft wären, von der die unsrige ein schwaches Nachbild ist.“2
Diese Passage umfasst den gesamten Prozess der Analogie. Dadurch wird die Intelligenz Gottes erkannt: (1) Um die systematische Einheit der Welt als möglich zu denken, muss ich diese so betrachten, als ob sie aus der Anordnung einer höchsten Vernunft stamme. (2) Dies liegt daran, dass ich mir durch meine Vernunft vorstellen kann, dass Gott eine selbstständige Vernunft hat. (3) Aber die Vernunft Gottes ist meiner Vernunft nicht direkt gleichwertig, weil ich alle Bedingungen beseitigen muss, die diese Vorstellung einschränken, so dass unsere Vernunft nur das Abbild der höchsten Vernunft ist. Diese drei Punkte müssen aber im Folgenden noch geklärt werden.
(1) Der Begriff der systematischen Einheit der Welt findet sich überall in den kantischen Schriften. Kant nennt sie auch die Ordnung und Zweckmäßigkeit der Welteinrichtung, eine zweckmäßige Einheit, die eine enge Beziehung mit dem regulativen Gebrauch hat. Das ist eine umfangreiche und sehr schwierige Frage, die hier nicht ausführlich interpretiert werden kann.
Doch möchte ich hinzufügen, dass Kant schon in seiner vorkritischen Periode versucht hat, von der systematischen Einheit der Welt aus die Existenz Gott zu beweisen, vorwiegend in der Naturgeschichte und im Beweisgrund. In Abschnitt 1.1 haben wir eine Passage aus der Naturgeschichte zitiert, die eine kantische Physikotheologie darstellt. Kant denkt zu dieser Zeit die systematische Einheit der Welt als das Ergebnis der Mechanik. Im Gegensatz dazu stellt Kant außerdem im Beweisgrund auch das organische Gesetz vor Augen, weil er meint, dass bloße Mechanik für die Interpretation der Entstehung des Organismus nicht ausreichend ist. Außerdem teilt Kant die Abhängigkeit aller Dinge von Gott in „moralische“ und „unmoralische“ Abhängigkeit auf: „Ich nenne diejenige Abhängigkeit eines Dinges von Gott, da er ein Grund desselben durch seinen Willen ist, moralisch, alle übrige aber ist unmoralisch.“3 Diese bezieht sich auf anorganische Materie, die sich einer notwendigen Naturordnung unterwirft, jene auf einen Organismus, der sich einer künstlichen Naturordnung unterwirft. Doch im Beweisgrund fungieren notwendige und künstliche Naturordnung nicht, wie es in der Naturgeschichte geschieht, als Grund für das Dasein Gottes, sondern nur als Bezeichnung der systematischen Welt.
Obwohl Kant den physikotheologischen Beweis aufgibt, bleibt die Betrachtung der Welt als systematischer Einheit, bleibt auch die physikotheologische Methode, um Gott zu erkennen. Im Anhang zur transscendentalen Dialektik der KrV formuliert Kant die Beziehung zwischen der systematischen Einheit der Welt und der Anordnung Gottes: „Die höchste formale Einheit, welche allein auf Vernunftbegriffen beruht, ist die zweckmäßige Einheit der Dinge, und das speculative Interesse der Vernunft macht es nothwendig, alle Anordnung in der Welt so anzusehen, als ob sie aus der Absicht einer allerhöchsten Vernunft entsprossen wäre.“4 Daraus können wir nicht schließen, dass Kant die Physikotheologie wieder aufgegriffen hat. Ich möchte nur betonen, dass die analogische Methode eng mit dem regulativen Gebrauch und der Physikotheologie verbunden ist.
(2) Ausgehend von der systematischen Einheit der Welt betrachtet Kant Gott jetzt als die höchste Vernunft oder Intelligenz. Unzweifelhaft wird hier die Analogie benutzt. Gottes Intelligenz ist ein Analogon unserer Intelligenz. In den Prolegomena schreibt Kant das Folgende:
Wenn ich sage: wir sind genöthigt, die Welt so anzusehen, als ob sie das Werk eines höchsten Verstandes und Willens sei, so sage ich wirklich nichts mehr als: wie sich verhält eine Uhr, ein Schiff, ein Regiment zum Künstler, Baumeister, Befehlshaber, so die Sinnenwelt (oder alles das, was die Grundlage dieses Inbegriffs von Erscheinungen ausmacht) zu dem Unbekannten, das ich also hiedurch zwar nicht nach dem, was es an sich selbst ist, aber doch nach dem, was es für mich ist, nämlich in Ansehung der Welt, davon ich ein Theil bin, erkenne.5
Diese Passage ist eine typische Erklärung für die Anwendung der Analogie. Nach der oben genannten Formel G1 : F1 = G2 : F2 repräsentiert G1 hier die Intelligenz des Künstlers, Baumeisters, Befehlshabers, F1 deren Werke, etwa eine Uhr, ein Schiff, ein Regiment. G1 verhält sich zu F1 genau wie G2 (die Intelligenz Gottes: Verstand und Willen) zu F2 (dem Werk Gottes bzw. der systematischen Einheit der Welt). Daraus folgt, dass Gott die höchste Intelligenz ist. Genau wie in der KU weist Kant darauf hin, dass wir den Biber als ein vernünftiges Tier durch die Analogie mit dem Menschen denken können und er fügt noch hinzu: „Eben so kann ich die Causalität der obersten Weltursache in der Vergleichung der zweckmäßigen Producte derselben in der Welt mit den Kunstwerken des Menschen nach der Analogie eines Verstandes denken.“6
Interessanterweise verwendet Kant in den Prolegomena die gleichen Beispiele wie im sechsten Abschnitt des Theologie-Hauptstückes, wo er eine Rekonstruktion des physikotheologischen Beweises durchführt.7 Dies ist auch eine weitere Quelle, die als Beweis dafür gilt, dass Kant die analogische und physikotheologische Methode zur Erkenntnis Gottes nicht aufgibt.
(3) Durch die Analogie können wir jetzt feststellen, dass die Intelligenz eine Eigenschaft von Gott ist, oder dass es eine höchste Vernunft und Intelligenz gibt. Allerdings wollen wir die höchste Intelligenz ausführlicher diskutieren. Ähnlich wie die Intelligenz der Biber, die nur ein Analogon der Intelligenz der Menschen ist, so ist die menschliche Intelligenz niemals identisch mit der Intelligenz Gottes. In kantischer Terminologie wird die höchste Intelligenz Gottes als intellectus archetypus betrachtet: „Eben dieselbe Idee ist also für uns gesetzgebend, und so ist es sehr natürlich, eine ihr correspondirende gesetzgebende Vernunft (intellectus archetypus) anzunehmen, von der alle systematische Einheit der Natur als dem Gegenstande unserer Vernunft abzuleiten sei.“8 Die Differenz des intellecti archetypi zu unserer Intelligenz wird in der Vorlesung über Rationaltheologie deutlich veranschaulicht:
„Nun giebt es aber in der ganzen Welt kein Ding, was reine Realität hätte, sondern alle Dinge, die uns durch die Erfahrung können gegeben werden, sind partim realia, partim negativa […] Gott aber können solche Negationen nicht beigeleget werden, daher muß ich zuerst via negationis verfahren, d.h. ich muß alles Sinnliche, was meinen Vorstellungen von dieser oder jener Realität inhäriert, sorgfältig absondern, alles Unvollkommene, alles Negative weglassen, und das reine Reale, was übrig bleibt, Gott beilegen […] Auf solche Art werde ich zwar via negationis die Qualität der göttlichen Prädikate bestimmen können, d.h. welche Prädikate ich aus der Erfahrung, nach Absonderung aller Negation, auf meinen Begriff von Gott anwenden kann, aber dadurch würde ich noch gar nicht die Quantität dieser Realität in Gott erkennen lernen […] Daher muß ich nun, wenn ich in einer von den Eigenschaften der Dinge, die mir durch die Erfahrung gegeben sind, irgend eine Realität angetroffen habe, dieses Reale Gott im höchsten Grade, in unendlicher Bedeutung, beilegen. Das nennet man per viam eminentiae verfahren.“9
Da diese Eigenschaft, nämlich die Intelligenz, aus der Erfahrung und der Sinnenwelt stammt, ist sie nicht völlige Realität, weil die sinnlichen Dinge partim realia, partim negativa sind. Deswegen ist es nötig, alles Unvollkommene und alles Negative wegzulassen. Hier geht Kant zwei verschiedene Wege: die via negationis und die via eminentiae. Die via eminentiae bezeichnet den quantitativ höchsten Grad von den Eigenschaften Gottes, die via negationis sondert die negativen Elemente der aus der Erfahrung erhaltenen Prädikate ab. Danach kann bestimmt werden, dass Gott als intellectus archetypus sich qualitativ und quantitativ von unserer endlichen und abgeleiteten Intelligenz unterscheidet. Dazu ist zu bemerken, dass dies eine entscheidende Maßnahme ist, die Kant ergriffen hat, um zu vermeiden, in einen groben Anthropomorphismus zu geraten.
Zu Abschnitt 1.3 kann zusammenfassend gesagt werden: Obwohl Kant seinen physikotheologischen Beweis aufgegeben hat, bedeutet dies nur, dass Physikotheologie nicht imstande ist, die Existenz Gottes zu beweisen, doch wird die Gottesidee dennoch regulativ gebraucht. Durch eine aposteriorische Methode bzw. die Analogie wird Gott als die höchste Intelligenz bestimmt, d.h. die Eigenschaft der Intelligenz kommt Gott zu.
1.4 Die Ideen Gottes als das Substratum für die Materie und Form der Welt
In den Abschnitten 1.2 und 1.3 habe ich schon gezeigt, dass Kant von der transzendentalen und aposteriorischen Methode aus jeweils versucht hat, Gott zu erkennen bzw. die Eigenschaften Gottes zu bestimmen. Die transzendentale Methode betrachtet Gott als die höchste Intelligenz, die aposteriorische Methode als das ens realissimum. Jetzt werde ich das Verhältnis zwischen den beiden Ideen Gottes betrachten im Hinblick darauf, ob es doch eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen gibt. Es kommt mir hier darauf an, zu betonen, dass das ens realissimum Gott als Substratum der Materie der Welt bezeichnet, und dass die höchste Intelligenz Gott als Substratum der Form der Welt charakterisiert.
Im sechsten Abschnitt des Theologie-Hauptstückes, wird die Unmöglichkeit des physikotheologischen Beweises ausgeführt. Hier gibt es einen Absatz, der für die Fragestellung dieser Dissertation sehr wichtig ist. Er lautet wie folgt:
„Nach diesem Schlusse müßte die Zweckmäßigkeit und Wohlgereimtheit so vieler Naturanstalten bloß die Zufälligkeit der Form, aber nicht der Materie […] beweisen […] Der Beweis könnte also höchstens einen Weltbaumeister, der durch die Tauglichkeit des Stoffs, den er bearbeitet, immer sehr eingeschränkt wäre, aber nicht einen Weltschöpfer, dessen Idee alles unterworfen ist, darthun […] Wollten wir die Zufälligkeit der Materie selbst beweisen, so müßten wir zu einem transzendentalen Argumente unsere Zuflucht nehmen, welches aber hier eben hat vermieden werden sollen.“1
Kant postuliert in dieser Passage, dass der physikotheologische Beweis durch die Zweckmäßigkeit und Wohlgereimtheit der Welt bloß die Zufälligkeit der Form beweist. D.h. die Form kommt aus Gott, aber der Beweis kann nicht zeigen, dass die Materie der Welt von Gott kommt. Wenn man nicht beweisen kann, dass die Materie der Welt von Gott kommt, ist Gott nur der Architekt der Welt und somit der Materie der Welt unterworfen. Somit wird die Allgenugsamkeit Gottes stark eingeschränkt.2 Um zu beweisen, dass die Materie der Welt aus Gott kommt, „müßten wir zu einem transzendentalen Argument unsere Zuflucht nehmen“, doch leider ist das für den physikotheologischen Beweis a posteriori unmöglich. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass wir durch ein transzendentales Argument Gott als das ens realissimum bezeichnet haben. Deswegen besteht die Möglichkeit, dass die Materie der Welt aus Gott als ens realissimum kommt. Ich werde nun diese Hypothese beweisen.
In der Vorlesung über Rationaltheologie gibt es einen ähnlichen Paragraphen: „Dadurch verlieret Gott an seiner Majestät als Weltschöpfer nichts […] so ist auch diese Einrichtung in der Natur, nach welcher eine Anstalt nothwendig ist, aus seinem Wesen abzuleiten, aber nicht aus seinem Willen; denn sonst wäre er bloß Architekt der Welt, und nicht Weltschöpfer. Nur das Zufällige in den Dingen kann aus dem göttlichen Willen und aus willkürlichen Anordnungen desselben hergeleitet werden. Nun lieget aber alles Zufällige in der Form der Dinge; folglich kann man nur die Form der Dinge aus dem göttlichen Willen ableiten […] Denn die Materie, im welcher das Reale selbst lieget, leiten wir aus dem göttlichen Wesen her […] “3 Was Kant hier sagen möchte, ist, dass nur die Zufälligkeit oder die Form der Dinge aus dem göttlichen Willen und aus den willkürlichen Anordnungen desselben hergeleitet wird, die Materie jedoch aus dem göttlichen Wesen. Obwohl sich Kants Behauptung hier vom obigen Zitat unterscheidet, haben beide Zitate eine gemeinsame Bedeutung: Wenn Gott nur der Ursprung aller Formen der Dinge ist, kann er nur als Architekt der Welt betrachtet werden. Nur wenn er auch die Quelle der Materie der Welt ist, kann er als Schöpfer der Welt betrachtet werden, und die Form, die aus seinem Willen kommt, wird nicht durch die Materie eingeschränkt.
Daraus ergibt sich, dass sich Gott als ens realissimum oder ens originarium, das man durch die transzendentale Methode erkennt, auf die Materie der Welt bezieht. Im Gegensatz dazu bedeutet Gott als der göttliche Wille oder die höchste Intelligenz, die durch Analogie bestimmt wird, die Quelle der Form der Welt. Im Folgenden möchte ich dazu folgende Fragen stellen: (1) Was für eine Materie ist die hier genannte? (2) Warum ist Gott das Substratum der Materie? (3) Was bedeutet die Form der Welt?
(1) Zuerst möchte ich zeigen, dass Gott als ens realissimum eng mit der Materie verbunden ist. Wir haben in Abschnitt 1.2 den Ableitungsprozess des entis realissimi rekonstruiert. In diesem Prozess weist Kant auf das Folgende hin: „wenn also der durchgängigen Bestimmung in unserer Vernunft ein transzendentales Substratum zum Grunde gelegt wird, welches gleichsam den ganzen Vorrat des Stoffes, daher alle mögliche Prädikate der Dinge genommen werden können, enthält, so ist dieses Substratum nichts anders, als die Idee von einem All der Realität (omnitudo realitatis). Alle wahren Verneinungen sind alsdann nichts als Schranken, welches sie nicht genannt werden könnten, wenn nicht das unbeschränkte (das All) zum Grunde läge“4. Kant glaubt, dass dieses transzendentale Substratum „den ganzen Vorrat des Stoffes“ enthält. Daraus können wir erkennen, dass das Substratum eine enge Beziehung zum Stoff hat. Tatsächlich ist der Begriff der Materie im gesamten Prozess der Argumentation der zentrale Kern: z. B. enthält das Prinzip der durchgängigen Bestimmung „eine transzendentale Voraussetzung, nämlich die der Materie zu aller Möglichkeit, welche a priori die Data zur besonderen Möglichkeit jedes Dinges enthalten soll“5. Deshalb gilt z. B. für das ens realissimum: „also ist es ein transzendentales Ideal, welches der durchgängigen Bestimmung, die nothwendig bei allem, was existiert, angetroffen wird, zum Grunde liegt und die oberste und vollständige materiale Bedingung seiner Möglichkeit ausmacht.“6 An dieser Stelle ist nun zu fragen, was hier die Materie bedeutet.
Wie bereits ausgeführt wurde, behandelt Kant in der Ersten Analogie. Grundsatz der Beharrlichkeit der Substanz der KrV die Kategorie der Substanz-Akzidenz mit Hilfe der Zeit als Substratum des Wechsels, welches eine Analogie zur Beziehung zwischen Substanz und Akzidenz ist.7 Was die Substanz hier angeht, haben viele Forscher festgestellt, dass sie die Materie ist. Der Absatz, aus dem die Forscher ableiten, dass die Substanz als Materie verstanden werden muss, lautet: „Bei allem Wechsel der Erscheinungen beharrt die Substanz und das Quantum derselben wird in der Natur weder vermehrt noch vermindert.“8 Carl Friedrich von Weizsäcker verbindet diesen Absatz mit Kants Naturuntersuchung.9 Für diese Verbindung hat Weizsäcker viele Argumente: in den Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft definiert Kant z. B. das Erste Gesetz der Mechanik wie folgt: „Bei allen Veränderungen der körperlichen Natur bleibt die Quantität der Materie im Ganzen dieselbe, unvermehrt und unvermindert.“10 Dazu erklärt Kant: „nun entsteht und vergeht bei allem Wechsel der Materie die Substanz niemals; also wird auch die Quantität der Materie dadurch weder vermehrt, noch vermindert, sondern bleibt immer dieselbe und zwar im Ganzen“. 11 Gleichzeitig weist Kant im Versuch, den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen darauf hin: „in allen natürlichen Veränderungen der Welt wird die Summe des Positiven […] weder vermehrt noch vermindert.“12 Diese Absätze geben uns einen Schlüssel, um die Bedeutung der Materie in Kants Metaphysik und Naturforschung zu verstehen.13
Wenn wir feststellen, dass in den oben genannten beiden Zitaten „die Quantität der Materie“ und „die Summe des Positiven“ dieselbe Bedeutung haben, dann können wir daraus ableiten, dass das Positive mit der Materie gleichzusetzen ist. Also bedeutet die Materie das Positive (Realität) und so entspricht bei Kant die Materie metaphysisch der Summe der Realität. Nun prüfen wir dieses Argument in Verbindung mit Kants Naturforschung und seinem metaphysischen Denken in der vorkritischen Zeit.
In der Naturgeschichte veröffentlicht Kant seinen physikotheologischen Beweis von der Existenz Gottes: „Die Materie, die der Urstoff aller Dinge ist, ist also an gewisse Gesetze gebunden, welchen sie frei überlassen nothwendig schöne Verbindungen hervorbringen muß. Sie hat keine Freiheit von diesem Plane der Vollkommenheit abzuweichen. Da sie also sich einer höchst weisen Absicht unterworfen befindet, so muß sie nothwendig in solche übereinstimmende Verhältnisse durch eine über sie herrschende erste Ursache versetzt worden sein, und es ist ein Gott eben deswegen, weil die Natur auch selbst im Chaos nicht anders als regelmäßig und ordentlich verfahren kann.“14 In Kapitel 7 des 2. Abschnittes betont Kant gleichzeitig: „allein die Grundmaterie selber, deren Eigenschaften und Kräfte allen Veränderungen zum Grunde liegen, ist eine unmittelbare Folge des göttlichen Daseins: selbige muß also auf einmal so reich, so vollständig sein, daß die Entwicklung ihrer Zusammensetzungen in dem Abflusse der Ewigkeit sich über einen Plan ausbreiten könne, der alles in sich schließt, was sein kann, der kein Maß annimmt, kurz, der unendlich ist.“15 Gemäß diesen beiden Zitaten kommen wir zum Schluss, dass die Materie der Welt unendlich ist, dass sie sich weder vermehrt noch vermindert. Natürlich entspricht die Materie in der Naturforschung dem Begriff der metaphysischen Materie nicht direkt. Zum Verständnis von Kants metaphysischem Materiebegriff können wir auf die nova dilucidatio verweisen. In PROP. VII der nova dilucidatio wird das Sein Gottes dargestellt. Dieser Beweis ist in zwei Schritte unterteilt: (1) Kant schließt vom Stoff für alle möglichen Begriffe auf das absolut notwendige Wesen und (2) von dem absolut notwendigen Wesen auf das unendliche und einzige Wesen.16 Der Stoff der möglichen Begriffe ist Realität. In PROP. X der nova dilucidatio schlägt Kant vor: „Quantitas realitatis absolutae in mundo naturaliter non mutatur, nec augescendo nec decrescendo.“17 Das bedeutet, dass Gott als Inbegriff aller Realitäten notwendig alle Realitäten enthält. Der Beweis vom Sein Gottes a posteriori in der Naturgeschichte und der Beweis a priori in der nova dilucidatio sind formal unterschiedlich, aber am Ende beweisen sie beide, dass Gott ein ausreichender Grund für die Unendlichkeit und Vielfältigkeit der Dinge sein kann. Aus diesem Grund glauben einige Forscher, dass die beiden Arbeiten grundsätzlich konsistent sind.18 In Bezug auf die Forschungsfrage dieser Dissertation wird daraus abgeleitet, dass die Materie in Kants Naturforschung mit der Realität im metaphysischen Denken verglichen werden kann, oder dass Kants Materie aus metaphysischer Sicht Realität ist und die Realität mit der Möglichkeit der Dinge gleichzusetzen ist.19 Mit anderen Worten, unabhängig davon, wie sich die Form der Dinge ändert, ändert sich die Summe der Möglichkeiten oder Realitäten hinter den Dingen nicht. Wie Kant selbst gesagt hat: „auch wurde in Ansehung der Dinge überhaupt unbegrenzte Realität als die Materie aller Möglichkeit, Einschränkung derselben aber (Negation) als diejenige Form angesehen.“20 Hier ist der Begriff der „unbegrenzten Realität“ dem Inbegriff der Realitäten, der Summe des Positiven gleich, ebenso wie der Quantität der Materie in der Naturforschung, die als Materie aller Möglichkeiten betrachtet wird.
Daraus folgt, dass die Materie der Summe der Möglichkeit oder der Realität entspricht. Jetzt können wir festhalten, dass Gott, wenn er als ens realissimum betrachtet wird, das Substratum für die Materie der Welt ist, und zwar in dem Sinn, dass der Inbegriff der Materie die Summe der Realität bedeutet.
(2) Des Weiteren kann jetzt die Frage beantwortet werden, warum Gott das Substratum der Materie ist. Die Antwort ist einfach: Weil Gott als das ens realissimum betrachtet wird, das doch in Relation zu „dem Inbegriff aller möglichen Prädikate“ steht. Genauer gesagt, ist die Materie der Welt der Inbegriff aller möglichen Prädikate. Aus diesem Grund ist es plausibel, dass Gott mit der Materie der Welt zu tun hat. Dieser Zusammenhang muss noch ausführlicher interpretiert werden.
An dieser Stelle halten wir fest, dass die Materie der Summe (dem Inbegriff) der Realitäten entspricht. Ich habe den folgenden Absatz oben zitiert: „Wenn also der durchgängigen Bestimmung in unserer Vernunft ein transzendentales Substratum zum Grunde gelegt wird, welches gleichsam den ganzen Vorrat des Stoffes, daher alle mögliche Prädikate der Dinge genommen werden können, enthält, so ist dieses Substratum nichts anders, als die Idee von einem All der Realität (omnitudo realitatis). Alle wahren Verneinungen sind alsdann nichts als Schranken, welches sie nicht genannt werden könnten, wenn nicht das unbeschränkte (das All) zum Grunde läge.“21 Hier sehen wir, dass das ens realissimum als Substratum eine Überlagerung aller Realitäten zu sein scheint, so dass andere Dinge als Beschränkungen an diesem Substratum betrachtet werden können. Daher scheint die Beziehung zwischen diesem Substratum und anderen endlichen Dingen die Beziehung zwischen dem Ganzen und dem Teil zu sein. Diese Bedeutung ist am deutlichsten, wenn Kant sagt: „alle Mannigfaltigkeit der Dinge ist nur eine eben so vielfältige Art, den Begriff der höchsten Realität, der ihr gemeinschaftliches Substratum ist, einzuschränken, so wie alle Figuren nur als verschiedene Arten, den unendlichen Raum einzuschränken, möglich sind.“22 Aber ist die Beziehung zwischen allen Dingen und Gott als Substratum wirklich der Beziehung zwischen allen Figuren und dem unendlichen Raum ähnlich?